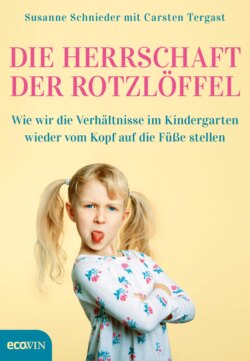Читать книгу Die Herrschaft der Rotzlöffel - Susanne Schnieder - Страница 7
Und nun, Frau Zukunftsingenieurin?
ОглавлениеEin Tag im September, in einem Kindergarten irgendwo in Deutschland. Seit August sind die neuen Kinder in der Einrichtung, und eine aufregende Zeit für alle Beteiligten hat begonnen. Wie an jedem Tag herrscht ein ganz schönes Gewusel in den Räumen, aufgeregtes Geschnatter hier, intensives Spiel dort, und die Erzieher sind vollauf damit beschäftigt, Ordnung in das Gewusel zu bringen.
Mittendrin: Leonie, im Frühjahr drei Jahre alt geworden, ein etwas schüchternes, aber freundliches Mädchen mit einer hübschen Zopffrisur. Aufmerksam hört sie zu, als die Erzieherin Heike den Kindern das Bewegungsspiel erklärt, dem sich die Gruppe nun widmen soll. Im Turnraum der Einrichtung ist eine Bank in die Sprossenwand eingehängt. Die Kinder sollen vorsichtig die leicht schräge Bank hinaufbalancieren und am Ende zunächst auf einen kleinen, danebenstehenden Kasten hüpfen, danach von diesem auf den Boden und wieder von vorne beginnen. Sind die Kinder unsicher, geben die Erzieher Hilfestellung, die forscheren Jungen und Mädchen rennen die Bank selbstbewusst allein hinauf. Joshua, der daheim im Garten einen richtigen Kletterbaum zur Verfügung hat, beschwert sich, dass die leichte Übung ja »total langweilig« sei.
Die Bank wird nicht sonderlich beansprucht, drei- und vierjährige Kinder bringen nun mal noch nicht so viele Kilos auf die Waage. Nur bei einem Teilnehmer der sportlichen Runde biegt sie sich merklich durch und die Erzieher hoffen, dass die Sprosse, an der die Bank eingehängt ist, nicht durchbrechen wird. Kein Wunder, dass Bank und Sprossenwand hier ächzen, denn dieser Teilnehmer ist nicht drei oder vier Jahre alt, sondern bereits 35, er heißt Dirk, und außerdem ist er Leonies Vater.
Immer häufiger kommt es beim Wort »Eingewöhnungsphase« zu Fehlinterpretationen, so auch in diesem Fall. Zum einen scheint es so, als wenn weniger Leonie als ihr Vater sich eingewöhnen müsste, zum anderen zeigt dieser Fall exemplarisch, wie wenig selbstverständlich heute in vielen Fällen die ganz normalen Routinen im Umgang mit Kindern sind.
Dirk bringt Leonie von Beginn an in den Kindergarten, und schnell merken die Erzieher, dass es mit ihm herausfordernd werden wird. Er weicht dem Kind nicht von der Seite, guckt sich die Arbeit der Erzieher mit großem Interesse an und schreckt auch nicht vor der einen oder anderen Handlungsempfehlung zurück. Leonie findet es natürlich toll, dass ihr Papa die ganze Zeit anwesend ist, und so hatte sie auch heute die Idee, dass er doch an der Sportrunde teilnehmen könnte. Hatten die Erzieher bis hierhin noch gedacht, es könne selbst für Dirk eine Grenze geben, so wurden sie nun eines Besseren belehrt. Ein erwachsener Mann, der ganz offenbar nichts Außergewöhnliches daran findet, mitten in einer Kindergartengruppe von Drei- und Vierjährigen mitzumachen, als wenn er selbst dazugehören würde. Hatten die Erzieher bisher noch darauf gesetzt, dass sich das »Thema« Dirk irgendwann von alleine erledigen würde, so erschien ihnen nun doch akuter Handlungsbedarf. Anstatt sanfter Hinweise, seine Tochter doch einfach in Ruhe ihren Kindergartenalltag erleben zu lassen, bat die Leiterin ihn zum Gespräch. Auf die nun deutlicheren Worte, dass sein Verhalten unangemessen sei, reagierte er verunsichert. Er wolle seiner Tochter doch nur die Eingewöhnung erleichtern. Sie brauche doch das Gefühl, dass Papa die ganze Zeit für sie da sei, auch in der ungewohnten neuen Umgebung des Kindergartens.
Erst nach einigen Minuten des Gesprächs kam eine erste unsichere Frage seinerseits, ob er es denn tatsächlich übertreibe. Diese Erkenntnis, das war ganz deutlich zu spüren, musste sich erst langsam in ihm ausbreiten, bisher war er wirklich felsenfest davon ausgegangen, zum Wohle seiner Tochter zu handeln, sein Verhalten kam ihm nicht im Geringsten merkwürdig vor.
Wenn wir von Beispielen wie diesen erzählen, schwanken die Reaktionen zwischen lautem Lachen, ungläubigem Staunen, traurigem Kopfnicken und dem im Brustton der Überzeugung vorgetragenem Vorwurf, das hätten wir uns doch alles nur ausgedacht, um die Leser zu schocken. Als wir vor drei Jahren die Arbeit an Die Rotzlöffel-Republik abgeschlossen hatten und das Buch erschienen war, zeigten uns die Reaktionen, dass wir in ein Wespennest gestochen hatten. Begeisterte Zustimmung einerseits, Protest und fehlender Glaube, dass das, was wir beschrieben tatsächlich existiert, andererseits, erreichten uns sowohl auf Veranstaltungen als auch schriftlich. Kinder, ihre Entwicklung, frühkindliche Bildung, die Betreuungssituation in einer Zeit, in der immer mehr Eltern nicht mehr aus dem Hamsterrad auszusteigen vermögen, all das bewegt viele Menschen, mehr noch: Es erzeugt unglaublich viele unterschiedliche Ansichten, wie wir uns angesichts der aktuellen Entwicklungen zu verhalten haben.
Naturgemäß geraten in dieser Diskussion zuerst die Kinder selbst aus dem Blick, denn diese können im Alter bis zu sechs Jahren noch nicht so viel Einfluss auf die öffentliche Diskussion nehmen. Ihre Interessen jedoch müssten gegenüber der Politik, die die Rahmenbedingungen zu schaffen hat, gleichermaßen vom Kita-Personal und von den Eltern vertreten werden. Leider ist das immer seltener der Fall, und man hat als erfahrener Erzieher immer häufiger das Gefühl, an allen Fronten gegen Mauern zu rennen, wenn man auf Missstände aufmerksam macht.
Seit Erscheinen des Buches ist die Großwetterlage nicht besser geworden, und wir werden zusätzlich noch die Folgen der Corona-Krise zu meistern haben, auch wenn, wie im Vorwort beschrieben, hier sogar positive Effekte eintreten könnten. Natürlich wird in sehr vielen Einrichtungen nach wie vor großartige Arbeit geleistet, die Kinder sind dort gut aufgehoben. Doch die Bedingungen, unter denen dies geschieht, verschlechtern sich weiter, und zwar in gleichem Maße, wie die Anzahl der Problemfälle aufseiten der Kinder und Eltern steigt.
Im letzten Kapitel der »Rotzlöffel-Republik« ging es um die Erzieher als »Zukunftsingenieure« – ein Begriff, der beschreiben sollte, dass gerade in diesen ersten sechs Jahren außerhäuslicher Betreuung von Kindern die Weichen für die Zukunft gestellt werden und die Erzieher dabei eine viel wichtigere Rolle spielen, als ihnen unsere Gesellschaft derzeit zuweist. Es sollte an dieser Stelle gerechterweise nicht verschwiegen werden, dass der Fachkräftemangel zumindest in Ansätzen dafür gesorgt hat, dass die Politik einen anderen Blick auf das Berufsfeld bekommt. Ein Ergebnis dessen ist etwa das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Dieses Gesetz sorgt dafür, dass zusätzliches Geld in den Elementarbereich fließt. Problem also gelöst? Nicht wirklich. Es ist jedem Bundesland freigestellt, wie diese Mittel verwendet werden. Damit tritt eher selten der Effekt ein, dass endlich mehr Personal vorhanden ist und die Betreuungslage sich tatsächlich entspannt. Stattdessen wird vielerorts noch mehr Geld beispielsweise in Qualitätsmanagementprojekte mit zweifelhaftem Output gesteckt. Mit anderen Worten: Einfach nur mehr Geld ins System pumpen reicht nicht, wenn es anschließend sinnlos »verbrannt« wird.
Schauen wir also genau hin, was passieren muss, um einer der wichtigsten Keimzellen unserer Gesellschaft wieder besser zu stärken. Dazu lohnt es sich, das »Gute-Kita-Gesetz« einer näheren Prüfung zu unterziehen.