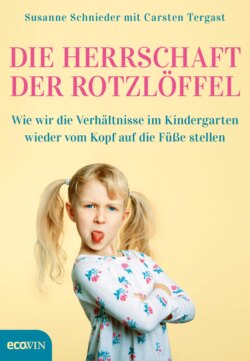Читать книгу Die Herrschaft der Rotzlöffel - Susanne Schnieder - Страница 8
ОглавлениеKann ein Gesetz gute Kindergärten »machen«?
Oder: Wie Politik scheinbar reagiert und sich elegant aus der Affäre zieht
Natürlich heißt das »Gute-Kita-Gesetz« gar nicht so. Tatsächlich heißt es »Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz« oder wie man unter Abkürzungsfetischisten sagt: »KiQuTG«. Aber bleiben wir trotzdem bei der interessanten Formulierung, die auch vonseiten der Politik durchaus genehm zu sein schien. »Gute-Kita-Gesetz«, das soll positiv klingen, Aufbruchsstimmung hervorrufen. Vor allem aber soll es uns alle glauben lassen, es bedürfe lediglich eines simplen Gesetzes, um jahrzehntelange Misswirtschaft auszumerzen. Tatsächlich wirft diese Bezeichnung mindestens zwei Fragen auf: Wenn die Kitas nun per Gesetz »gut« gemacht werden sollen, waren sie vorher alle schlecht? Und: Ist es so einfach? Kann man die unzähligen Kitas im Land einfach per Dekret »gut« oder gar besser machen?
Zugegeben, diese Fragen sind vielleicht ein wenig spitzfindig, und vielleicht werden Sie sagen, wir sollten uns doch freuen, dass sich die Politik endlich für das Wohlergehen der Kitas interessiert. Das ist auch der Fall, in der Not greift man schließlich nach jedem Strohhalm. Letztlich gilt jedoch: Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Soll heißen: Wir freuen uns tatsächlich, dass es offenbar zumindest eine erhöhte Wahrnehmung der Probleme im Elementarbereich seitens der politischen Entscheidungsträger auf höchster Ebene gibt. Gleichzeitig jedoch weist das, was bei dieser Wahrnehmung am Ende herausgekommen ist, so entscheidende Mängel auf, dass es unerlässlich ist, das Ganze genauer unter die Lupe zu nehmen und den Entscheidungsträgern ins Stammbuch zu schreiben, warum dieses Gesetz zum Rohrkrepierer zu werden droht.
Das Gesetz trat zum 1. Januar 2019 in Kraft, also lange bevor der erste Buchstabe des Manuskriptes für dieses Buch in die Tastatur getippt war. Ende 2019, als erste Teile dieses Buches ihrer Fertigstellung entgegensahen, hatte mit Hessen endlich das letzte Bundesland den Vertrag mit dem Bund unterschrieben. Fast ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes waren also tatsächlich alle Bundesländer im Boot, und möglicherweise ist nun, da Sie dieses Buch in Ihren Händen halten, auch »schon« das erste Geld geflossen. Allein an diesem Prozedere, nämlich der dem Bildungsföderalismus geschuldeten Notwendigkeit, mit jedem Bundesland einen eigenen Vertrag abzuschließen, zeigt sich ein Grundproblem deutscher (Bildungs-) Politik. Bis Probleme erkannt und ihre vermeintlichen Lösungen in Gesetzesform gegossen sind und mit der Umsetzung begonnen werden kann, geht so viel Zeit ins Land, dass sich die bestehenden Probleme verschärft haben und neue hinzugekommen sind.
Da sich die Große Koalition nicht so richtig einig werden konnte, wofür denn die stattliche Summe von 5,5 Milliarden Euro aus dem Paket tatsächlich eingesetzt werden sollen – die CDU war mehr für Investitionen in Qualität, die SPD für eine stärkere Entlastung der Eltern bei den Beiträgen – entschloss man sich, im Gesetz zehn »Handlungsfelder« festzulegen, für die die Länder das Geld vom Bund selbstständig verwenden sollen. Das klingt dann so:
1.ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung schaffen, welches insbesondere die Ermöglichung einer inklusiven Förderung aller Kinder sowie die bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten umfasst,
2.einen guten Fachkraft-Kind-Schlüssel in Tageseinrichtungen sicherstellen,
3.zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung beitragen,
4.die Leitungen der Tageseinrichtungen stärken,
5.die Gestaltung der in der Kindertagesbetreuung genutzten Räumlichkeiten verbessern,
6.Maßnahmen und ganzheitliche Bildung in den Bereichen kindliche Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung fördern,
7.die sprachliche Bildung fördern,
8.die Kindertagespflege (§ 22 Absatz 1 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) stärken,
9.die Steuerung des Systems der Kindertagesbetreuung im Sinne eines miteinander abgestimmten, kohärenten und zielorientierten Zusammenwirkens des Landes sowie der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe verbessern oder
10.inhaltliche Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung bewältigen, insbesondere die Umsetzung geeigneter Verfahren zur Beteiligung von Kindern sowie zur Sicherstellung des Schutzes der Kinder vor sexualisierter Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung, die Integration von Kindern mit besonderen Bedarfen, die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, die Nutzung der Potentiale des Sozialraums und den Abbau geschlechterspezifischer Stereotype.
Viele schöne Worte, gleichwohl nur schwer mit Inhalt zu füllen. Allein die Tatsache, dass es den Bundesländern vollkommen freigestellt ist, wie sie die Mittel verwenden, führt dazu, dass mindestens ein großes Dilemma bereits deutlich zutage tritt und aufzeigt, warum sich qualitativ durch dieses Gesetz wohl nur wenig zum Besseren verändern wird. Dieses Dilemma hört auf den wohlklingenden Namen »Beitragsfreiheit«.
In vielen Köpfen führender Politiker hat sich die Meinung festgesetzt, dass gute Kinderbetreuung vor allem etwas damit zu tun habe, dass jeder diese geschenkt bekomme. Etwas ketzerisch könnten wir an dieser Stelle auf den alten Spruch »Wat nix kost’, dat is’ auch nix« verweisen, würden uns damit aber natürlich auf eine populistische Stufe mit der Politik stellen.
Denn die Diskussion über die Beitragsfreiheit ist vor allem genau das: populistisch. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig war beispielsweise mit dem Versprechen der totalen Beitragsfreiheit in den Wahlkampf gegangen und hatte dabei offenbar die ganze Zeit im Hinterkopf, dass sie dieses Versprechen für ihr Bundesland irgendwann auf Kosten des Bundes würde einlösen können. Und siehe da: MV ist eines der Länder, das die komplette Zuwendung dafür einsetzt, den Besuch des Kindergartens im Land kostenlos zu machen.
Aber auch in anderen Bundesländern ist ein erklecklicher Teil des Geldes dafür gedacht, die Eltern zumindest von einem Teil der Beiträge zu entlasten. Begründung unter anderem: Beitragsfreiheit animiere Eltern dazu, mehr Kinder immer früher in eine Betreuung zu schicken, da sich arbeiten stärker lohne. Nun könnte man angesichts solcher Begründungen zum einen diskutieren, wie sinnvoll es ist, immer mehr Kinder immer früher fremdbetreuen zu lassen, zum anderen zeigt das aber auch, dass der Wegfall der Beiträge gleichzeitig auch für eine noch höhere Belastung von Kitas sorgen wird, deren Bewältigung mit dem Rest des Geldes kaum aufzufangen sein wird.
Und dann ist da noch die Sache mit der Befristung. All das schöne Geld wird es nämlich nach gegenwärtigem Stand nur einmal geben. 2022 sind die 5,5 Milliarden dann verteilt und werden für was auch immer verwendet, anschließend ist der Geldhahn erst einmal wieder zu. Zwar hat die zuständige Ministerin Franziska Giffey munter getwittert, die Gelder würden »über 2022 hinaus verstetigt«, doch gibt es für diese Aussage keinerlei konkrete Grundlage. Im Gesetz steht die Befristung, alles andere sind Absichtserklärungen, von denen wir alle wissen, was sie aus dem Munde von Politikern häufig wert sind, viel mehr noch, nachdem jedem klar sein muss, dass die Folgekosten der Corona-Pandemie immens sein werden und mit Sicherheit unter anderem durch Kürzungen in verschiedenen Bereichen finanziert werden.
Darüber nachzudenken lohnt sich indes. Was machen wir, wenn der Geldstrom tatsächlich wieder versiegt? Wenn man die Systemrelevanz von Kindertageseinrichtungen nach Corona schnell wieder vergessen hat? Werden dann plötzlich wieder Gebühren erhoben? Gehälter gesenkt? Gar Einrichtungen geschlossen? An diesem Detail lässt sich erkennen, mit welchem Problem wir es generell in der Bildungsdebatte und speziell in der Diskussion um Verbesserungen im Elementarbereich nur zu häufig zu tun haben: Es wird zu selten mit nachhaltigen Konzepten agiert und stattdessen mit unausgegorenen Schnellschüssen reagiert.
Natürlich gibt es auch diverse gute Ideen und Maßnahmen, für die das Geld verwendet werden soll. Eine Entlastung der Kita-Leitungen steht in Bayern im Fokus, in Berlin plant man eine Gehaltszulage für Erzieher in Brennpunkt-Kitas und mehr Unterstützung bei der Qualifizierung von Quereinsteigern. Die letzten beiden Punkte bieten für sich genommen auch schon wieder Diskussionspotenzial (wie entstehen Brennpunkt-Kitas, ist es sinnvoll, im Elementarbereich auf Quereinsteiger zu setzen?), aber wir sollten anerkennen, wenn akute Probleme zumindest zunächst einmal bearbeitet werden.
Mehr Geld für mehr Zeit – das muss oberste Priorität sein
Nun wollen wir an dieser Stelle nicht dabei verharren, welche Auswirkungen das Gute-Kita-Gesetz nicht haben wird. Das Geld ist ja nun mal da, und aus unserer Sicht muss eine ganz bestimmte Verbesserung im Fokus stehen. Mit all dem Geld sollten wir Zeit kaufen.
Wie kauft man Zeit in der Kita? Nun, indem man jedem einzelnen Erzieher mehr davon zur Verfügung stellt, damit er sich in Ruhe um die ihm anvertrauten Kinder kümmern kann. Und indem man den Kita-Leitungskräften mehr davon zur Verfügung stellt, um ihre Einrichtung führen und weiterentwickeln zu können.
Mehr Zeit für jeden einzelnen Erzieher bedeutet natürlich nicht längere Arbeitszeiten, sondern eine Veränderung des Personalschlüssels, Neueinstellungen und eine Erhöhung der Attraktivität des Berufs auch durch bessere Bezahlung.
Je besser der Personalschlüssel, je weniger Kinder also einem Erzieher zugeordnet sind, desto mehr Zeit kann der einzelne Erzieher mit »seinen« Kindern verbringen, desto ruhiger kann er mit entstehenden Problemen umgehen und desto mehr Zeit ist auch, im Zweifelsfall mit Eltern oder Großeltern zu sprechen, und zwar ebenfalls in Ruhe.
Die komplette Beitragsfreiheit ist letztlich nur ein Leckerli für die aktuellen und angehenden Eltern mit Kindern im entsprechenden Alter unter den Wählern. Die meisten Eltern sind durchaus bereit, für eine gute Betreuung in der Kita einen angemessenen Beitrag zu zahlen. Ihnen ist bewusst, dass Bildung nicht kostenlos zu haben ist und die im Bildungsbereich tätigen Menschen nicht von Luft und Liebe leben.
Sprechen wir über Geld
Mehr Personal also. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Eine davon heißt »Bezahlung«. Es ist dringend geboten, in einer Branche, in der immer noch viel zu häufig davon ausgegangen wird, dass es den meisten Mitarbeitern vollkommen reicht, einer wichtigen und sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, endlich über Geld zu sprechen. Fragen Sie doch mal eine Führungskraft aus der Versicherungsbranche, wie sie ein angemessenes Gehalt definiert. Da bekommen Sie zum Teil Antworten wie »Na ja, so um die 120.000 Euro Jahreseinkommen sollten es schon sein.« Der Blick auf eine Verdienstbescheinigung im Bekanntenkreis zeigte für einen Mann, der für einen Energieversorger im Montagebereich tätig ist, 78.000 Euro Jahreslohn und für seine Frau, die 19,5 Stunden im medizinischen Bereich arbeitet, zusätzlich noch einmal 25.000 Euro. Erzieher in einer Vollzeitbeschäftigung bringen es häufig nicht einmal auf 40.000 Euro Jahreseinkommen und das nach langen Jahren im Berufsleben.
Die meisten Menschen reden nicht gern über Geld, schon gar nicht, wenn es den Wert ihrer Arbeit beziffern soll, und diejenigen, die im sozialen Bereich arbeiten, sprechen wohl am seltensten über dieses Thema. Seltsamerweise findet sich unter den zahllosen Fortbildungsveranstaltungen für Erzieher nie eine mit dem Titel »Besser übers Gehalt verhandeln«. Sinnvoll wäre es.
Sinnvoll wäre aber vor allem, einen Teil der Gelder aus dem Gute-Kita-Gesetz für eine bessere Bezahlung an der Basis einzusetzen. Damit auch das Einstiegsgehalt eines Erziehers zumindest so aussieht, dass dieser einigermaßen davon leben kann. Tatsächlich jedoch berichteten bei den Interviews zu diesem Buch viele Erzieher, die über einen Wechsel der Einrichtung nachdachten, dass ihnen bei Vorstellungsgesprächen deutlich weniger Gehalt angeboten wurde als auf ihrer aktuellen Stelle. Das wirkt dann nicht unbedingt, als wenn der potenzielle neue Arbeitgeber die neue Kraft wirklich unbedingt haben möchte. (Ändert sich aber tatsächlich ansatzweise durch den Fachkräftemangel.)