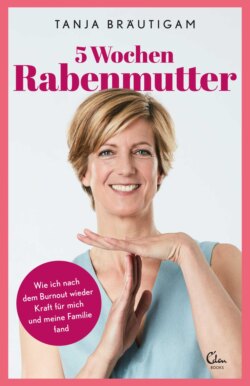Читать книгу 5 Wochen Rabenmutter - Tanja Bräutigam - Страница 8
Raus hier
ОглавлениеIch steige in den ICE nach Freiburg, und es fühlt sich schrecklich an. Fast vier Monate habe ich für diesen Moment gekämpft. Vier Monate kämpfen für einen Platz in meiner Wunschklinik. Eine sehr kleine psychosomatische Rehabilitationsklinik, die anthroposophisch arbeitet und den Menschen ganzheitlich behandelt. Bürokratischer Wahnsinn, das durchzusetzen. Und vier Monate im Alltag durchhalten mit allen Symptomen der Niedergeschlagenheit, der Erschöpfung und den unzähligen Ängsten. Mehrere Male war ich kurz davor, mich in eine psychosomatische Akutklinik einweisen zu lassen.
Die negativen Gefühle sind nicht zum Aushalten, sie nehmen mir den Boden unter den Füßen weg. Ich habe keinen Halt mehr. Nichts ist mehr da. Mit aller Macht möchte ich erzwingen, dass die negativen Gefühle verschwinden. Ich kämpfe gegen sie an. Es ist ungefähr so, als wollte ich eine Welle, die direkt auf mich zukommt, ins offene Meer zurückdrängen. Das kann nicht funktionieren. Die Taktik, sich für alle anderen »aufzuopfern«, die uns Frauen so gut liegt, bringt anscheinend gar nichts. Am Ende haben beide Seiten verloren. Die Seite, die sich aufopfert, und die Seite, die das mitmacht. Zuerst gibt man sich für die eigene Familie auf, und dann muss die Familie sich mehr denn je um einen kümmern, weil man vergessen hat, sich um sich selbst zu kümmern und völlig ohne Energie ist.
Fünf Wochen stehe ich jetzt als Mama nicht zur Verfügung. Ganz ehrlich, da hätte ich doch besser in den letzten fünf Jahren regelmäßig Auszeiten für mich genommen, als jetzt direkt fünf Wochen am Stück. Aber es geht nicht anders. Ich kann nur zu mir selbst finden, wenn ich meine Rolle als Mutter und Ehefrau für eine Weile ablegen darf.
Ich glaube, dass ich die letzten vier Monate nur mithilfe meiner Werte aus dem Sport geschafft habe. Knapp zwanzig Jahre bin ich Handballerin gewesen. Davon viele Jahre auf sehr hohem Niveau. Im Leistungssport gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Gute Phasen, schlechte Phasen. Ich weiß, wie es sich anfühlt zu verlieren, und ich bin in der Lage, wieder aufzustehen, an mir zu arbeiten und dabei mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und ich besitze aufgrund vieler Jahre in der zweiten Bundesliga sehr viel Disziplin. Das hat mir geholfen, in den schwierigsten Monaten meines Lebens durchzuhalten und nicht aufzugeben. Und die unendlich große Liebe zu meinen Kindern hat mich ebenfalls die letzten vier Monate am Leben gehalten.
Natürlich ist es der Worst Case, nicht mehr in der Lage zu sein, seinen Alltag mit all den Dingen, die bei zwei kleinen Kindern dazugehören, zu bewältigen. Das Rad der permanenten Überforderung drehte sich unnachgiebig weiter. Aber das »Weitermachen-Müssen« bedeutet auch, dass man mithilfe der Kinder immer wieder ins Hier und Jetzt zurückgeholt wird. Wenn man seine eigene Hand in die Hände seiner Kinder schiebt, steht die Welt für einen Augenblick still. Wenn ich beim Einschlafen für einen kurzen Moment mein Ohr auf die Brust eines meiner Kinder lege und seinen ruhigen, gleichmäßigen Herzschlag spüre, wird mir bewusst, warum ich durchhalten muss und durchhalten werde.
Der Abschied zu Hause war knallhart. Mit ihren vier Jahren versteht meine Tochter vielleicht ein wenig, dass der Aufenthalt für mich notwendig ist. Für den Kleinen ist Mama einfach nur weg. Es brach mir das Herz, meine Kinder weinen zu sehen, und selbst mein Mann weinte. Und ich natürlich wasserfallmäßig auch. Der Trennungsschmerz bricht mir nicht nur das Herz, er reißt es mir raus.
Die Zugfahrt von Köln nach Freiburg nutze ich, um den Fragebogen der Klinik auszufüllen. Fragen über Fragen zu meinem bisherigen Leben, zu meiner familiären Situation, zu meinen Beschwerden und natürlich, ganz wichtig, zu meinen Zielen für den kommenden Aufenthalt in der psychosomatischen Klinik. Ich merke, wie mich mein Abteilnachbar gegenüber dabei beobachtet. Okay, es ist eindeutig am Briefkopf zu erkennen, wohin meine Reise geht: »Psychosomatische Rehaklinik«.
Ich schaue aus dem Fenster. Ganz sicher habe ich mir mein Leben anders vorgestellt, als jetzt mit Ende dreißig in einer psychosomatischen Rehaklinik zu landen. Nein, das gehörte nicht zu meinen Plänen. Aber das Leben schreibt wohl oft andere Geschichten als eigentlich geplant. Das ist Leben. Oft genug habe ich in den letzten Monaten gedacht, dass ich so ein Leben nicht möchte. Ich will es nicht haben. Nicht ich. Die, die immer tough ist, die erfolgreich ist, zwei gesunde Kinder hat, immer alles im Griff hat, sportlich ist, die von den Menschen geliebt wird für ihre positive Art, so jemand kann doch unmöglich psychisch krank werden. Das will nicht in meinen Kopf hinein. Nicht ich! Bitte nicht ich!
Um mir nicht weiter den Kopf zu zermartern, widme ich mich wieder dem Fragebogen. Mein Gegenüber, ein seriös wirkender Endsechziger, grau meliert, beobachtet mich weiter und lächelt mir milde zu. Ist auch egal, soll er ruhig wissen, wo ich hinfahre. Ich döse etwas ein. Als ich wieder aufwache, machen wir Halt in Mannheim. Mein Gegenüber steigt aus und sagt zu mir: »Ich wünsche Ihnen in diesem Fall keine gute Hinfahrt, sondern eine erfolgreiche Rückfahrt!«
Sofort schießen mir die Tränen in die Augen. Was für eine wunderbare und besonnene Aussage. Und wie wahr. Die Rückfahrt ist wichtig und dass ich zu diesem Zeitpunkt wieder Kraft und Hoffnung geschöpft habe. Die Hinfahrt spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle.
Mir fällt ein Zitat des griechischen Naturphilosophen Demokrit ein:
»Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.«
Ich hoffe, am Ende des Aufenthaltes das Glück auf meiner Seite zu haben, wenn ich schon den Mut für diese Auszeit aufbringe. Es sind diese kleinen Gesten, die das Herz berühren. So, wie wenn dir ein fremder Mensch ein Taschentuch reicht, weil du gerade nicht anders kannst als weinen. Ich glaube, die Aussage meines Abteilnachbars werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So viel Mitgefühl und Feinsinn von einem wildfremden Menschen. Danke für diesen Moment.
In Mannheim setzt sich eine ältere Frau zu mir. Sie ist klein, trägt einen akkuraten Pagenschnitt, die Haare sind eher weiß als grau. Sie wirkt sehr unsicher und teilt mir schnell mit, dass sie zu ihrer Tochter in die Schweiz reist und tatsächlich nervös ist, weil sie noch nie allein gereist ist. Sie erzählt mir von ihren Kindern, die bereits aus dem Haus sind, von ihren Nöten, von ihren Träumen. Ich höre zu und wünsche mir so sehr, dass ich in diesem Alter meine Sorgen und Ängste losgelassen habe und endlich leben darf. Ich stelle mir vor, wie ich alle Dinge realisiere, die ich schon immer mal tun wollte, wenn die Kinder groß sind und wenn ich die wichtigste Lektion im Leben gelernt habe: Loslassen! Ein wenig träumen hilft, die Realität zu vergessen. Doch die Realität holt mich schnell zurück ins Hier und Jetzt. Freiburg ist erreicht, und ich muss mit meinem riesengroßen Koffer umsteigen.
»Kann ich Ihnen helfen«?, fragt erneut ein fremder Mensch. Und auch diese Frage öffnet mein Herz. Ja, gern, denn zu zweit ist es einfacher. In diesem Fall den schweren Koffer zu tragen. Danke!
Weiter geht es mit dem Regionalzug ins Breisgau. Wieder versuche ich, mich innerlich zu beruhigen. Die Aufregung kurz vor dem Ziel ist ziemlich groß. Schaffe ich fünf Wochen allein, ohne meine Kinder und meinen Mann? In meinem ganzen Leben war ich noch nie so lange am Stück weg. Als Zwölfjährige habe ich von der Schule aus an einem Austauschprogramm teilgenommen. Für 14 Tage bin ich allein nach England gefahren. Eine wildfremde Familie hat mich abgeholt, und in den 14 Tagen habe ich es nicht geschafft, mich auch nur einen einzigen Tag bei dieser Familie wohlzufühlen. Ich wollte nur wieder schnell nach Hause. Ich fand es schrecklich, alles, was ich liebte, war nicht bei mir, ich wusste bis dato nicht, wie sich Heimweh anfühlte. Ab diesem Zeitpunkt war mir bewusst, wie schrecklich Heimweh sein kann. Ich wollte nach Hause und konnte nicht. Dieses Erlebnis hat mich bis heute geprägt. Ich fahre ungern an Orte, die ich nicht kenne, und schon gar nicht allein. Zusätzlich konnte ich aufgrund meines Leistungssports nicht für längere Zeit verreisen. Eine echte Auszeit hat es in meinem ganzen Leben somit noch nie gegeben.
Und die Ängste? Was passiert, wenn nachts die Ängste wieder zuschlagen und ich allein bin? Keine Ahnung. Ich versuche, die Angst zu vertreiben, indem ich mir noch einmal bewusst mache, was meine Therapeutin mir für diese Zeit geraten hat:
»Nutzen Sie die Kur, um sich etwas Gutes zu gönnen. Nur Sie sind wichtig. Schlafen Sie, wenn Sie möchten, essen Sie, was Sie wollen, treiben Sie Sport, wann Sie Lust haben. Diese Zeit gehört nur Ihnen. Es ist völlig normal, dass Sie nach fünf Jahren Kinderversorgung eine Auszeit brauchen. Jede Mutter hätte diese Auszeit verdient. Eine Untersuchung des Bundesfamilienministeriums hat ergeben, dass ein Fünftel aller Mütter, die für die Versorgung ihrer Kinder hauptverantwortlich sind, aufgrund ihrer Gesundheitsstörungen und psychosozialen Belastungssituation Anspruch auf eine Kur hätten. Und nur ein klitzekleiner Teil davon beantragt tatsächlich eine Kur. Was für eine schöne Vorstellung, wenn jede Mama präventiv von der Krankenkasse in den ersten Jahren der Kinder eine Kur genehmigt bekommen würde. Ich denke, dann würde es vielen Frauen und damit auch den Kindern besser gehen. Aber Prävention gehört leider nicht zu den Paradedisziplinen der Krankenkassen. Auch Ihre Auszeit wird gute und schlechte Tage beinhalten, das ist das Leben.«
Okay, ist gespeichert. Trotzdem hoffe ich natürlich auf mehr gute als schlechte Tage. Denn das Annehmen der schlechten Tage ähnelt mir sehr der Erleuchtung. Wenn ich mich depressiv fühle und obendrauf auch noch Angst habe, ist es schier unmöglich zu sagen, ich nehme das an. Geht nicht. Wahrscheinlich erst, wenn ich irgendwann einmal erleuchtet bin – so wie das im Moment aussieht, also frühestens im nächsten Leben.
Die Klinik wirbt mit dem Ziel, die gesunden Ressourcen hinsichtlich der Fähigkeit zu Freude und Glück neu zu entdecken, verborgene Kraftquellen aufzutun und verloren gegangene Visionen und Wege wiederzufinden. Ja, es wäre schön, wenn ich dieses Ziel erreichen würde. Früher war ich eine Macherin. Aktiv und unabhängig, meine Visionen und Ziele klar vor Augen. Jetzt bin ich froh, wenn ich von heute bis morgen meine klitzekleinen gesetzten Ziele erreichen kann. Platz für große Visionen und Ziele ist nicht mehr vorhanden. Wenn man den zahlreichen Artikeln zum Thema Burnout Glauben schenken darf, sind es meistens die »Macher«, die es erwischt, Menschen, die sich in einer guten beruflichen Stellung befinden und eher extrovertiert als introvertiert wahrgenommen werden.
Am Bahnhof nehme ich ein Taxi. Eine sehr nette Taxifahrerin fährt mit mir durch das wirklich schöne Breisgau. Neben Taxifahren scheint es ihr zweiter Job zu sein, den Menschen, die auf dem Weg in die Klinik sind, Mut zu machen. Und das tut unendlich gut.
»Ich sage Ihnen, alle sind am Ende ihres Aufenthaltes traurig, dass es nach Hause geht. Und glücklich, diese Zeit erlebt haben zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen auch so ergehen wird.«
Diese Worte gehen runter wie Öl und sind Balsam für meine Seele. Alles wird gut. Dann stehe ich vor der Klinik und habe butterweiche Knie. Von außen sieht die Klinik genauso aus, wie auf der Homepage beschrieben, eingebettet in einen wunderschönen Garten, der wiederum eingebettet ist in die wunderschöne Natur des Breisgaus.
Unsicher betrete ich die Klinik. Im Foyer, welches mit zahlreichen Leseecken zum Verweilen einlädt, werde ich von einer Mitarbeiterin an der Rezeption ziemlich barsch begrüßt: »Ich habe jetzt Pause. Rechts geht es zum Speisesaal. Dort können Sie Mittag essen. Um 13 Uhr bin ich wieder für Sie da.«
Puh, ein »Schön, dass Sie da sind. Hatten Sie eine angenehme Anreise?« hätte mir den Start erleichtert. Ist nicht der Fall, also Koffer abstellen und rein in den Speisesaal. Hier sieht es eher aus wie in einem Hotel. Und die Menschen im Speisesaal? Ganz sicher nicht zu erkennen, dass man sich in einer Klinik mit psychosomatisch Kranken befindet. Jedes Alter ist vertreten, und niemand sieht auf den ersten Blick krank aus.
Ich merke, dass ich die Blicke auf mich ziehe. Wieder eine Neue. Was die hier wohl hingeführt hat? Mir ist, als könnte ich die Gedanken der Menschen lesen. Es ist eindeutig. Die Leiterin des Speisesaals ist sehr nett, und ich bin mir sicher, dass sie um die Nöte und Sorgen von Neuankömmlingen wie mir weiß. Freundlich begleitet sie mich zu meinem Platz an einem Tisch, an dem bereits eine Frau sitzt. Sie wirkt sehr unsicher und sieht aufgrund der dunklen Schatten unter den Augen sehr erschöpft aus. Sie ist klein, hat dunkle, kurze Haare und ist komplett ungeschminkt. Obwohl sie rein äußerlich sehr mitgenommen wirkt, ist sie mir sympathisch. Und das ist es, was zählt. Wir lächeln uns an und stellen uns vor. Sie heißt Katja und ist ebenfalls heute angekommen. Sie scheint diese große Unsicherheit darüber, was hier in den nächsten Wochen passieren wird, genauso in sich zu tragen wie ich in mir.
Obwohl das Essen köstlich ist, bekomme ich kaum etwas runter. Ich bin zu nervös und warte eigentlich nur darauf, endlich zu sehen, wo und wie ich die nächsten fünf Wochen wohnen werde. Einer der Gründe, warum ich diese Klinik für mich ausgewählt habe, war die Tatsache, dass die Klinik sehr klein und familiär ist und auf ihrer Homepage mit wunderschönen Zimmern geworben hat. Zimmer zum Wohlfühlen mit einer schönen Atmosphäre, in denen man nicht das Gefühl bekommt, krank zu sein. Anders als die zahlreichen riesengroßen Kliniken, in denen man sich wie in einem Krankenhaus fühlt. Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Ich bin in diesen Dingen tatsächlich verwöhnt. Ich brauche es schön um mich herum, um mich wohlzufühlen. Vier Monate habe ich mit der Deutschen Rentenversicherung gekämpft, um meine »Wunschklinik« zu bekommen. In zahlreichen Briefen musste ich argumentieren, warum die von der DRV zugewiesenen Klinikplätze für mich nicht stimmig sind. Die zugeteilten Kliniken waren riesige Krankenhäuser, in denen teilweise auch Suchtpatienten oder Akutpatienten untergebracht waren. Der Schwerpunkt lag meist darauf, über Antidepressiva wieder ins Leben zu finden. Krankenhausatmosphäre pur. Das wollte ich auf keinen Fall.
Nach der Aufnahme durch die resolute Rezeptionistin ist es endlich so weit. Ein Pfleger begleitet mich zu meinem Zimmer. Er öffnet die Tür – und ich bin augenblicklich fassungs- und sprachlos. Es ist schlimmer als in jeder Jugendherberge! Eine Neun-Quadratmeter-Zelle, die auch noch vollgestellt ist mit völlig überalterten Möbeln. Hilfe!
Vom auf der Homepage gepriesenen »wunderschönen Ambiente der Zimmer« kann keine Rede sein. Eine Katastrophe! Das Bett, ein riesengroßer Sessel, ein Schreibtisch, eine Stehlampe, dicke Vorhänge und alles dunkel und verstaubt. Die Tapeten total vergilbt. In diesem Raum ist keinerlei Leben, sondern eine negative Aura, die zum Weglaufen animiert.
Mir ist elend zumute. Ich weine, weil ich hier auf keinen Fall vierzig Nächte schlafen kann, und ich weine, weil ich wieder nach Hause möchte. Sofort! Als ob ich in den letzten Monaten nicht schon genügend Pech hatte. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich brauche immer das Gefühl, mich wohlzufühlen. Sonst kann ich keine Leistung bringen. Das war im Job so und auch beim Handball. Selbst in der zweiten Handballbundesliga habe ich mir die Mannschaften nicht nach der Bezahlung oder der Platzierung ausgesucht, sondern danach, ob ich mich mit den Mädels im Verein gut verstehe, Spaß haben kann und mich wohlfühle. Drunter ging es nicht. Wahrscheinlich hatte ich damals das Talent, es in die erste Bundesliga zu schaffen. Aber dem hohen Druck hätte ich nicht standgehalten.
Was jetzt? Auf keinen Fall zu Hause anrufen. Dann muss ich wieder nur heulen, und alle machen sich Sorgen. Also auf direktem Weg zur Rezeption und um ein neues Zimmer bitten.
»Ich werde in diesem Zimmer nicht wohnen bleiben.«
Die Rezeptionistin zuckt mit den Schultern.
»Tja, da bleibt Ihnen aber nichts anderes übrig. Wir sind ausgebucht.«
»Hören Sie mir überhaupt zu? Ich bleibe nicht in diesem Zimmer und verlange sofort ein neues! Sie werben auf Ihrer Homepage mit Zimmern zum Wohlfühlen und jetzt dieses Zimmer, das nichts aber auch rein gar nichts mit Wohlfühlatmosphäre zu tun hat!«
Ich bin richtig geladen, und diese Zimtzicke, die mir hier die Ankunft schon vermiest hat, ist jetzt die ideale Projektionsfläche für meine Wut.
»Ja, Sie sind noch im alten Trakt. Wir sind gerade dabei, Zimmer für Zimmer zu renovieren. Da haben Sie wohl Pech gehabt«, gibt sie ungerührt zurück.
»Ich bin aber nicht angereist, um Pech zu haben. Ich bin angereist, um gesund zu werden. Vor allem lasse ich meine Familie für fünf Wochen allein, um endlich mal wieder schlafen zu dürfen. Seit fünf Jahren habe ich nicht mehr durchgeschlafen. Und eins meiner Hauptziele hier ist, endlich wieder schlafen zu können. Was in diesem Zimmer definitiv nicht möglich ist. Also geben Sie mir bitte sofort ein neues Zimmer!«, zetere ich. Ich weiß, dass mein Nervenkostüm in den letzten Monaten reichlich Schaden genommen hat und ich schneller als früher auf 180 bin. Aber das hier ist ja wohl wirklich eine Zumutung!
»Ihre Krankheitsgeschichte interessiert mich nicht!«
Das sitzt. Ich schlucke. Hat sie tatsächlich gesagt: »Ihre Krankheitsgeschichte interessiert mich nicht!«? Was für eine Fehlbesetzung an Rezeptionistin.
Ich spüre die Tränen in mir aufsteigen und ziehe unverrichteter Dinge ab. Ich dachte, hier in der Kur würde das viele Weinen endlich weniger. Wahrscheinlich habe ich die letzten Monate so viel geweint wie mein ganzes Leben noch nicht. Es kommt immer wieder aus dem Nichts. Und dann weine ich manchmal, ohne zu wissen, warum. Ich weine und weine. Und da Weinen leider nicht gesellschaftsfähig ist, kann kein Mensch damit umgehen, wenn ich weine. Also versuche ich, nicht zu weinen. Was mir aber nicht gelingt und natürlich auch nicht die Lösung ist. Das ist das Dilemma an den psychischen Krankheiten. Sie sind nicht erklärbar, sie sind nicht messbar und gesellschaftsfähig schon gar nicht. Nun gut, vielleicht sollte ich mir zumindest hier in der Klinik erlauben zu weinen.
Zurück in meinem düsteren Domizil flüchte ich auf den Balkon, von dem aus man zum Glück einen schönen Ausblick ins Grüne hat. Es ist einer dieser typischen goldenen Herbsttage, an denen man glücklich ist, dass der Spätsommer noch mal in die Verlängerung geht.
Etwa zwanzig Meter vor meinem Balkon entfernt steht ein traumhafter großer Kastanienbaum. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Kastanienbaum gesehen mit so vielen großen Kastanien.
Überall auf der Wiese liegen erschöpfte Menschen, welche in der Sonne dösen oder ein Buch genießen. Gut, mein erster Vorsatz ist also, so wenig Zeit wie möglich in diesem Zimmer zu verbringen, solange das Wetter es zulässt. Aber wie soll ich nachts hier schlafen?
Ich spüre in diesem Zimmer die ganze schlechte Energie der verzweifelten Menschen. Jeder, der hier gewesen ist, war auf seine eigene Art verzweifelt. Das ist in diesem Zimmer genau zu spüren. So als ob in dem uralten Mobiliar die gesamte schlechte Energie der letzten Jahre gespeichert ist. Die Atmosphäre dieses Raumes ist kaum auszuhalten. Es fühlt sich beklemmend an. Ich setze mich auf den Balkon und weine. Weine darüber, dass ich hier bin, dass mein Zimmer so schrecklich ist, dass der Start der Kur sich so knallhart gestaltet. Ich habe erwartet, dass die ersten Tage schwierig werden. Aber dass ich mich so aufgelöst fühlen würde, damit hatte ich nicht gerechnet.
Mein Gott, wieso muss ich diesen Weg gehen? »Alles hat seinen Sinn«, sagt meine Mama immer, aber welchen Sinn mein Burnout hat, die heftigen Gefühle, das ständige Auf und Ab, keine Ahnung. Ich hätte darauf in meinem Leben gern verzichtet. Es kostet so viel Energie, das alles auszuhalten. Wie oft würde ich gern einfach aufgeben? Aber tief in mir ist zum Glück doch eine kleine Stimme, die mir zögerlich zuflüstert, dass das Leben lebenswert ist. Und da sind ja auch noch meine Kinder. Jedes Kind hat doch eine glückliche Mutter verdient. Ich möchte meinen Kindern nicht erklären, dass das Leben schwer ist, dass das Leben mich müde macht. Nein, das ist das Allerletzte, was ich meinen Kindern fürs Leben mitgeben möchte. Also kämpfe ich für ein besseres Leben, für mich und für meine Kinder. Und dafür bin ich hier.