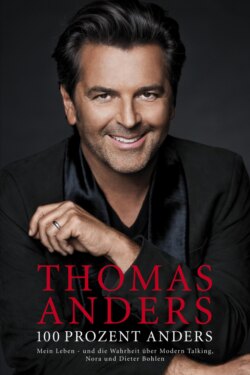Читать книгу 100 Prozent Anders - Tanja Mai - Страница 10
ОглавлениеSchule war für mich ein notwendiges Übel. Ein Schicksal, dem ich nicht entkommen konnte. Hätte es irgendeine Chance gegeben, diese Lebensphase zu überspringen, ich hätte sie sofort genutzt. Dementsprechend war ich nur ein mittelmäßiger Schüler. Es gab Fächer, die ich liebte, wie Deutsch, Geschichte, Erdkunde. Aber Mathe und Physik oder Chemie waren der Albtraum. Ich war viel mehr auf meinen Lifestyle bedacht. Gepflegtes Aussehen, schicke Kleidung und stilvolles Benehmen waren mir schon als Kind unheimlich wichtig. Das ist damals nicht anders als heute gewesen. Auch meine Abneigung gegen öffentliche Verkehrsmittel war bereits als Schüler voll ausgeprägt. Ich brauche Abstand zu fremden Menschen, mag keinen Körperkontakt. Ich kann schlecht ertragen, wie es im Bus oder in der U-Bahn riecht. Grundsätzlich mag ich den Duft von Menschen, die mir am Herzen liegen. Aber wenn sich die Gerüche von fremden Menschen auf engem Raum vermischen, dreht sich mir der Magen um. Wenn der Fahrer dann noch bremsen muss und so ein schwitzender Mensch auf mich drauf fällt, halte ich die Luft an.
Das war auch der Grund, weswegen ich als Schüler an keiner Klassenfahrt teilgenommen habe. Nicht mal bei der Abi-Fahrt war ich dabei. Höchstens mal bei einem Tagesausflug. Ich habe auch noch nie in meinem Leben in einer Jugendherberge geschlafen.
Bis heute bin ich nur ein einziges Mal U-Bahn gefahren. Das war mit Claudia vor 15 Jahren in London. Nach der Landung wollten wir uns in ein Taxi setzen, doch es herrschte totales Verkehrschaos, und wir hätten mindestens zwei, drei Stunden bis in die Innenstadt benötigt. Für Claudia gab es überhaupt keine Diskussion. Sie sagte: „Ich setze mich doch nicht stundenlang in eine Taxe. Wir fahren jetzt mit der U-Bahn. Punkt.“ Wir also mit unseren Koffern rein in die Underground – und ich hätte mich sofort übergeben können in dem schmutzigen, mit Menschen vollgestopften Waggon. Es war absolut nicht meine Welt! Ich nölte während der kompletten Fahrt bis in die City herum und gab Claudia ganz deutlich zu verstehen, dass ich das nie mehr machen würde, selbst ihr zuliebe nicht.
Auch bei meiner Kleidung ließ ich schon als Junge nicht mit mir verhandeln. Mitte der Siebzigerjahre war bei meinen Freunden und mir die C&A-Jeansmarke „Palomino“ total angesagt. Ich wollte gar keine anderen Hosen mehr tragen und kaufte mir ständig Palomino-Jeans in allen erdenklichen Farben. War meine Mutter der Meinung, ich hätte genug anzuziehen und eine neue Hose sei jetzt nicht nötig, kaufte ich mir die Hose eben von meinem eigenen Geld.
Wenn wir auf dem Kurfürstlichen Balduin-Gymnasium eine Freistunde hatten, hingen meine Klassenkameraden am liebsten im Freizeitraum der Schule ab. Dort lümmelten sie auf Matratzen herum und tranken für 20 Pfennige pro Plastikbecher aufgebrühten Pfefferminztee oder lauwarmen Filterkaffee. Mir war das alles nicht fein genug. Ich bevorzugte ein gepflegtes und ruhiges Ambiente. Also ging ich in das beste Café der Stadt und bestellte mir heiße Schokolade mit handgerührter Schlagsahne für 2,80 Mark. Mein Vater konnte das überhaupt nicht verstehen, wenn ich abends am Essenstisch von meinen Erlebnissen erzählte. Sein Spruch lautete stets: „Junge, Junge, wenn du später auch auf so großem Fuß leben willst, dann musst du mal richtig viel Geld verdienen.“
Als ich 13 Jahre alt war, schlug unser Französischlehrer vor, dass wir uns Brieffreunde an unserer Partnerschule in Nevers in Lothringen suchen sollten. Ich fand die Idee prima. Man wurde dadurch nicht dümmer und konnte auf angenehme Art sein Französisch verbessern. Also meldete ich mich freiwillig. Es gab nur 15 Schüler, die mitmachen durften. Als die Adressen der Brieffreundschaften verteilt wurden, war ich der einzige Junge, der ein Mädchen abbekam. Erst dachte ich, mein Lehrer hätte sich verlesen. Hatte er aber nicht. Es war definitiv ein Mädchen. Sie hieß Clothilde und war zwölf Jahre alt. Clothilde hatte sich wohl auch schon gewundert, weshalb ich mich für sie beworben hatte. Meine Mutter meinte nur: „Was ist denn daran so schlimm? Mit dem Mädchen kannst du dir doch auch Briefe schreiben.“ Was ich dann auch tat. Im Jahr darauf plante unsere Schule einen Besuch in Nevers. Ausgemacht war, dass wir acht Tage lang in der Familie unserer Brieffreunde wohnen sollten. Zwei Monate vor der Abfahrt bekam ich einen Brief von Clothilde. Es täte ihr ganz schrecklich leid, aber ihr Vater sei beim Militär und werde versetzt. Deshalb würden sie aus Nevers fortziehen.
Nun war ich also wieder mal der Einzige aus meinem Französischkurs, der plötzlich ohne Gastfamilie dastand. Kurzfristig wurde mir Marc, 13, zugeteilt. Ich schrieb ihm also einen Brief, um mich ihm vorzustellen. Schnell merkte ich, dass Marc und ich komplett verschieden waren – in etwa so, wie es viele Jahre später bei Dieter Bohlen und mir der Fall sein sollte. Marc spielte Fußball, war bei den Pfadfindern und liebte es, im Dreck zu wühlen und ordentlich einen draufzumachen. Er und ich passten überhaupt nicht zusammen.
***
Die Familie von Marc war okay. Sie lebten in einer kleinen Wohnung, und ich hatte ein eigenes Zimmer für mich. Da wir Deutschen nicht mit zur Schule mussten, sondern bis nach dem Mittagessen Zeit mit unserer Familie verbringen sollten, blieb ich morgens bewusst lange im Bett liegen, um den anderen die Chance zu geben, sich in Ruhe in dem kleinen Badezimmer fertig zu machen. Ich stand nie vor neun, halb zehn Uhr auf. Um zehn Uhr kam Marcs Mutter und machte für mich alleine Frühstück, da der Rest der Familie längst unterwegs war. Sie setzte sich zu mir, und wir unterhielten uns ganz wunderbar miteinander. Danach ging sie zur Arbeit. Mittags kam sie zurück und machte Mittagessen. Am letzten Tag erzählt sie mir, dass mein Aufenthalt eigentlich ganz anders geplant gewesen sei. Da sie berufstätig war und schon um sieben Uhr bei der Arbeit sein musste, hatte sie gedacht, dass ich zusammen mit Marc aufstehen und zur Schule gehen würde und wir uns dann mittags zum Essen wieder träfen. Da ich aber so lange schlief, hatte die arme Frau wahnsinnigen Stress und rannte ständig zwischen ihrem Arbeitsplatz und mir hin und her. Mir war das schrecklich peinlich, zumal ich ja gedacht hatte, ich würde der Familie einen Gefallen tun, wenn ich lange schlafen würde. Als ich sie fragte, warum sie mir das nicht gleich gesagt habe, antwortete sie: „Als ich dich sah, war mir sofort klar, dass ich anders mit dir umgehen muss.“
Das Beste an der Reise nach Nevers war der Gebetsstuhl, den ich mit nach Hause schleppte. Marc war bei den Pfadfindern. Sie trafen sich einmal pro Woche in der örtlichen Kirche. Ich begleitete ihn und sah mir die Kirche an. Plötzlich entdeckte ich unter der Treppe eine kleine, alte Gebetsbank. Sie war total verdreckt und voller Spinnweben. Doch sie faszinierte mich. Die Sitzfläche war aus Nussbaumholz geschnitzt, darin Rosenranken und ein Kreuz. Die Füßchen sahen aus wie gedrechselte Säulen. Die Fläche, auf der man kniete, und die Stütze für die Hände waren mit rotem Gobelinstoff bezogen. Ich war wie besessen von dem alten Stück und wollte es unbedingt haben. Der Leiter von Marcs Pfadfindergruppe meinte, das ginge nicht. Aber ich könne, wenn ich wolle, ein kleines Gebetsbüchlein oder ein Bild der Kirche als Andenken mit nach Hause nehmen. Ich wollte aber kein olles Büchlein, ich wollte den Gebetsstuhl. Ich bot ihm Geld. Wir einigten uns auf 20 Mark, dann gehörte der Stuhl mir. Stolz wie Oskar kam ich mit dem guten Stück zurück zu meiner Gastfamilie. Marcs Mutter war schier aus dem Häuschen und wollte mir den Gebetsstuhl unbedingt abkaufen. Aber ich ließ mich nicht überreden. Bevor meine Klassenkameraden und ich mit dem Bus nach Koblenz zurückfuhren, rief ich meine Eltern an und erklärte ihnen: „Bitte räumt den Kofferraum des Autos leer. Ich bringe etwas mit.“
Als sie mich und mein Souvenir am nächsten Tag in Empfang nahmen, schlugen meine Eltern die Hände über dem Kopf zusammen. Meine Mutter sagte nur: „Warum kommt unser Sohn eigentlich immer auf solche Ideen?“ Das gute Stück steht heute noch im Haus meiner Eltern. Wir haben ihn mal schätzen lassen. Er stammt aus dem Jahr 1815 und ist noch mit dem Originalstoff bezogen.
***
1979 musste ich nach den Sommerferien die Schule wechseln, da unser Gymnasium in Münstermaifeld geschlossen wurde und die Oberstufenschüler auf andere Gymnasien verteilt werden sollten. Ich hatte mir das Eichendorff-Gymnasium in Koblenz ausgesucht, denn dort gab es einen Musikleistungskurs. Wie immer war ich ein bisschen spät dran, die Anmeldefrist für das neue Schuljahr war bereits abgelaufen. Mein Vater fuhr also mit mir zum Direktor und schaffte es, mich doch noch einzuschleusen. Kaum hatte ich die Zulassung, bahnte sich jedoch schon die nächste Katastrophe an. Im Verhältnis zu unserem kleinen Gymnasium in Münstermaifeld mit seinen 300 Schülern gingen auf das Eichendorff-Gymnasium 900 Jungen und Mädchen. Jeder beäugte jeden. Mich kannte niemand. Ich war ein Schüler aus der Provinz, mehr nicht. Natürlich freundete ich mich mit Gleichgesinnten an. Mitschüler, die auch Musik als Hauptfach gewählt hatten. Doch von meiner großen Passion für die Musik wusste zunächst niemand etwas. Es war auch in dem Alter nicht gerade besonders hip, deutschen Schlager zu hören oder sogar selbst zu singen. Neu am städtischen Gymnasium, ein Landei und dann noch ein Schlagerheini, das überschritt bei vielen meiner Mitschüler einfach die Toleranzgrenze. Morgens nahm mich mein Vater, der in Koblenz arbeitete, im Auto mit. Am Nachmittag fuhr ich mit dem Zug nach Hause, und meine Mutter holte mich am Bahnhof ab.
In der Oberstufe gab es keine Klassen mehr, sondern jeder Schüler belegte Kurse, drei Hauptfächer und verschiedene Nebenfächer. In den ersten Wochen hatte ich erst einmal genug damit zu tun, mich an der neuen Schule zurechtzufinden. Das neue Kurssystem, die komplett neuen Lehrer. Eine Woche nach Schulbeginn hingen am Schwarzen Brett auf dem Schulhof die Listen für unsere Sportkurse aus. Alle Schüler hatten bei der Anmeldung an der Schule ihre Lieblingssportarten angeben müssen und wurden nun in die jeweiligen Sportkurse eingeteilt.
Doch wo stand mein Name? Okay, wir waren insgesamt über 110 Schüler in der 11. Jahrgangsstufe, da kann man sich schon mal verlesen. Aber auch beim dritten und vierten Durchsehen war kein Bernd Weidung auf der Liste zu entdecken. Was war passiert? Ich ahnte es. Weil ich mich erst sehr spät, im Grunde schon nach Ablauf der Frist, auf dem Eichendorff-Gymnasium angemeldet hatte, legte man mir keine Sportwunschliste vor. Klassischer Fall von „durchs System gerutscht“! Ich dachte mir: Tja, wenn ich nicht auf der Liste stehe, muss ich ja auch nicht zum Sportunterricht. Logisch, oder?
Für mich begann das Wochenende also schon zwei Stunden früher als für den Rest meiner Klasse. Entweder ging ich in mein Lieblingscafé oder zum Einkaufen. Natürlich wusste ich, tief drin in meinem Herzen, dass es nicht richtig war, was ich tat. Aber da es keinem aufzufallen schien, dass ich beim Sportunterricht nicht dabei war, konnte es so schlimm ja nicht sein. Dachte ich. Denn einige Wochen später hatte mich ein Klassenkamerad beim Lehrer verpfiffen. Nach den Herbstferien musste ich bei unserem Sportlehrer, Herrn Harder, antanzen, der mir die Leviten lesen wollte. Nun gut, ich hatte einen Fehler gemacht, aber ich erklärte ihm, dass sein System ja auch Lücken aufweise, sonst hätte er mich spätestens beim Schülerabgleich zu Schuljahresbeginn namentlich erfassen müssen.
Mensch, ich und meine große Klappe! Einfach „Entschuldigung“ zu sagen, das hätte ja auch gereicht. Und nicht noch mehr Öl in die Flamme gießen. Doch es war bereits zu spät. Herr Harder hatte schon eine leicht rötliche Gesichtsfarbe. „Herr Weidung“, kam es gepresst aus Herrn Harders Mund, „ab kommenden Freitag spielen Sie Fußball.“ Fußball? Fußball?? Ich wurde blass um die Nasenspitze und schrie innerlich: „AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!“
Oh Mann, war das Zufall, oder sollte er tatsächlich so viel Menschenkenntnis besitzen, dass er wusste, wie man mich an meiner empfindlichsten Stelle treffen konnte?
Der Freitag nahte, und meine Laune sank auf den Gefrierpunkt. Ich stand auf dem Fußballplatz und sollte dribbeln, Pässe spielen, Dehnübungen und Sprint-Stopps machen. Hallo, ging’s noch? Ich war Sänger. Ich war schon fast 200 Mal auf der Bühne gestanden, sang das Repertoire der weltgrößten Künstler nach und hier, auf diesem piefigen Sportplatz, sollte ich Fußball spielen? Meine Entscheidung stand fest, und zu mir selbst sagte ich: „Sorry, Herr Harder, auch auf die Gefahr hin, dass ihr Blutdruck durch die Decke schießt: Heute habe ich meine letzte Vorstellung auf diesem Fußballplatz gegeben.“
Das Argument, das ich mir bei möglicher Kritik von Lehrerseite an meinem Verhalten in Gedanken schon zurechtgelegt hatte, lief darauf hinaus, dass jeder außer mir die Chance gehabt hatte, seinen Sportkurs frei zu wählen. Nur mir war Fußball aufgezwungen worden. Das konnte nicht sein. Argumentativ fühlte ich mich völlig auf der sicheren Seite. Deshalb hatte ich auch kein schlechtes Gewissen – doch dazu später mehr.