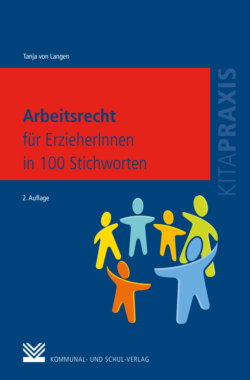Читать книгу Arbeitsrecht für ErzieherInnen in 100 Stichworten - Tanja von Langen - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление18.Beschäftigungsverbot
Fallbeispiel:
Sabine B. ist Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte „Bienenhaus“. Seit einigen Tagen schon beobachtet sie, dass eine der Gruppenleiterinnen regelmäßig an morgendlicher Übelkeit leidet. Sie führt dies auf eine bestehende Schwangerschaft zurück und fragt sich, ob sie die Mitarbeiterin darauf ansprechen soll und darf.
Wann kommt ein Beschäftigungsverbot in Betracht?
Schwangere und stillende Mütter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, sind durch das Gesetz über den Mutterschutz und eine Reihe weiterer nationaler und supranationaler Regelungen vor Gefahren, Überforderung, Gesundheitsschäden und finanziellen Einbußen geschützt. Der AG ist verpflichtet, bei Bekanntwerden der Schwangerschaft eine sofortige Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes durchzuführen. Werden hierbei Gesundheitsgefährdungen für Mutter und Kind festgestellt, sind umgehend verschiedene, dem Gefährdungspotential entsprechende abgestufte Maßnahmen bis hin zum Beschäftigungsverbot zu ergreifen.
Das Mutterschutzgesetz normiert in § 3 MuSchG ein sog. individuelles Beschäftigungsverbot. Danach dürfen Schwangere an ihrem Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigt werden, wenn dadurch das Leben oder die Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet ist. Die Schwangere soll sofort aufhören zu arbeiten, wenn, wie das OVG Koblenz in seiner Entscheidung vom 11. 9. 2003 – Az. 12 A 10856/03 –, NZA-RR 2004 S. 93, ausführt:
„auch nur das kleinste Risiko für sie oder das Kind besteht. Hinsichtlich des Ausmaßes der anzunehmenden Gefährdung muss dabei beachtet werden, dass die Beschäftigungsverbote des Mutterschutzgesetzes Instrumente der Gefahrenabwehr darstellen. Für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts folgt hieraus nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechts der Gefahrenabwehr, dass diese umso größer sein muss, je geringer der möglicherweise eintretende Schaden ist, und dass sie umgekehrt umso kleiner sein darf, je schwerer der etwaige Schaden wiegt (vgl. BVerwGE 62, 36 [39]; BVerwGE 88, 348 [351] = NVwZ-RR 1992, 516). Sofern ein besonders großer Schaden für besonders gewichtige Schutzgüter im Raum steht, reicht für die Bejahung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit bereits die entfernt liegende Möglichkeit eines Schadenseintritts. Die zuletzt genannte Situation ist bei den mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverboten gegeben, da hier die Schutzgüter des Lebens und der Gesundheit von Mutter und Kind und damit Rechtsgüter von sehr hohem Rang im Raum stehen (ebenso BVerwG [27. 5. 1993], NJW 1994, 401).“
Wann liegt denn ein Risiko vor?
Ein Risiko besteht beispielsweise bei
•einer Risikoschwangerschaft,
•der Gefahr einer Frühgeburt,
•einer Mehrlingsschwangerschaft,
•Muttermundschwäche,
•besonderen Rückenschmerzen.
Muss auch eine Gefährdungsbeurteilung stattfinden?
Nach § 1 MuSchRiV ist jeder AG, also jeder Träger einer Kindertageseinrichtung, weiterhin verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Arbeitsplatzes durchzuführen und etwa erforderliche Schutzmaßnahmen für seine Mitarbeiterinnen zu ergreifen. Hierbei muss er die nationalen Regelungen wie die BioStoffV, das ArbSchG sowie das MuSchG beachten, die Beschäftigungsverbote u. a. wegen fehlender Immunität gegen folgende Krankheiten vorsehen:
•Masern,
•Mumps,
•Röteln,
•Windpocken.
Darüber hinaus sind aber selbstverständlich auch supranationale Regelungen wie die Europäische Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArb) vom 15. 4. 1997 vom Träger zu beachten. Diese schreibt vor, dass werdende Mütter Mikroorganismen der Risikogruppe 2–4 nicht ausgesetzt sein dürfen, wenn durch diese oder die dadurch notwendige Behandlung eine Gefährdung für Mutter und/oder Kind besteht. Eine solche Gefährdung besteht immer dann, wenn keine ausreichende Immunität gegen die o. g. Krankheiten und weiterhin gegen
•Ringelröteln und
•Zytomegalie
besteht.
Immer wieder wird in diesem Zusammenhang fälschlicherweise die Biostoffverordnung zitiert, aus der sich die Aufnahme dieser beiden Krankheiten in den Katalog aber gar nicht ergibt. Zutreffende Rechtsgrundlage ist vielmehr die genannte EU-Verordnung.
Weiterhin hat das BVerwG entschieden, dass für ein mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot, mit dem der Gefahr einer Infektion mit Aids- oder Hepatitisviren vorgebeugt werden soll, bereits eine sehr geringe Infektionswahrscheinlichkeit genügt (BVerwG, Urt. vom 27. 5. 1993 – Az. 5 C 42/89 –).
Ab wann muss der Arbeitgeber tätig werden?
Mutterschutz beginnt, sobald dem AG der Eintritt einer Schwangerschaft einer Mitarbeiterin bekannt wird. Für das „Bekannt werden“ ist nicht erforderlich, dass dem AG die Schwangerschaft „offiziell“ mitgeteilt wird. Hat also die Leiterin einer Einrichtung wie im Fallbeispiel nur die Vermutung, eine ihrer Mitarbeiterinnen könnte schwanger sein, ist sie verpflichtet, diese Vermutung mit ihr zu besprechen, um so früh wie möglich Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Sie ist wegen ihrer Nähe zu den Mitarbeiterinnen als Vertreterin des AG – verpflichtet, tätig zu werden, sobald sie die begründete Vermutung einer Schwangerschaft bei einer ihrer Mitarbeiterinnen hat. Im Fallbeispiel hat Sabine B. also die Verpflichtung, ihre Vermutung mit der betroffenen Mitarbeiterin zu besprechen und bei Bestätigung sofort Schutzmaßnahmen einzuleiten.
Was ist jetzt zu tun?
Wird dem Träger eine bestehende Schwangerschaft einer Erzieherin oder Kinderpflegerin bekannt, muss er ein (vorläufiges) Tätigkeitsverbot aussprechen, bis ihm der Immunitätsstatus für die oben angegebenen Krankheiten nachgewiesen wird.
Der Immunitätsstatus für die ersten vier Krankheiten (Masern, Mumps, Röteln, Windpocken) dürfte in der Regel bereits aus der Zeit vor Schwangerschaftseintritt bekannt sein, da gegen diese Krankheiten eine Impfung möglich ist. Gegen Ringelröteln und Zytomegalie hingegen ist eine Impfung nicht möglich, der Immunitätsstatus muss also nach Feststellung einer Schwangerschaft – und dann sofort! – überprüft werden.
Weiterhin ist eine sofortige Beurteilung der Arbeitsbedingungen dieser konkreten Mitarbeiterin durchzuführen. Diese Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes muss sich auf jede Tätigkeit erstrecken, die die Mitarbeiterin durchführt. Art, Ausmaß und Dauer der jeweiligen Tätigkeit sind genau aufzuführen. Mögliche Gefährdungen sind dabei beispielsweise Zwangshaltungen an niedrigen Tischen und Stühlen, Heben und Tragen von Kindern und/oder Möbeln etc.
Ergibt die Gefährdungsbeurteilung das Vorliegen von Gesundheitsgefahren, sind Schutzmaßnahmen in dieser Reihenfolge zu ergreifen:
1.Umgestaltung der Arbeitsbedingungen,
2.Umsetzung oder innerbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel, falls möglich,
3.Beschäftigungsverbot/Freistellung
Nach einem Urteil des BAG kann auch beispielsweise Mobbing ein Grund für ein individuelles Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz sein, wenn psychisch bedingter Stress Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet. Voraussetzung ist, dass der gefährdende Stress gerade durch die Fortdauer der Beschäftigung verursacht oder verstärkt wird (BAG, Urt. vom 21. 3. 2001 – Az. 5 AZR 352/99 –).
Wie ist zu verfahren, wenn die Testergebnisse vorliegen?
Vom Ergebnis des Immunitätsstatus hängt es ab, wie weiter zu verfahren ist. Ist der Test positiv, besteht also Immunität, ist keine Gefahr (durch diese Krankheiten) vorhanden. Besteht keine Immunität, sind nach § 3 MuSchG individuelle Tätigkeitsverbote in Abhängigkeit von den Ergebnissen auszusprechen. Das bedeutet beispielsweise:
•Bei nicht ausreichender Immunität gegen Zytomegalie ist bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ein Beschäftigungsverbot auszusprechen.
•Bei nicht ausreichender Immunität gegen Hepatitis A ist ein Beschäftigungsverbot für Tätigkeiten in Behindertenkindergärten auszusprechen.
•Bei fehlender Immunität gegen eine der anderen aufgeführten Krankheiten ist grundsätzlich ein Beschäftigungsverbot auszusprechen.
Wer zahlt die Untersuchungen?
Bei den Untersuchungen zur Feststellung des Immunitätsstatus handelt es sich nicht um diagnostische oder therapeutische Leistungen. Die Kosten für diese serologischen Untersuchungen und die damit verbundenen ärztlichen Leistungen sind daher vom Träger der Einrichtung zu zahlen. Ebenso die Kosten von allen folgenden Immunitätskontrollen und von Impfungen, auf die der Träger hingewirkt hat. Manchmal übernimmt die jeweilige Krankenversicherung im Einzelfall kulanzhalber die Kosten.
Wer spricht das Beschäftigungsverbot aus?
Das Beschäftigungs-/Tätigkeitsverbot ist vom AG in Ausübung seiner Fürsorgepflicht auszusprechen, nicht vom Arzt, wie häufig fälschlicherweise zu lesen ist. Der Arzt ist in diesem Fall „nur“ für die medizinische Seite der Frage zuständig, also für die Feststellung des Immunitätsstatus, den die Patientin dann ihrem AG vorlegt. Im Sinne eines besonderen „Services“ kann der Arzt darüber hinaus eine ärztliche Stellungnahme abgeben, in der er darauf hinweist, dass Immunität gegen Ringelröteln, Zytomegalie etc. nicht gegeben ist und er aus diesem Grund die Fortsetzung der Tätigkeit nicht befürworten. Verpflichtet dazu ist er jedoch nicht.
Etwas anderes gilt nach einem Urteil des BAG in den Fällen, in denen der AG oder die zuständige Stelle die gebotene fachkundige Überprüfung der Unbedenklichkeit des Arbeitsplatzes einer schwangeren AN nicht vorgenommen hat und aus ärztlicher Sicht ernst zu nehmende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass vom Arbeitsplatz Gefahren für Leben oder Gesundheit von Mutter und Kind ausgehen könnten: Hier darf der Arzt bis zu einer Klärung ausnahmsweise ein sog. „vorläufiges Beschäftigungsverbot“ aussprechen (BAG, Urt. vom 11. 11. 1998 – Az. 5 AZR 49/98 –).
Können die Mitarbeiterinnen gezwungen werden, sich impfen zu lassen?
Nein. Weigert sich eine Mitarbeiterin bereits im Vorfeld einer Schwangerschaft, sich impfen zu lassen, muss ihr der Träger regelmäßige Nachuntersuchungen anbieten.
Was ist mit meinem Urlaubsanspruch?
Mit Urt. vom 9.8.2016 – 9 AZR 575/15 – hat das BAG entschieden, dass § 17 Satz 2 MuSchG den Untergang des Urlaubsanspruchs, der nach Festlegung des Urlaubszeitraums infolge eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbots nicht genommen werden konnte, verhindert. Konkret bedeutet das: Ein bereits genehmigter Urlaub, der aufgrund eines in der Zwischenzeit eingetretenen Beschäftigungsverbots nicht angetreten werden kann, ist der AN wieder gutzuschreiben.
Tipp:Immer wieder wird den Trägern empfohlen, sich bei Neueinstellungen die Immunitätslage als Voraussetzung einer gesundheitlichen Eignung vor Abschluss eines Dienstvertrages nachweisen zu lassen, um das Risiko der Einstellung einer nicht geimpften Mitarbeiterin zu minimieren. Zur Begründung wird ausgeführt, diese Möglichkeit sei in dem bereits zitierten Urteil des OVG Koblenz vom 11. 9. 2003 (s. o.) bestätigt worden.
Indes: Diese Information trifft nicht zu. Das Urteil sagt zur Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens nichts aus. Nach wohl überwiegender Auffassung der Sozialministerien ist es unzulässig, die Zusage zur Einstellung der Bewerberin von einem Immunitätsnachweis abhängig zu machen. Eine derartige Regelung dürfte im Übrigen auch klar gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen (Merkmal: „Geschlecht“). Denn da nur Frauen Kinder bekommen können, unterlägen auch nur sie einer solchen Nachweispflicht.
Verwandte Suchbegriffe:
•EG-Arbeitsrecht
•Elterngeld
•Elternzeit
•Gefährdungsbeurteilung
•Mobbing
•Mutterschutz
•Sonderkündigungsschutz