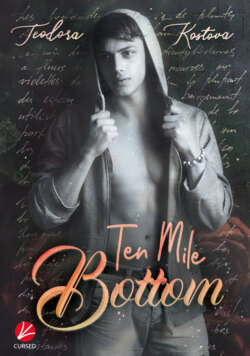Читать книгу Ten Mile Bottom - Teodora Kostova - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеIch verstand die Muster nie, die meine Gedanken für gewöhnlich annahmen. Warum war zum Beispiel das grellgrüne T-Shirt des Barkeepers das Erste, das sich aus der Dunkelheit schälte? War es überhaupt grün? Blau? Ich wusste es nicht wirklich.
Alles war so verdammt dunkel, keine blitzenden Lichter, keine Musik. Keine tanzenden Menschen, die mich herumstießen, während wir uns alle in einem anderen Rhythmus zum selben Takt bewegten.
Ich hörte ein entferntes Piepen, aber falls das ein neuer Hit war, hatte jemand wirklich Mist gebaut, denn er war verdammt langweilig. Piep. Piep. Piep. Das war's. Kein Bass, kein anderes Geräusch. Nur Dunkelheit und dieses verdammte Piepen. Es trieb mich in den Wahnsinn.
Ich versuchte, mich zu bewegen, um Aiden zu finden, damit wir aus diesem lahmen Club verschwinden konnten, aber aus irgendeinem Grund ging es nicht. Ich versuchte, ihn zu rufen, aber meine Kehle war eng und fühlte sich seltsam wund an, als hätte ich bereits eine Weile geschrien. Und da war etwas… Da war etwas in meinem Mund, das in meine Kehle führte.
Ich riss die Augen auf und die Panik überkam mich so plötzlich, dass mir schwindlig wurde. Ich konnte meinen Blick nicht fokussieren. Alles um mich herum war verschwommen und zu hell. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einmal sprechen. Und dieses Ding in meinem Hals, ich wusste nicht, was es war, aber ich wollte es nicht in mir haben. Ich fühlte mich hilflos, als ich versuchte, alles zu verstehen und mich durch den Schmerz und den stechenden Lärm in meinem Kopf zu schieben.
»Finnegan!«
Jemand sagte meinen Namen, aber ich konnte die Person nicht sehen. Ich schlug weiter um mich, versuchte mich aufzurichten, versuchte, mich zu konzentrieren, die Panik abzuschütteln und mich von dem zu befreien, was auch immer mich unten hielt…
»Finnegan, du musst dich beruhigen!«, sagte die Stimme und sie klang seltsam nach meiner Mutter. Nur sie und vollkommen Fremde nannten mich bei meinem vollen Namen.
Warum war sie hier? Und was viel wichtiger war, warum versuchte sie nicht, mir zu helfen?
Ich folgte ihrer Aufforderung und hielt still. Ich schloss die Augen und versuchte, das Ding in meinem Hals zu vergessen, ehe ich sie wieder öffnete und mich auf das nächste Objekt vor mir konzentrierte. Es war eine schmucklose, quadratische Lampe an einer schmucklosen weißen Decke. Als ich langsam den Kopf drehte, sah ich meine Mutter stirnrunzelnd auf einem Stuhl hocken und neben ihr stand eine Maschine mit vielen Lichtern, Monitoren und Kabeln.
Heilige Scheiße, ich war in einem Krankenhaus. Das Ding in meinem Hals war ein Intubationsschlauch. Ich konnte mich nicht frei bewegen, weil meine Hände ans Bett gefesselt waren. Langsam ergab alles einen Sinn, während die Situation in meinem Kopf Formen annahm.
»Finnegan?«, sagte meine Mutter nun mit sanfterer Stimme. Sie legte eine Hand auf das Bettgitter und beugte sich näher zu mir. Ihr Mund öffnete sich, aber sie sagte nichts. Also schloss sie ihn wieder und wandte den Blick ab, doch ich hatte die Enttäuschung in ihren Augen trotzdem gesehen.
Nichts Neues, hm?
In den Augen meiner Mutter lagen immer Enttäuschung oder Ungeduld oder Missbilligung, wenn sie sich mit mir abgeben musste.
Ich wandte den Blick ab und sah wieder zu der quadratischen Lampe an der Decke. Ich konnte mich jetzt nicht mit ihr auseinandersetzen. Es gab Dringenderes. Jemand musste diesen Schlauch aus meinem Hals entfernen, sonst würde ich wieder durchdrehen.
Ich drehte den Kopf wieder zu meiner Mutter und versuchte, mit meinen gefesselten Händen so gut ich konnte auf den Schlauch zu zeigen. Sie schien mich zu verstehen, denn sie nickte, stand auf und ging zur Tür – hoffentlich, um jemanden zu holen.
Ich war so müde. Schmerzhaft müde. Bilder, Geräusche und Farben blitzten in meinen Gedanken auf, unfokussiert, einander jagend und um meine Aufmerksamkeit ringend. Ich wollte, dass alles aufhörte.
Ich wollte Stille.
Ich wollte die Dunkelheit zurück.
***
Mein Körpergefühl und die Schmerzen kratzten wieder am Rand meines Bewusstseins. Ich war nicht besonders scharf darauf. Es hatte sich gut angefühlt, von Dunkelheit und schmerzloser Schwerelosigkeit umfasst zu sein.
Ich musste mich bewegt und meinen Wachzustand verraten haben, denn ich konnte erneut meine Mutter hören, die meinen Namen sagte.
Ich öffnete die Augen. Es dauerte eine Weile, bis ich mich fokussieren konnte, denn das grelle Tageslicht stach.
»Finnegan?«
Hör auf, meinen Namen zu sagen. Hör auf, so zu tun, als würdest du dich sorgen. Geh weg.
Ich wollte die Worte schreien, hatte aber nicht die Energie dafür. Außerdem, selbst wenn ich sie hätte, fühlte sich meine Kehle trocken an und tat höllisch weh.
Zögerlich versuchte ich, gegen den Schmerz zu schlucken. Es tat weh. Zumindest war der verdammte Schlauch weg. Meine Mutter stand noch immer neben dem Bett und ihr Blick glitt über meinen Körper und mein Gesicht, als würde sie nach etwas suchen. Keine Ahnung wonach, aber die Falte zwischen ihren Brauen wurde tiefer, also nahm ich an, dass sie es nicht gefunden hatte.
»Wasser«, krächzte ich kaum hörbar, aber sie hörte mich und hielt mir ein Glas Wasser mit einem Strohhalm an die Lippen.
Ich griff danach und meine Hände waren überraschenderweise frei. Allerdings waren sie nicht wirklich hilfreich, denn sie zitterten heftig, als ich versuchte, das Glas selbst zu halten.
»Ich halte es für dich«, sagte meine Mutter, sodass ich mich wie ein verdammter Invalide fühlte.
Ich trank ein paar Schlucke aus dem Strohhalm und jedes Mal schnitt es wie die stumpfe Seite eines Messers in meine Kehle.
»Danke«, murmelte ich und wandte den Blick ab.
»Wie fühlst du dich?«
Was zur Hölle denkst du denn?
»Gut.«
Immerhin war jetzt der verdammte Schlauch weg und ich riskierte keine weitere Panikattacke.
»Finnegan…«, sagte meine Mutter seufzend und ließ sich auf dem weißen Plastikstuhl neben dem Bett nieder. »Du kannst so nicht weitermachen.«
Ich schloss die Augen und zwang mich, mich zu entspannen und nicht auf ihre Worte zu reagieren. Sie konnte mit dem Vortrag nicht warten, bis ich aus dem Krankenhaus entlassen war?
»Deine Schwester und ich waren krank vor Sorge«, fuhr sie fort, ohne mein Unbehagen zu bemerken. »Dein Verhalten betrifft mehr Menschen als nur dich, Finnegan.« Ich konnte die Tränen in ihrer Stimme hören, aber es war mir egal. »Warum bist du so selbstsüchtig? Dein ganzes Leben lang hab ich versucht, das Beste für dich zu tun und du hast dich bei jedem Schritt gegen mich gewehrt, nur um so zu enden.«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie auf mich deutete, um den erbärmlichen Zustand dieses So zu betonen.
»Geh weg«, sagte ich mühsam.
»Was?«
»Geh. Weg.« Ich drehte den Kopf, um sie anzusehen. Ihre Augen waren gerötet und Tränen strömten ihr über die Wangen. Und trotzdem war dieses enttäuschte Stirnrunzeln, das sie mir immer schenkte, unerschütterlich.
Sie schürzte die Lippen. »Das hab ich nich verdient«, sagte sie und straffte die Schultern. »Ich war immer für dich da und du hast es nie zu schätzen gewusst. Aus irgendeinem Grund bin ich immer die Böse.« Eine Träne rollte über ihre Wange, als sie ihre gut einstudierte Rolle als Opfer spielte.
»Ich will dich nicht hier haben«, sagte ich und jedes Wort fühlte sich an, als würde ich eine Klinge schlucken, aber ich war entschlossen, mir nichts anmerken zu lassen. »Ich will deine Vorträge und deine falsche Sorge nicht…«
»Falsch?«, unterbrach sie mich empört und ihr Mund stand offen. »Wie kannst du so was sagen, Finnegan? Ich bin deine Mutter.«
Ich spürte, wie meine Hände anfingen zu zittern, als ich versuchte, meine aufsteigende Wut im Zaum zu halten. Erneuter Schmerz pulsierte in meinem Kopf. Ich dachte noch einmal über meine Überzeugung nach, dass eine Panikattacke vom Tisch war.
»Verschwinde einfach!«, sagte ich so nachdrücklich ich konnte. Meine Stimme brach beim letzten Wort und ich hasste mich dafür.
»Mum, das reicht«, erklang die ruhige Stimme meiner Schwester von der Tür aus.
Gott. Sei. Dank.
Ich schloss die Augen und mein Körper entspannte sich augenblicklich. Renee konnte sich jetzt um unsere Mutter kümmern.
»Nun, ist das nicht reizend«, sagte Mum und nahm ihre Tasche vom Boden. »Meine eigenen Kinder behandeln mich so, obwohl ich nichts – nichts – getan habe, um das zu verdienen.« Sie drehte sich zu mir und lud noch einmal nach, als sie aufstand. »Du solltest dich nach dem, was du getan hast und was du auf der Beerdigung zu mir gesagt hast, bei mir entschuldigen.« Ihre Stimme zitterte bei den letzten Worten und auf Abruf traten ihr Tränen in die Augen.
Wie immer, wenn sich ihre beiden Kinder gegen sie wandten, verschwand meine Mutter eilig aus dem Zimmer, ohne jemand anderem das letzte Wort zu überlassen. Sobald ihre Schritte nicht mehr zu hören waren, breitete sich eine wahnsinnige Ruhe wie Balsam in meinem Körper und Geist aus und beruhigte all meine Sinne. Meine Kehle schien nicht mehr so sehr zu schmerzen, meine Kopfschmerzen waren beinahe verschwunden und ich konnte mich ein wenig im Bett bewegen, ohne dass ein stechender Schmerz durch meine Glieder fuhr.
Renee setzte sich seufzend auf den Stuhl, den Mutter gerade frei gemacht hatte. Sie versuchte, es zu unterdrücken, aber ich konnte es laut und deutlich hören. Über die Jahre hatte ich es zu oft gehört.
»Na los, sag es schon«, forderte ich sie auf und drehte mich auf die Seite, um sie besser zu sehen. Außerdem tat mir der Rücken davon weh, Gott weiß wie lange in derselben Position gelegen zu haben.
»Wie geht's dir?«
Ich lächelte und bereute es augenblicklich, denn meine trockene Oberlippe spannte sich unangenehm. »Das ist nicht das, was du sagen willst.«
Renee nahm einen kleinen Tiegel mit Lippenbalsam aus ihrer Handtasche und beugte sich vor, um etwas davon auf meine aufgesprungenen Lippen zu schmieren.
»Ich werde noch genug Zeit haben, zu sagen, was ich sagen will, sobald du hier raus bist.«
Der harte Ton in ihrer Stimme schnitt mir ins Herz. Sie hatte seit unserer Kindheit meinetwegen viel ertragen, war aber nie von meiner Seite gewichen. Und trotzdem fühlte es sich jetzt anders an. Als hätte sie endlich die Nase voll.
Ich konnte es ihr nicht verübeln.
Wahrscheinlich hätte ich etwas Dämliches gesagt, wenn der Arzt nicht in diesem Moment hereingekommen wäre.
»Mr. Hart, wie schön, Ihre Augenfarbe zu sehen.« Er lachte leise über seinen eigenen Witz.
Ich hätte besagte Augen verdreht, wenn ich sicher gewesen wäre, dass ich davon keine Kopfschmerzen bekommen hätte, aber in meiner momentanen Lage wollte ich kein Risiko eingehen.
»Ich bin Doktor Bailey. Ich habe Sie operiert und seitdem Ihre Genesung im Auge behalten.«
Er setzte sich auf die andere Seite meines Bettes, warf einen Blick auf die Monitore und schrieb etwas auf sein Klemmbrett, während er seine dunklen, buschigen Augenbrauen zusammenzog.
»Operation?« Gedanklich untersuchte ich meinen Körper nach fehlenden Gliedmaßen oder ungewöhnlichem Schmerz.
Der Arzt warf Renee einen Blick zu. »Ja. Wir mussten einen Teil Ihrer Leber entfernen und die Blutung in Ihrem Magen-Darm-Kanal stoppen.« Er lächelte mich erneut fröhlich an und ich wollte ihm eine verpassen.
Verwirrt sah ich zu Renee. Sie zuckte mit den Schultern und deutete mit dem Kinn auf den Doktor, damit ich aufpasste.
»Die Sache ist so, Mr. Hart«, fuhr der Arzt fort und verschränkte die Finger auf dem Klemmbrett in seinem Schoß. Seine Augen waren blassblau, aber im Gegensatz zu denen meiner Mutter schnitten sie nicht in meine Seele und ließen mich zerstört und leer zurück wie einen kaputten Ballon. »Sie sind in schlechtem Zustand. Obwohl Sie erst vierundzwanzig sind, ist die Leber meiner achtzigjährigen Großmutter in besserem Zustand als Ihre.« Er machte eine dramatische Pause. Ich wollte keinen Blick auf Renee riskieren, also sah ich weiter den Arzt an. »Wenn Sie nicht anfangen, auf sich selbst zu achten, ist die Chance ziemlich groß, dass Sie Ihren dreißigsten Geburtstag nicht erleben werden.«
Es gab kein freches Lächeln, keinen Hinweis darauf, dass er übertrieb.
Mir fehlten die Worte. Das war zu viel auf einmal. Sie hatten einen Teil meiner Leber entfernt? Meine Gesundheit war so schlecht, dass ich bald sterben könnte? Was zur Hölle sollte ich mit all dem anfangen?
»Finn«, sagte Renee und legte sanft ihre Hand auf meine. Ich sah sie an. Warum war sie verschwommen? Haben sich meine Augen entschieden, mich aufzugeben, so wie alle anderen – und alles andere – auch? »Wir schaffen das«, sagte sie und strich mit ihrer Hand etwas von meiner Wange.
Toll. Jetzt heulte ich vor meiner kleinen Schwester und dem verdammten Arzt wie ein Waschlappen.
Als hätte er mein Unbehagen gespürt, räusperte sich der Doktor leise und sagte: »Ich komme in ein paar Stunden für Ihre planmäßige Untersuchung zurück. Dann können wir noch weiterreden, Mr. Hart, und ich werde all Ihre Fragen beantworten.« Er stand auf, warf einen Blick auf den Monitor rechts neben mir und schrieb etwas auf sein Klemmbrett. »Aber ich rate Ihnen, sich auszuruhen, sowohl mental als auch körperlich, bis Sie von der Intensivstation runter sind. Danach können wir alles besprechen.« Er hob einen Mundwinkel zu einem sanften Lächeln, während er eine Hand auf meine Schulter legte.
Er ging, um wahrscheinlich weitere schlechte Neuigkeiten an die Person zu überbringen, die hilflos im nächsten Zimmer lag. Ein überwältigendes Gefühl des Untergangs legte sich über mich und raubte mir auch die letzte Energie. Es fühlte sich an, als würde mich mein Kopf anschreien, aufzuwachen, aufzustehen und etwas zu tun, aber mein Körper war einfach zu erschöpft, um sich darum zu scheren. Man konnte etwas nicht zum Arbeiten zwingen, wenn die meisten Teile kaputt waren, richtig?
Ich spürte Renees Hand auf meiner und das war alles, was ich brauchte, um der über mich hereinbrechenden Erschöpfung nachzugeben und selig die Augen zu schließen.