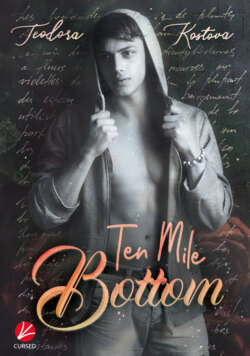Читать книгу Ten Mile Bottom - Teodora Kostova - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеIn der nächsten Woche kam mich meine Mutter jeden Tag besuchen. Sie setzte sich neben mich, fragte mich, wie es mir ging, und erzählte von ihrem Tag, dass die Nachbarn einen Welpen hatten, von der neuen Auswahl an Fusion-Salaten in ihrem Lieblingsrestaurant und dem Wetter. Sie versuchte nicht erneut, mich als selbstsüchtigen Mistkerl zu beschimpfen, aber ich wusste nicht, ob es daran lag, dass Renee sie zurechtgewiesen hatte, oder weil sie Gewissensbisse hatte, da sie ihren Sohn angegriffen hatte, der hilflos auf der Intensivstation lag.
Aber es lag in ihren Augen. Jedes Mal, wenn ich sie ansah, konnte ich es sehen. Die Anschuldigung. Die Enttäuschung. Das Bedauern. Ich versuchte, ihren Blick so oft es ging zu meiden, zwang mich, höflich zu nicken, wenn sie redete und mir jeden Tag zum Abschluss von ihr die Hand tätscheln zu lassen. Und die ganze Zeit über wünschte ich, sie würde sich nicht die Mühe machen, zu kommen.
Die Sache war, dass sie es nicht tat, weil sie sich so um mich sorgte. Sie tat es, weil sie schlecht dastehen würde, wenn sie es nicht täte. Was würden die Krankenhausmitarbeiter denken? Und ihre Freunde? Was würde sie den Nachbarn sagen, wenn sie nach mir fragten?
Sie kam aus Pflichtgefühl. Wenn meine Mutter etwas über alle Maßen hasste, dann, mit einem schlechten Gewissen ins Bett zu gehen.
Renee kündigte sich mit einem leisen Klopfen an, ehe sie hereinkam und sich neben das Bett setzte. Ein paar Strähnen ihrer blonden und mit türkisen Strähnen durchzogenen Haare hatten sich aus dem lockeren Pferdeschwanz gelöst, den sie sich wahrscheinlich in Eile gebunden hatte, aber in ihren blauen Augen lag ein Funkeln, das ich seit einer Weile nicht mehr gesehen hatte. Unsere Gesichtszüge waren sich so ähnlich – breiter Mund und strahlendes Lächeln, rundes Gesicht, kleine Nase und markantes Kinn. Aber während ich die dunklen, dichten, welligen Haare und die fast schwarzen Augen unseres Vaters geerbt hatte, war Renee mit ihren glatten blonden Haaren, den blauen Augen und der blassen Haut, die beinahe durchscheinend war, eine Kopie unserer Mutter.
Doch als ich sie ansah, konnte ich nicht umhin zu denken, dass wir nicht verschiedener hätten sein können. Renee hatte immer eine reine, aufrichtig gute Seele gehabt, von der ich nicht einmal träumen konnte, und sie zeigte sich in ihrem ganzen Verhalten.
»Hast du mit ihnen gesprochen?«, fragte ich hoffnungsvoll. Ich hatte sie gebeten, ihr entwaffnendstes Lächeln zu benutzen, um mich so schnell wie möglich hier raus zu bekommen
»Ja«, sagte sie und schenkte mir dieses entwaffnende Lächeln. Zu schade, dass ich es zu oft gesehen hatte und immun dagegen war. »Doktor Bailey kommt nachher, um dich zu untersuchen und wenn er zufrieden ist, unterschreibt er die Entlassungspapiere und dann kannst du gehen.«
»Gott sei Dank«, murmelte ich und schmiegte mich tiefer in die Kissen. Ich schloss die Augen und stellte mir bereits meine kommende Freiheit vor.
Ich hatte es satt, eine scheinbare Ewigkeit wie ein Invalide behandelt zu werden. Eigentlich war es nur etwas mehr als eine Woche, seit ich von der Intensivstation verlegt worden war, aber ich ging bereits die Wände hoch.
»Hast du Aiden erreicht?«, fragte ich.
Die lange Pause sorgte dafür, dass ich ein Auge öffnete und sie ansah.
»Ja«, sagte sie schließlich.
»Und?«
Sie biss sich auf die Lippen, wandte den Blick ab und kämpfte offensichtlich mit ihrem Instinkt, mir die Wahrheit zu sagen.
»Renee?«
Sie seufzte. »Er wird es dir selbst sagen.«
»Und wann soll das sein?« Ich wurde mit jeder Sekunde genervter. Aiden, mein sogenannter bester Freund, hatte mich noch nicht einmal besucht. Er hatte weder geschrieben noch angerufen oder auch nur einen Raben mit einer verfickten Nachricht geschickt. Seit wir uns in der Schule kennengelernt hatten, waren wir unzertrennlich und trotzdem hatte er keinen Bock, sich nach mir zu erkundigen, wenn ich in einem verfickten Krankenhaus war.
»Nach dem Entzug.«
Super.
Es wäre nicht mein erstes Mal, also wusste ich, was ich zu erwarten hatte, und trotzdem hasste ich die Vorstellung daran, es wieder zu tun. Jeden Morgen geweckt werden, Meditation, biologisch angebautes, unverarbeitetes Essen, über Gefühle sprechen… Keines dieser Dinge sprach mich irgendwie an. Aber leider gab es keinen Weg drum herum.
»Da wir gerade davon sprechen«, sagte Renee und lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Mum und ich haben darüber gesprochen und wir möchten, dass du dieses Mal in eine andere Entzugsklinik gehst.«
Ich funkelte sie wütend an, aber sie ignorierte mich.
»Oh?« Ich legte so viel Gift wie möglich in diese einzelne Silbe.
»Für dich ist das vielleicht ein Witz, Finn, aber für mich nicht«, sagte Renee und richtete ihren stählernen Blick auf mich. Ihre Stimme schwankte nicht, als sie sprach, aber in ihren Augen schimmerten Tränen. »Du gehst den Entzug wie einen Erholungsurlaub an und wenn du wiederkommst, hat sich nichts verändert. Du musst das ernst nehmen.«
»Das tue ich!«
»Tust du nicht! Du hast gehört, was der Arzt gesagt hat! Ich werde meinen Bruder nicht verlieren, weil er zu dumm und zu stur ist, um auf sich aufzupassen!«
Sie stand auf, ihre Brust hob und senkte sich schwer und sie ging zum Fenster. Schweigen breitete sich im Raum aus, während sie nach draußen starrte und ich mich auf die Kissen sinken ließ und sie beobachtete.
Was sollte ich sagen? Sollte ich ein Versprechen machen, das ich ganz sicher nicht halten würde? Ich liebte Renee mehr als irgendjemanden sonst und hasste es, sie so aufgewühlt zu sehen, aber ich konnte ihr nicht versprechen, dass ich nie wieder Alkohol trinken oder Drogen nehmen würde. Scheiße, wenn sie mich nicht regelmäßig mit Schmerzmitteln vollpumpen würden, würde ich mich jetzt nach einer Dröhnung sehnen.
Ich war ein armseliges Exemplar von einem Menschen und wir beide wussten es. Und trotzdem, aus einem bizarren Grund liebte sie mich noch immer.
Als sie sich umdrehte, waren ihre Augen gerötet, aber sie weinte nicht. Sie wedelte hilflos mit den Händen, während sie versuchte, die Worte zu finden, die ich hören musste.
»Du hast auf dem dreckigen Fußboden einer Nachtclub-Toilette eine Überdosis genommen und dein Herz ist auf dem Weg zum Krankenhaus stehen geblieben. Du bist gestorben, Finn«, sagte sie und der Kummer auf ihrem Gesicht ließ mich zusammenzucken.
»Was?«
»Du. Bist. Gestorben«, wiederholte sie und trat ans Bett heran. »Sie haben gesagt, dass du einen Herzstillstand hattest, als die Sanitäter kamen, und sie dich wiederbeleben mussten. Sie haben dich auf dem Weg zum Krankenhaus kaum am Leben halten können.«
Ich war zu geschockt, um etwas zu sagen, und mental und körperlich zu müde, um einen Sinn darin zu erkennen. Glücklicherweise hatte sie Mitleid mit mir und ging nicht weiter ins Detail.
»Bitte, Finn«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Versuch es. Für mich.«
Ich konnte nicht Nein sagen.