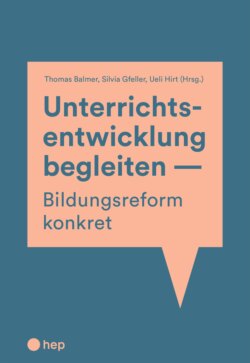Читать книгу Unterrichtsentwicklung begleiten - Bildungsreform konkret (E-Book) - Thomas Balmer - Страница 21
6.4 Doppelte professionelle Kompetenz
ОглавлениеDie Grundausbildung der Lehrpersonen liefert die «Eingangsqualifikation» (Schmidt, 1980) von Novizen und Novizinnen beziehungsweise eine «Starthilfe» (Messner & Reusser, 2000). Sie erwerben grundlegendes Wissen für die Praxis und über die Praxis; das Wissen in der Praxis und über sich selbst wird wesentlich erst durch die Praxis aufgebaut (Day & Sachs, 2004). Die Motive der Lehrpersonen für das Weiterlernen unterscheiden sich aufgrund vielfältiger Erfahrungen von denjenigen von Studierenden. Die vermehrte Erfahrung kann aber auch breitere Widerstandstaktiken gegenüber Veränderungen und Lernen mit sich bringen (Faulstich, 2008). Sie führt auch zu anderen und vor allem durch Erfahrungen gestützte und dadurch legitimierte oder «legitimiertere» Erwartungen an das Lernangebot und die Dozierenden.
Die doppelte professionelle Kompetenz als Lehrperson auf der Zielstufe und als Lehrende in der Weiterbildung ist von zentraler Bedeutung7. Sie unterscheidet sich bei Dozierenden der Weiterbildung konzeptionell zwar nicht grundsätzlich von Lehrenden in der Grundausbildung, verlangt aber angesichts der Spezifika der Weiterbildung unterschiedliche Akzentuierungen. Insbesondere die Kompetenz als Lehrperson auf der Zielstufe dürfte bedeutsamer sein als in der Grundausbildung, damit es gelingt, «Anschauung» (sprich: Erfahrung) zu theoretisieren und Theorie zu veranschaulichen (Neuweg, 2010). Auf Basis der Erfahrung beziehungsweise am konkreten Beispiel aus dem Unterricht Prozesse des Abstrahierens auf die Theorieebene 2 zu moderieren und allenfalls mit neuen Perspektiven zu ergänzen, verlangt wiederum den konkretisierenden Transfer in den Unterricht, der mit entsprechendem fachdidaktischem Wissen und der Erfahrung der Dozierenden auf der Zielstufe seine Glaubhaftigkeit erhöht. Damit kann es zudem gelingen, auch das Bedürfnis der Lehrpersonen nach dem «what works» zu befriedigen. In der Befragung von Starkey et al. (2009) messen Lehrpersonen den meisten vorgelegten Merkmalen von Weiterbildungsdozierenden eine hohe Bedeutung zu. Die Rangreihe bestätigt die hier vertretene Bedeutung doppelter professioneller Kompetenz gepaart mit Moderationsfähigkeiten: Wissen über die pädagogische Theorie, praktische Expertise im entsprechenden Schulfach und Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten werden am bedeutsamsten eingeschätzt.
Die Erfahrung bildet auch heterogene «subjektive Problemhierarchien» heraus (Pant, Vock, Pöhlmann & Köller, 2008, S. 830). Sie aus eigener Erfahrung zu kennen, Bewältigungsstrategien und -methoden selbst erprobt zu haben sowie diese und die Ergebnisse theoretisch einordnen zu können, dürfte mit dazu beitragen, den Lehrpersonen ein effektives Lernangebot machen zu können. Die Erfahrung festigt auch die Überzeugungen zum Lehren und Lernen. Sie in angemessenem Mass irritieren zu können, bestehende Annahmen herauszufordern und neue Möglichkeiten zu eröffnen, die sozialen Normen herauszufordern, wenn sie Unterrichtsentwicklung behindern, und dabei den Fokus aufs Lernen der Schülerinnen und Schüler beizubehalten, verlangt eine hohe fachdidaktische Expertise (Timperley, 2008).
Im Gegensatz zur Grundausbildung, bei der die Perspektive auf die Lernenden diejenige eines «Noch-nicht-Könnens» und von der Sache her eher defizitorientiert ist sowie zudem durch die Qualifikationsfunktion eine zumindest strukturelle «High-stakes»-Machtdifferenz besteht, sollte der Blick auf die Lehrpersonen im Beruf nicht einer Defizithypothese folgen. Der hier verfolgten Perspektive auf die Lehrpersonen liegt die Vorstellung eines adaptiven und dynamischen Systems zugrunde, in dem anscheinend widersprüchliche Ansichten nebeneinander bestehen können und miteinander interagieren (Levin & Nevo, 2009) und trotzdem «gelingende Praxis» hervorgebracht werden kann (Tenorth, 2006). Das Erfahrungswissen der Lehrperson, das der gelingenden Praxis zugrunde liegt, hat seine eigene, individuelle Entstehungsgeschichte und -bedingungen und priorisiert den subjektiven und situativen Anwendungsnutzen. Die forschungs- und wissenschaftsorientierte Expertise der Dozierenden orientiert sich an den Entstehungsbedingungen wissenschaftlichen Wissens mit dem Fokus auf Objektivierung und Verallgemeinerung. Das Annehmen beider Wissensbestände als a priori gleichwertig ist der Ausgangspunkt für den Prozess – sofern eine Weiterentwicklung des Wissens über Unterricht angestrebt wird –, die Wissensbestände einander gegenüberzustellen und Aspekte davon einer gemeinsamen Überprüfung zu unterziehen. Es ist die weiterbildungsdidaktische Aufgabe, diesen Prozess zu gestalten. Subjektives Erfahrungswissen muss mit dem wissenschaftlichen Wissen in Verbindung gebracht werden. Das gemeinsam erarbeitete Verständnis wird auf der Basis von Regeln der Überprüfung oder Erkenntnisgewinnung erarbeitet und seine Überprüfung – dazu gehört auch dessen Transformation in den Unterricht – begleitet. Im Grunde genommen geht es um einen moderierten Prozess, der – erkenntnistheoretisch ausgedrückt – der Frage nachgeht, was wir – Lehrpersonen und Dozierende – über guten Unterricht zu wissen glauben und ob das auch tatsächlich zutrifft. A posteriori kann so neues Erfahrungswissen entstehen, das intersubjektiv überprüft ist. Dozierende der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung sind dann bedeutsam und effektiv, wenn sie in diesem Prozess mit Lehrpersonen iterativ und ko-konstruktiv arbeiten und nicht Best Practice dozieren (McDowall, Cameron, Dingle, Gilmore & MacGibbon, 2007; Timperley, 2008).