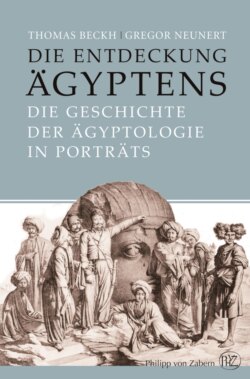Читать книгу Die Entdeckung Ägyptens - Thomas Beckh - Страница 7
PORTRÄT NR. 1: Bernardino Drovetti – Diplomat, Spion und Sammler
ОглавлениеMit den politischen Ereignissen rund um die Napoleonische Expedition kam ein Mann nach Ägypten, der sich als einer der ersten Europäer ausführlicher mit den Relikten der altägyptischen Kultur beschäftigte und diese in Sammlungen zusammenstellte: Bernardino Drovetti. Seine Sammlungen bildeten den Grundstein für einige der wichtigsten ägyptischen Abteilungen europäischer Museen und erregten im 19. Jahrhundert massiv das öffentliche Interesse am pharaonischen Ägypten.
Drovetti wurde am 4. Januar 1776 im Städtchen Barbania in der Nähe von Turin geboren. Als zweites von vier Kindern trat er zu Beginn seiner Ausbildung in die Fußstapfen seines Vaters und studierte Rechtswissenschaften mit dem Ziel, Anwalt zu werden. Mit knapp 19 Jahren beendete er seine Ausbildung an der Universität von Turin mit einem Abschluss in Kirchen- und Zivilrecht. Nur ein Jahr später verpflichtete sich Drovetti bei der „Armee der Republik“ und nahm an den Gefechten der sogenannten italienischen Armee unter Napoleons Befehl teil. Seine militärische Karriere ging gut voran, und er wurde schnell vom Sergeanten zum Leutnant befördert. Man teilte ihn dem Generalstab von Guiseppe La Hoz1 zu, unter dem er an Feldzügen gegen die österreichischen Streitkräfte in Italien teilnahm. Sein erfolgreicher Dienst brachte ihm den Rang eines Captain ein. Kurz darauf wurde Drovetti im März 1799 in die Verwaltung der Republik Piemont berufen, um dort als Kommissar (also als Verwaltungschef) der Stadt Turin zu arbeiten2. Aber lange blieb Drovetti nicht in seiner Heimat. Bereits zwei Monate später befand er sich auf dem Weg ins französische Exil. Anrückende österreichisch-russische Truppen bedrohten Napoleons Reich und nutzten die Abwesenheit des in Ägypten weilenden Feldherrn dazu, die norditalienischen Gebiete zurückzuerobern. Erst als Napoleon heimkehrte und sich durch einen Staatsstreich zum ersten Konsul Frankreichs mit umfassenden Vollmachten beförderte, wendete sich das Blatt wieder. Mithilfe seiner italienischen Regimenter machte sich Napoleon im sogenannten Zweiten Koalitionskrieg an die Rückeroberung der verlorenen Gebiete. An diesen Feldzügen nahm auch Bernardino Drovetti teil; als persönlicher Adjutant von Joachim Murat3 konnte er dabei wertvolle Kontakte für seine Zukunft knüpfen.
Drovettis Zuverlässigkeit brachte ihm schließlich im Jahr 1801 den Posten eines Stabschefs unter General Luigi Colli4 ein, und das im jugendlichen Alter von nur 25 Jahren. In der Folge wechselte er erneut zur Verwaltung der Stadt Turin. Man berief Drovetti auf den gut bezahlten Posten eines Richters. Zum einen brachte er dank seiner ursprünglichen Ausbildung als Anwalt das nötige Wissen mit, zum anderen waren es seine guten militärischen Kontakte, die ihm dieses renommierte Amt einbrachten. Speziell das Gutachten seines Generals Colli dürfte gewissen Einfluss gehabt haben. Colli schrieb: „[Drovetti] ist Rechtsgelehrter, [ein Mann] mit viel Bildung und Talenten, von einer Redlichkeit und Unbestechlichkeit, die über jeden Zweifel erhaben ist.“5
Im Richteramt verblieb Drovetti, bis er im Oktober des Jahres 1802 auf einen neuen Posten versetzt wurde. Und dieser neue Posten sollte ihm einen dauerhaften Platz in der Geschichte der Ägyptologie einbringen: Drovetti wurde Vize-Konsul in Ägypten, mit dem Auftrag, vor Ort die wirtschaftlichen Belange Frankreichs zu vertreten. Diese Stellung hatte er seinen beiden großen Unterstützern, Colli und Murat, zu verdanken. Was sich anfänglich wie eine Beförderung ausnahm, entpuppte sich mit der Zeit als äußerst schwieriger Auftrag. Zwei Umstände machen Drovetti bei dieser Unternehmung zu schaffen. Zum einen sein direkter Vorgesetzter und zum anderen die politische Situation in Ägypten. Diese war alles andere als stabil, und Drovettis Vorgesetzter, der französische Botschafter Matthieu de Lesseps6, hatte große Schwierigkeiten, die akuten Probleme Ägyptens richtig einzuschätzen. Er war den enormen Anstrengungen seiner Position nicht gewachsen und kehrte im Jahr 1804 nach Frankreich zurück. Erst ab diesem Zeitpunkt war Drovetti, wenn auch nicht dem Titel nach, de facto leitender Konsul der französischen Interessen in Ägypten.
Die schwierige politische Lage in Ägypten war eine direkte Folge des napoleonischen Feldzugs. Nach der französischen Niederlage und dem Abzug der britischen Streitkräfte im Frühling des Jahres 1803 kämpften in Ägypten drei Kräfte um die Vorherrschaft: der vom Sultan in Konstantinopel ernannte Vizekönig, die verbliebenen Clans der Mamelukenherrscher und schließlich die albanischen Streitkräfte des Vizekönigs, die nach Ausbleiben ihrer Bezahlung eine eigene Machtfraktion bildeten. Die frühen Jahre des 19. Jahrhunderts in Ägypten kamen einem anarchischen Zustand gleich, geprägt von Schlachten, Aufständen und schnell wechselnden Herrschern, die keines natürlichen Todes starben. Auch für die in Ägypten ansässigen Europäer gestaltete sich das Leben äußerst schwierig. Sie mussten schlicht um Gut, Leib und Leben fürchten. Der ständig von Geldknappheit geplagte Vizekönig nahm häufig Anleihen bei den örtlichen europäischen Kaufleuten und erhob zu alledem Sonderabgaben, die albanischen Streitkräfte drangsalierten die Bevölkerung und schossen auf die ausländischen Botschafter – auch Drovetti und de Lesseps wurden zum Ziel solcher Attacken, blieben allerdings unversehrt – und durch ihre stetig wechselnden politischen Ansichten und Meinungen waren die Mamelukenherrscher so unberechenbar, dass sie keine verlässlichen Partner für die europäischen Mächte im Land darstellen konnten. Umso bemerkenswerter ist es, dass es Drovetti innerhalb kürzester Zeit gelang, ein Informanten-Netz in allen politischen Lagern zu etablieren und so einen äußerst effektiven Nachrichtendienst ins Leben zu rufen. Er freundete sich mit dem Admiral der türkischen Flotte an und konnte den Sekretär des Vizekönigs zur Zusammenarbeit und Informationsweitergabe überreden. Sein Kontakt zu den Mameluken war so gut, dass er vom Anführer der albanischen Streitkräfte Mehmet Ali als Vermittler eingesetzt wurde. Dies zeigt, dass Drovetti bei Weitem nicht nur als Handelsvertreter, sondern auch als Spion für die französischen Interessen tätig war. Als äußerst hinderlich erwies sich in dieser kritischen Phase, dass Frankreichs Aufmerksamkeit vor allem auf das Kriegsgeschehen in Europa ausgerichtet war, und so Instruktionen für die Außenpolitik in Ägypten nur mit langer Verzögerung eintreffen konnten. Oftmals waren die Anweisungen Frankreichs längst von neuen Ereignissen in Ägypten überrollt worden und in Anbetracht der neuen politischen Lage obsolet. Dieser mangelnde Rückhalt Frankreichs gegenüber seinem offiziellen Vertreter Drovetti nutzte besonders den britischen Vertretern, die Ägypten als wichtigen Posten für den Handel mit ihren Kolonien in Indien erkannt hatten und ihren Vorteil aus der instabilen politischen Situation Ägyptens ziehen wollten.
Die Spannungen zwischen England und Frankreich ermöglichten es Drovetti schließlich, seine Situation vor Ort entscheidend zu verbessern. Als einer der Ersten erkannte er das Potenzial des Anführers der albanischen Streitkräfte, Mehmet Ali, der sich durch militärische Gefechte, Anschläge, Bestechung und politisches Taktieren allmählich zum „Pascha von Kairo“ hochgearbeitet hatte. In dieser Position war er für die rivalisierenden türkischen Kräfte unangreifbar, obwohl er nicht vom Sultan als Vizekönig Ägyptens eingesetzt worden war.
1807 beschlossen die Engländer auf Empfehlung ihres Konsuls Ernest Misset7, das ihrer Meinung nach in Ägypten herrschende politische Machtvakuum auszunützen und mit einer militärischen Operation erneut die Macht in Ägypten zu ergreifen. Aber Drovetti gelang es dank seines verlässlichen Nachrichtendienstes, Mehmet Ali über diesen Plan in Kenntnis zu setzten. Noch bevor die Engländer unter General Mackenzie-Fraser8 mit ca. 6600 Mann ihre Invasion starten konnten, hatte der Pascha von Kairo dank Drovettis Einsatz rechtzeitig zusätzliche Truppen nach Alexandria verlegt. Zwar fiel die Stadt relativ bald nach der Landung der Engländer, aber kurz darauf zeigte sich bei dem Angriff auf Rosetta, wie wichtig die frühe Warnung Drovettis war, denn hier erlitten die Engländer zwei empfindliche Niederlagen und stellten daraufhin ihr Unternehmen mit sofortiger Wirkung ein. Auch die Tatsache, dass ein Großteil der Mamelukenherrscher nicht auf britischer Seite in die Kämpfe eingriff, ist der Diplomatie Drovettis zu verdanken. Ironischerweise war es dann wiederum Drovetti, der sich für die rund 470 britischen Gefangenen einsetzte und so nach ihrer Gefangenahme ein Massaker durch die albanischen Truppen verhinderte.
Drovettis Einsatz zugunsten Mehmet Alis legte wohl die Basis für das gute Verhältnis, das der Herrscher Ägyptens und seine Söhne nach ihm zu Drovetti hatten.9 Es gab zwar immer wieder Spannungen zwischen beiden Parteien, doch waren diese wohl eher politischer und weniger persönlicher Natur, eben eine Folge der Machtverschiebungen zwischen den damaligen Großmächten England, Frankreich und Russland und ihrer Politik im harten Kampf um wirtschaftliche Interessen. Nach dem Abschluss eines Friedensvertrages mit England und den Mamelukenherrschern wurde Mehmet Ali schließlich vom türkischen Sultan offiziell zum Vizekönig von Ägypten ernannt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Sultan brauchte militärische Unterstützung gegen die sogenannte Wahabitenbewegung, eine Gruppe religiöser Fanatiker, die auf der arabischen Halbinsel gegen die türkische Oberhoheit rebellierten. Mehmet Ali entsandte seine Unterstützung, woraufhin die Mamelukenherrscher die Abwesenheit der Armee ausnützen wollten, um ihren eigenen politischen Einfluss zu verbessern.
Den drohenden Unruhen begegnete Mehmet Ali in seinem ganz eigenen Stil: Er lud seine politischen Gegner zu einer Feier nach Kairo ein und ließ seine albanischen Truppen das Feuer eröffnen. 500 seiner „Gäste“ wurden erschossen, darunter die Führungsriege der Mameluken. Direkt im Anschluss befahl er, ihre Häuser zu plündern, ihre Güter zu beschlagnahmen und ihre verbliebenen Anhänger zu verfolgen. Damit waren auf einen Schlag die Macht der Mameluken gebrochen10, Mehmet Alis Finanzprobleme gelöst und er selbst unumstrittener Herrscher des Landes am Nil.
Wie unumstritten Mehmet Alis Machtanspruch war, zeigt sich in der Tatsache, dass er sich (entgegen der Weisung des Sultans) unbehelligt von den Engländern mit Waffen versorgen ließ. So konnten die Briten zusehends ihre Handelsinteressen in Ägypten deutlich machen und durchsetzen. Da Drovetti immer noch mehr oder weniger von der französischen Regierung allein gelassen wurde, konnte er gegen diese neuen Handelskontakte Ägyptens nicht vorgehen. Ihm blieb lediglich, Mehmet Ali darauf hinzuweisen, dass durch ein Zerwürfnis mit dem Sultan die Gefahr für eine erneute Invasion der Engländer steigen würde. Mehmet Ali antwortete nur, dass die Briten dann ihre eigenen Kugeln verabreicht bekämen.11 Diese unbekümmerte Haltung des ägyptischen Vizekönigs spiegelte sich auch in der Außenpolitik wieder, in der Mehmet Ali zunehmend die englischen Interessen unterstützte. Frankreich zeigte zunehmend Desinteresse in Bezug auf Ägypten und erkannte die Möglichkeiten nicht, die von einer Kontrolle der Küsten des Roten Meeres ausgingen. Diese distanzierte Haltung frustrierte Drovetti immer mehr, so dass schließlich auch seine Gesundheit darunter litt und er an seinen Rücktritt vom Staatsdienst dachte. Jedoch kamen ihm die politischen Ereignisse zuvor. Nach der verlorenen Völkerschlacht von Leipzig und der Besetzung der Hauptstadt Paris durch die alliierten Streitkräfte musste Napoleon am 12. April 1814 abdanken. Die darauf folgende Wiedereinsetzung der Bourbonendynastie auf dem französischen Thron dürfte von Drovetti, der seine Position indirekt dem Aufstieg Napoleons zu verdanken hatte, sicherlich nicht mit Begeisterung beobachtet worden sein. Die „Herrschaft der 100 Tage“, die Schlacht von Waterloo und die endgültige Verbannung Napoleons nach St. Helena hatten auch für Drovetti direkte Auswirkungen: Im November des Jahres 1815 wurde er von seinem Nachfolger Pierre Thédénat-Duvent auf seinem Posten als Konsul abgelöst. Bernadino Drovetti verließ den Staatsdienst und war nun erst einmal „Privatperson“. Er konnte sich seiner Familie12 und seinen eigenen Interessen widmen. Und genau diese Interessen führen schließlich zu seinem Ruhm in der Ägyptologie. Drovetti war fasziniert von den Relikten der altägyptischen Kultur. Mit der ihm eigenen Effizienz, mit der er als Konsul seine Informationsnetzwerke eingerichtet hatte, begann er nun, seine Kontakte und seinen Einfluss zu nutzen, um ein Netzwerk ins Leben zu rufen, das der Beschaffung von Antiquitäten dienen sollte. Über seine Verbindung zum Hof Mehmet Alis beantragte er einen sogenannten Firman, ein Dokument, das es ihm und Personen in seinem Auftrag erlaubte, Ausgrabungen durchzuführen. Nachdem er diesen erhalten hatte, begann er mit der Rekrutierung seiner „Agenten“, deren Namen teilweise bis heute bekannt sind. Zu den berühmtesten unter ihnen gehörten Frédéric Cailliaud13, ein französischer Mineraloge, der über seine Reisen in den „Orient“ nach Ägypten gelangt war, Jean-Jacques Rifaud14, ein Steinmetz aus Marseille, der später als Schriftsteller tätig war, Guiseppe Rosignani15, ein piemontesischer Abenteurer, und schließlich Antonio Lebolo16, der im Raum Theben besonderen Einfluss genoss. Lebolos Person und Aufgabenbereich wurden von dem Reisenden Carlo Vidua ausführlicher beschrieben:
Er ist der Nachfolger von Ozymandias17 und Sesostris. […] Sein Einflussbereich reicht nicht weit in den Provinzen, in Theben jedoch gehorcht man ihm. Der Scheich und der Kaimakam [Titel des obersten Beamten eines Verwaltungsbezirks, Anm. d. Verf.] befolgen seine Anordnungen; er sucht Mumien; er findet Papyri; oft arbeiten fünfzig, sechzig, ja sogar ein- bis zweihundert Araber unter seinem Kommando. Drovetti hat ihn angestellt, um seine Ausgrabungen und Unternehmungen in Theben zu überwachen.18
Von vielen seiner anderen Agenten sind heute nur noch Namensteile bekannt wie zum Beispiel von einem französischen Mameluken namens „Youssef“ oder dem vor allem im thebanischen Raum berühmten „Piccinini“, von dem berichtet wird, dass er in Theben ein außergewöhnliches Haus besaß, das wie folgt ausgesehen haben soll:
Sein ganzes Haus besteht aus einem einzigen Raum; die Fenster, die Fensterläden, die Stufen und der Boden wurden allesamt aus hölzernen Särgen gefertigt.19
Seine Mitarbeiter platzierte Drovetti, wie aus der Aufgabenbeschreibung Viduas hervorgeht, an speziell von ihm ausgewählten Orten und überließ ihnen die Aufsicht über die Ausgrabungen. Er selbst war nicht kontinuierlich vor Ort und begab sich stattdessen auf Expeditionsreise.
1816 unternahm er, begleitet von Rifaud und Cailliaud, eine Reise zum zweiten Nilkatarakt. Drovetti und seine Gefährten zählen damit neben John Lewis Burckhardt20 und William Bankes21 zu den ersten Europäern, die dieses Gebiet bereisten. Sie besuchten Amada, Wadi es Sebua, Dendur, Kalabsha und natürlich Abu Simbel. Hier bot Drovetti dem ortsansässigen Scheich 300 Piaster, damit dieser für Drovetti den großen Tempel Ramses’ II. freilegte. Als er allerdings später auf seiner Reise nach Abu Simbel zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Tempel noch genauso verschüttet war wie zuvor. Er musste also zumindest in dieser Hinsicht ergebnislos nach Kairo zurückkehren.
In den folgenden Jahren widmete sich Drovetti voll und ganz seinen Ausgrabungen, vor allem in der Region Luxor. Hier zeichneten sich schon bald die nächsten Schwierigkeiten ab, und zwar ausgerechnet mit seinen alten Kontrahenten, den Briten. Denn auch die Engländer hatten inzwischen ein großes Interesse an altägyptischen Altertümern entwickelt. Allen voran ist hier der britische Konsul Henry Salt zu nennen, der im Jahr 1816, einige Zeit nach dem militärischen Debakel von Rosetta, die Stelle des abgesetzten Misset übernahm und damit über die Wahrung der britischen Interessen in Ägypten wachte. Henry Salt (1780–1827) begann seine Karriere als Maler und Zeichner, konnte sich jedoch für den Beruf nicht richtig erwärmen. In der Folge trat er als Sekretär und Zeichner in den Dienst von George Annesley, dem Viscount Valentia und späteren Lord Mountnorris.22 Diesen begleitete er auf einer Reise nach Indien und nach Äthiopien, wo Salt den Auftrag bekam, mit einer kleinen Mannschaft ins Landesinnere vorzustoßen. Dort traf er auf den Ras von Tigray23, der sich von Salt beeindruckt zeigte. Auf diese Weise gelangte Salt zu seinem ersten diplomatischen Auftrag. Der Ras gab ihm Briefe und Geschenke des äthiopischen Kaisers an den englischen König, die Salt, zurück in England, an das Auswärtige Amt übergab. Die Briten hatten Interesse an Äthiopien und beschlossen, den Kontakt zu intensivieren. Da Salt bereits eine erste Kontaktaufnahme gelungen war und er sozusagen freundschaftliche Beziehungen zu einem äthiopischen Provinzverwalter unterhielt, sollte er die Beziehungen vertiefen und wurde 1809 erneut nach Äthiopien geschickt. Auch diese Mission erwies sich als Erfolg, und so konnte Salt nicht nur seine Reiseerinnerungen in einem Buch24 veröffentlichen, sondern es gelang ihm auch, sich im Alter von 35 Jahren durch seine neuen Kontakte den vakant werdenden Posten des britischen Konsuls in Ägypten zu sichern. Salts großes Interesse an den ägyptischen Altertümern wurde ihm später vorgeworfen. Man sagte ihm nach, dass er sich weniger der Politik als vielmehr seiner Sammelleidenschaft, seiner Malerei und seinen philologischen Interessen, allen voran der Entzifferung der Hieroglyphen, gewidmet hätte.25 Dieser Eindruck relativiert sich jedoch, wenn man sich Salts finanzielle Situation vor Augen hält. Sein Posten war unterbezahlt und sein Salär wurde nur äußerst unregelmäßig ausbezahlt. Daher war er gezwungen sich eine zweite Einkommensquelle zu suchen, und diese fand er in den Antiquitäten. Ebenso wie Drovetti hatte sich Salt mit den nötigen Firmanen ausstatten lassen, um Ausgrabungen durchführen zu können. Bei der Absteckung der Ausgrabungsgebiete entbrannte schnell eine erbitterte Feindschaft zwischen Salt und Drovetti.
Salt arbeitete genauso wie Drovetti mit eigenen Agenten, die vor Ort nach Altertümern suchten. Der berühmteste unter Salts Männern, Giovanni Battista Belzoni, wird im folgenden Kapitel ausführlicher beschrieben. Neben Belzoni arbeiteten auch Giovanni d’Athanasi26 und Thomas Triantaphyllos27 für den britischen Konsul. Salts Zeitgenossen zeichnen allerdings ein zwiespältiges Bild seiner Person. Salt soll ein durchaus fähiger Diplomat gewesen sein, der die britischen Interessen am Hofe Mehmet Alis immer wieder erfolgreich zu vertreten wusste. Allerdings litt Salt Zeit seines Lebens unter der Tatsache, dass er sich als Zeichner aus „einfachen Verhältnissen“ hochgearbeitet hatte. Dies erzeugte wohl ein gesteigertes Geltungsbedürfnis, wie es von einem Zeitgenossen in einem Gedicht karikiert wird.28 Und obwohl sich der Entzifferer der Hieroglyphen, Jean François Champollion, lobend über Salts Forschungen äußerte, wurden seine Bemühungen um die Erforschung der ägyptischen Altertümer und der Hieroglyphen häufig als „dilettantisch“ abgetan. Ihnen fehle die letzte Stichhaltigkeit. Die Geschichte, dass er angeblich eine von ihm geschwängerte Sklavin an einen „Muselmanen“ verkauft haben soll, dürfte seinem Ruf auch nicht besonders förderlich gewesen sein.29 Dies soll sich im Jahr 1822 zugetragen haben, ist allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu nehmen. In dieser Zeit war Salt, wenn auch nur kurz, mit einer jungen Italienerin verheiratet, die eigentlich per Brief von einem österreichischen Kaufmann nach Ägypten „bestellt“ worden war, sich aber stattdessen für Salt entschied. Nach nur drei Jahren endete die Ehe tragisch. Seine Frau starb an Kindbettfieber.30
Bis er am 30. Oktober 1827 an einem Leberleiden starb, blieb Henry Salt sowohl in seiner Rolle als Konsul als auch in seiner Rolle als Antikensammler einer der großen Kontrahenten Drovettis. Welche Auswirkungen diese Rivalität zwischen Drovetti und Salt hatte und welche Formen die Antikenbegeisterung der „Touristen“ und Ägyptenreisenden inzwischen angenommen hatte, zeigt eine kurze Schilderung Thebens von Drovettis Mitarbeiter Cailliaud:
Ich habe in Theben zahlreiche Europäer versammelt gefunden, die an interessanten Ausgrabungen arbeiten, von Gurna hin zu den Ruinen von Medinet Habu und denen des Memnoniums [hierbei handelt es sich um das Ramesseum, den Totentempel Ramses’ II., Anm. d.Verf.]; der gesamte Raum, der von den Ruinen Karnaks bedeckt wird, ist durchzogen von „Demarkationslinien“, die das Areal der Franzosen von dem der Engländer trennen […]. Die europäischen Damen durchschreiten die Ruinen und dringen bis in die Katakomben vor, genau wie die anderen Reisenden. Alle sammeln und kaufen sie Antiquitäten […].31
Diese Unternehmungen hatten kaum wissenschaftlichen Anspruch und waren eher noch unsachgemäß durchgeführte und immens teure Schatzsuchen. Wie gefährlich die Arbeit sein konnte, veranschaulicht ein Vorfall im großen Tempel von Karnak, der die Zustände auf Drovettis Grabungen in ein schlechtes Licht rückt. Als die Gräben, die man in die riesigen Haufen von Schutt, Geröll und Sand getrieben hatte, eine Tiefe von zehn Metern erreichten, vergaß der ortsansässige Vorarbeiter, die Seitenwände ausreichend abzustützen. Es kam, wie es kommen musste: 12 Kinder, die zum Abtransport des Grabungsschuttes angeheuert worden waren, wurden untern den einstürzenden Seitenwände begraben, nur sechs von ihnen konnten lebendig geborgen werden. Die Dorfbevölkerung war aufgebracht, und die Situation wurde schwierig für Drovetti.32
Immer wieder unternahm Drovetti Expeditionsreisen, während seine Agenten die Grabungen leiteten. Im Frühjahr 1819 reiste er in die westlich des Niltals gelegene sogenannte Libysche Wüste, um dort die Oasen Charga und Dachla zu besuchen. Er wollte von Assiut aus auf den Spuren Cailliauds, der Charga 1818 bereits besucht hatte, die erste der beiden Oasen erreichen und von dort aus als erster Europäer nach Dachla weiterreisen. Dies war in der damaligen Zeit ein gewagtes Unterfangen, nicht nur weil es eine mehrtägige Durchquerung der Wüste bedeutete, sondern auch weil die Oasenbewohner in der Wüste weitgehend unabhängig von der Herrschaft und den Gesetzten Mehmet Alis lebten. Die Oasen waren schon seit der Antike „freiere Orte“, ein sicherer Hafen für Religionsbewegungen, die in diesen abgelegenen Gegenden nicht verfolgt wurden und deutlich länger nachgewiesen werden können, wie zum Beispiel die Manichäer, eine spätantike Glaubensgemeinschaft, die zeitweise sehr weit verbreitet war. In die Oasen wurden schon in pharaonischer und spätantiker Zeit unliebsame Charaktere verbannt, wie Athanasius, der berühmte Bischof von Alexandria, der es im Laufe seiner Karriere auf immerhin fünf Verbannungen brachte.
Drovettis Unternehmung gelang trotz aller Widrigkeiten. Er erreichte die Oasen, und auf seinem Weg von Charga nach Dachla traf er einen weiteren Europäer, den Schotten Archibald Edmonstone33. Dieser hatte ausgerechnet von Belzoni gehört, was Drovetti vorhatte, und beschloss, selbst in die Oasen aufzubrechen. Als er aber erkannte, dass Drovetti einen Vorsprung von drei Tagen hatte und Dachla vor ihm erreichen würde, faste der Schotte den Plan, den Umweg über die Oase Charga zu vermeiden und direkt nach Dachla aufzubrechen. Er erreichte Dachla vor Drovetti und gilt heute als „Entdecker“ der Oase. Interessanterweise datierte Drovetti seine eigene Reiseerzählung Journal d’un voyage à la valée de Dakel vers la fin de 1818, wie der Titel zeigt, an das Ende des Jahres 1818, obwohl er erst im Frühjahr 1819 aufbrach.34 Zumindest ist er so literarisch der Entdecker der Oase. Seine Reiseerzählung erschien 1821 als Teilbeitrag in einem Buch von Jomard35 und Cailliaud.
Dieser Misserfolg entmutigte Drovetti aber keineswegs. Bereits 1820 begab er sich auf seine nächste Oasenreise. Diesmal zog es ihn auf der Suche nach dem legendären Amun-Tempel Alexanders des Großen nach Siwa. Und auch hier folgte er erneut den Spuren Cailliauds, der die Oase im Winter des Jahres 1819 erreicht hatte und nur mit Glück den unfreundlich gesinnten Bewohnern der Oase „entronnen“ “ war. Da die Oase mit ihrer Lage an der Karawanenstraße nach Libyen von besonderer taktischer Bedeutung für Mehmet Ali war, beschloss dieser, Siwa 1820 zu erobern. Diese Chance nützte Drovetti und erhielt, durch seine nach wie vor guten Beziehungen zum Vizekönig, die Erlaubnis sich dem ägyptischen Expeditionsheer anzuschließen. Nach einer dreistündigen Schlacht und drei weiteren Verhandlungstagen ergaben sich die Herrscher von Siwa dem ägyptischen Heer und die Oase wurde Teil von Mehmet Alis Reich.
In der gesamten Zeit ist es erstaunlich, dass Drovetti, obwohl er nicht mehr französischer Konsul war, weiterhin seinen Einfluss bei Mehmet Ali behielt. Dies brachte ihn in die günstige Position, den nach Kairo kommenden europäischen Reisenden jeglicher Nationalität zu helfen. Er zeigte sich äußerst hilfsbereit und freigiebig, wo er nur konnte. Die berühmteste Unternehmung, der Drovetti in dieser Zeit seine Unterstützung gewährte, war die archäologische Expedition des Freiherrn Heinrich von Minutoli36, der 1820 zusammen mit seiner frisch angetrauten zweiten Ehefrau auf Befehl des preußischen Königs nach Ägypten reiste, um dort ägyptische Altertümer zu erwerben. Drovetti sorgte nicht nur für ein Unterhaltungsprogramm, er verschaffte Minutoli auch eine Audienz bei Mehmet Ali. Bei solcher Unterstützung ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Minutolis am Ende ihrer Expedition schließlich begeistert und mit Antiken beladen heim nach Berlin reisten. Tragisch ist allerdings, dass das Schiff, auf dem der Großteil der Minutolischen Sammlung transportiert wurde, bei einem Sturm in der Elbmündung unterging. Bis heute ist dieser unermessliche Kunstschatz verschollen. Die verblieben 20 Kisten, die Minutoli über den Landweg nach Berlin bringen ließ, bildeten den Grundstock für die Sammlung des dortigen Ägyptischen Museums.
Die Unterstützung seiner Landsleute, aber auch zahlreicher Reisender anderer Nationen, brachten Drovetti viel Lob und Auszeichnungen ein. So ist es auch nicht merkwürdig, dass er als Kenner des Landes und aufgrund seiner Kontakte zum Hof des Vizekönigs im Jahr 1821 erneut zum leitenden Konsul Frankreichs in Ägypten ernannt wurde. Und diese Ernennung erfolgte gerade rechtzeitig, denn es bahnte sich die nächste größere Krise in Ägypten an: Krieg mit Griechenland. Auslöser für diese Krise war der Versuch der Griechen, sich vom türkischen Joch zu befreien und die Besatzer aus dem Land zu werfen. Mehmet Ali, nominell immer noch Untertan des türkischen Sultans, wurde mit in den Krieg hineingezogen. Seine Unterstützung des Sultans stand außer Frage, zumal er sich von diesem weitgehende Machtbefugnisse im Gebiet des heutigen Syrien erhoffte. In dieser politisch prekären Situation zeigte Drovetti erneut sein politisches Geschick. Da für einen Krieg mit Griechenland eine Flotte vonnöten war, vermittelte er zwei hochmoderne französische Fregatten an den ägyptischen König. Das war ein lukratives Geschäft für Frankreich, und Mehmet Ali benötigte dringend solches Kriegsgerät. Auf diese Weise gelang es Drovetti, diesmal in der Rolle des „Waffenhändlers“, erneut seine Bedeutung für den französischen Einfluss in Ägypten und seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen und die Position Frankreichs im Land am Nil zu stärken.
Interessant ist auch, welche Anfragen außerhalb der politischen Arena an Drovetti gerichtet wurden und welche „Probleme“ in seinen Aufgabenbereich fielen. Neben der offiziellen Staatskorrespondenz erreichten ihn auch immer wieder Hilfegesuche bei Rechtsstreitigkeiten und Auftragsschreiben zur Beschaffung von Antiquitäten, Fossilien und zoologischen Raritäten. Belegt sind – vorwiegend an königliche Haushalte – die Lieferung eines Antilopenpärchens, die Lieferung einer Oryx-Antilope, die ihren Bestimmungsort allerdings nur tot erreichte, und schließlich die Sendung einer Giraffe für den Pariser Zoo, auf Befehl Karls X.37
Natürlich kamen auch seine eigenen Ausgrabungen dank seiner vielen Agenten nicht zum Erliegen. So widmete sich sein langjähriger Weggefährte Rifaud im Faijum38 den Pyramiden von Hawara. Doch der Versuch, die Pyramide von Amenemhet III. zu öffnen, scheiterte und auch die noch unstrukturiert erfolgenden Grabungsversuche im umliegenden Gelände erwiesen sich als „fundarm“. Um den bei dieser Grabung entstandenen Verlust zu minimieren, wurden die gefunden Lehmziegel verkauft, die bei den Ausgrabungen angefallen waren. Erst 64 Jahre später gelang es William Matthew Flinders Petrie erfolgreich, das Rätsel um den Eingang der Pyramide zu lösen und mit seinen grandiosen archäologischen Entdeckungen aus dem Umfeld von Hawara die Hallen der Londoner Ausstellunghäuser zu füllen.
1825 unternahm Drovetti Ausgrabungen in Tanis, im Nildelta, was sich als eine seiner erfolgreichsten Kampagnen erwies. Auch hier wurde wieder Rifaud beauftragt, die Arbeiten durchzuführen. Tanis bzw. San el Hagar, wie die arabische Bezeichnung für diesen Ort lautet, ist eine außergewöhnliche archäologische Stätte im nordöstlichen Nildelta. Im Zuge der sogenannten 3. Zwischenzeit, genauer der 21. und 22. Dynastie (10. bis 9. Jh. v. Chr.), verlegten die Herrscher Ägyptens, eine aus Libyen eingewanderte Dynastie aus Militärpotentaten, die Hauptstadt von Piramesse (Qantir) nach Tanis. In der neuen Hauptstadt wurden riesenhafte Tempelanlagen, Kulteinrichtungen und große Mengen an Statuen und Bildwerken errichtet. Um diese Menge an Neubauten bewältigen zu können, diente auch das ganz in der Nähe gelegene Piramesse als „Steinbruch“. Die Herrscher der 21. und 22. Dynastie ließen sich auch in Tanis bestatten. Ihre Gräber wurden im Zuge der archäologischen Arbeiten von Pierre Montet39 in den Jahren 1929 bis 1951 gefunden, die einzigen nahezu ungestörten königlichen Bestattungen des antiken Ägypten, vom Grab des Tutanchamun im Tal der Könige einmal abgesehen. Die Goldmaske Psusennes’ I. und sein aus Silber gefertigter Sarg gehören bis heute zu den schönsten Stücken des Kairoer Museums.40 Tragischerweise blieb die Entdeckung Montets relativ unbeachtet, da sie mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 zusammenfiel. Montet musste aus diesem Grund auch seine Ausgrabungsarbeiten für einige Jahre unterbrechen.
Drovetti hatte Glück. Trotzdem sich Rifaud über mangelnde Verpflegung und ausbleibende Zahlungen seitens Drovettis beschwerte, fand er innerhalb kürzester Zeit eine enorme Menge an übergroßen Statuen aus Rosengranit. Die Statuen brachten zunächst ein Transportproblem mit sich, doch die Schwierigkeiten konnten behoben werden, und so fanden sie ihren Weg nach Alexandria, in die inzwischen legendäre Sammlung Drovettis.
Vor allem vor dem Hintergrund des wachsenden Interesses Europas am griechischen Unabhängigkeitskrieg hatte Drovetti immer mehr auf der politischen Bühne zu tun. Zeitweise arbeitete er auch für Russland als Konsul. Bei all diesen Aufgaben ist es kaum verwunderlich, dass sich Drovettis Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, sein Rücken und ein Augenleiden machten ihm zusehends zu schaffen. Ermattet von den Ereignissen der frühen 20er Jahre des 19. Jahrhunderts auf der politischen Bühne Ägyptens beantragte er seine Rückversetzung nach Europa, die ihm nach seinen 24 Jahren Aufenthalt im Land am Nil auch tatsächlich gewährt wurde. Für seine Verdienste von Mehmet Ali hoch geehrt, verließ Drovetti schließlich am 20. Mai 1827 die Gestade Ägyptens.
Aber lange konnte Drovetti seinen wohlverdienten Ruhestand und die damit verbundenen Ehrungen nicht genießen. Genau sechs Monate nach seiner Abreise hatte sich die militärische Situation im griechischen Krieg dramatisch zugespitzt. England, Frankreich und Russland sahen durch den andauernden Krieg im Südosten Europas ihre Interessen bedroht und versuchten, einen Waffenstillstand zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich zu erzwingen. In der direkten Folge verbot man der osmanischen Flotte, die unter der Leitung von Mehmet Alis Sohn Ibrahim stand, weiter gegen die griechischen Kräfte vorzugehen. Aber die Situation eskalierte dank einer Verkettung unglücklicher Umstände. Es kam zur Seeschlacht von Navarino, in der die vereinten Schiffe Englands, Frankreichs und Russlands die osmanische Flotte nahezu vollständig vernichteten – darunter auch die zuvor von Mehmet Ali gekauften französischen Fregatten. Da Mehmet Ali oberster Feldherr des türkischen Sultans war und ein Großteil seiner eigenen Streitkräfte zerstört worden war, erwartete man, dass sich die Situation für Ausländer in Ägypten und auch die Handelsbeziehungen zu den europäischen Mächten stark verschlechtern würden. In diese angespannte Situation schickte Frankreich ausgerechnet Drovetti, seinen erfahrensten Kenner des Landes, zurück nach Ägypten. Und obwohl kurz nach seiner Ankunft am 6. Januar 1828 griechische Einheiten den Waffenstillstand missachteten und die türkischen Stellungen auf Kreta überfielen, ohne dass die alliierten Kräfte eingriffen, ist es faszinierend, wie schnell Drovettis Diplomatie Früchte trug. Französischen Schiffen wurde der uneingeschränkte Zugang zu ägyptischen Häfen gewährt und es wurde den französischen Kaufleuten umfassender Schutz zugesichert. Mehmet Ali erklärte sich sogar dazu bereit, Informationen aus Konstantinopel an die Alliierten weiterzuleiten, wenn er im Gegenzug über die Verhandlungen der Alliierten mit dem Sultan informiert wurde. Und auch als sämtliche europäischen Interessensvertreter vom Sultan des Landes verwiesen wurden, waren es allein die in Ägypten ansässigen Konsuln, die von diesem Verbot ausgenommen wurden.41 Drovetti wurde sogar zum ständigen Begleiter des Vizekönigs von Ägypten, wenn dieser auf Reisen ging.
In diese zweite Amtszeit Drovettis fiel auch ein bedeutendes ägyptologisches Unternehmen: die sogenannte französisch-toskanische Expedition. Bereits 1826 nahm Ippolito Rossellini42 Kontakt zu Drovetti auf und erkundigte sich nach Möglichkeiten, eine Expedition in Ägypten durchzuführen. Bis es jedoch soweit war und die Expedition tatsächlich stattfinden konnte, vergingen zwei weitere Jahre. Dann betraten Rossellini und Champollion als Expeditionsleiter ägyptischen Boden. Sie mussten aber feststellen, dass sie für ihre Reise durch das Land und ihre Ausgrabungen spezielle Erlaubnisbescheinigungen brauchten. Zu diesen verhalf ihnen niemand anderes als Drovetti, der die beiden Forschungsreisenden dem Vizekönig vorstellte und seine eigene Grabungserlaubnis auf Champollion übertragen ließ. Trotz dieser Unterstützung blieb der Dank der beiden Reisenden gegenüber Drovetti aus, was wohl in Champollions schwierigem Charakter begründet lag: Er war fast krankhaft misstrauisch und besaß ein ziemlich übersteigertes Selbstverständnis. Als Folge der langen Verzögerungen entwickelte Champollion ausgerechnet gegenüber Drovetti, der ihm durch seine Beziehungen zum Hof die Reise erst ermöglicht hatte, eine starke Abneigung.
Die Expedition reiste den Nil hinauf bis an die sudanesische Grenze, doch noch bevor sie im Dezember des Jahres 1829 erfolgreich nach Europa zurückgekehrt war, ging es mit Drovettis Gesundheit massiv bergab. Ihm machten nun nicht mehr nur seine alten Leiden zu schaffen, sondern er erkrankte auch an Dengue-Fieber und einer chronischen Magen-Darm-Infektion. Sein Zustand verschlechterte sich schließlich so stark, dass seine Ärzte ihm rieten, dringend nach Europa zurückzukehren, da er sonst das kommende Jahr nicht überleben würde. Am 20. Juni 1829 verließ Drovetti dann zum zweiten Mal das Land am Nil, und diesmal kehrte er nicht wieder zurück. Die Jahre bis zu seinem Tod am 11. März 1852 reiste Drovetti nurmehr durch Europa, besuchte alte Freunde und war gerade in den Sommermonaten viel auf Kur. Sein diplomatischer Rat blieb weiterhin hoch geschätzt und er wurde unter anderem bei der berühmten Algerienkrise konsultiert.43 Mit zunehmendem Alter zog er sich aber in seine Geburtsstadt Barbania am Fuß der italienischen Alpen zurück. Seinem alten Weggefährten Mehmet Ali begegnete er ein letztes Mal in Neapel, als dieser zusammen mit seinem Sohn Ibrahim 1848 Italien besuchte.
Drovettis Rolle war sicherlich in erster Linie die eines Diplomaten und erst in zweiter Linie die eines „Archäologen“. Nichtsdestotrotz hinterließ er mit seinen drei Sammlungen an altägyptischen Antiken, die er von seinen Agenten zusammentragen ließ, die Grundlage für drei der bedeutendsten ägyptischen Museen Europas. Seine erste Sammlung, für deren Zusammenstellung er angeblich 15 Jahre brauchte, verkaufte er 1820 ins Piemont. Sie war der Grundstock für die heutige ägyptische Abteilung des Turiner Museums. Seine zweite Sammlung fand erste Erwähnung in Berichten aus den Jahren 1822 und 1824. Drei Jahre später wurde sie für 150.000 Francs an Frankreich verkauft. Sie befindet sich bis heute im Louvre. Und die dritte Sammlung wurde schließlich 1830, auf das Anraten von Richard Lepsius44 hin, vom preußischen König für 30.000 Francs erworben und dem Berliner Museum vermacht. In zahlreichen weiteren europäischen Museen befinden sich Stücke, die von Drovetti zumeist als Geschenk an die jeweiligen Institutionen gegeben wurden. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass der Mann, der angeblich die „graue Eminenz“ hinter dem ägyptischen Vizekönig Mehmet Ali war, der „jede Maßnahme des Vizekönigs plante“ und diesem auf seinen Thron verhalf,45 ausgerechnet als einer der Gründerväter der Ägyptologie im Gedächtnis der Wissenschaft verhaftet ist.