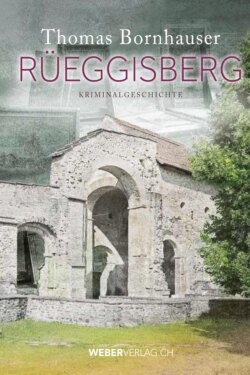Читать книгу Rüeggisberg - Thomas Bornhauser - Страница 11
ОглавлениеTschernobyl, 26. April 1986
Bevor er auf die Ereignisse rund um den GAU in der Ukraine zu sprechen kam, räumte Herrlich gleich mit einer Verwechslung auf. Dass man von Tschernobyl spreche, hänge mit der Geschichte zusammen, korrekt wäre es nämlich, in Zusammenhang mit der atomaren Katastrophe Prypjat zu erwähnen. In der Tat: Als man in den sechziger Jahren mit dem Bau der Atomanlage ungefähr 120 Kilometer von Kiew entfernt begann, gab es in der Nähe nur das kleine Städtchen Tschernobyl, das im späten zwölften Jahrhundert gegründet worden war, deshalb der Name, gleichbedeutend mit der atomaren Katastrophe. Parallel zu den Atomkraftwerken auf der grünen Wiese begann man nämlich mit dem Bau der Retortenstadt Prypjat, nur knapp drei Kilometer von den AKW entfernt. Die Stadt sollte später Platz für über 50‘000 Menschen bieten, die Energieanlage insgesamt zwölf Reaktoren aufweisen. Damit wäre die Gesamtanlage Чернобыльская АЭС им. В.И. Ленина, die Tschernobyler Lenin-Kraftwerke, die grösste ihrer Art weltweit gewesen. Es ist denn auch Prypjat, das sich seither als Geisterstadt präsentiert, ohne Lebewesen.
«Wie müssen wir uns dieses Prypjat denn vorstellen, Herr Herrlich?», wunderte sich Prisca Antoniazzi, worauf der 56-Jährige kurz überlegen musste. Er fand aber einen für alle Frauen nachvollziehbaren Vergleich.
«Frau Antoniazzi, ich war schon in Bern, dreimal, genauer gesagt, unter anderem bei Kollega Ritter, und liebe die Toblerone. Die Fabrik hinter ihrer silbernen Hülle habe ich leider nur von aussen sehen können, aber die 400-Gramm-Version der dreieckigen Schokolade im Einkaufscenter Westside nebenan gekauft. Stellen Sie sich nun die vielen Hochhäuser im Westen von Bern vor und multiplizieren diese mit zehn. Samt Läden zum Einkaufen, Stadtverwaltung, Kinos, Fussballstadion, Vergnügungspark, Spital, Polizei- und Feuerwehrkasernen, Kongresshotel, um nur einige Beispiele zu nennen.»
«Und diese Häuser stehen jetzt alle leer?», stellte Luzia Cadei eine Anschlussfrage.
«Nicht nur die Häuser, Frau Cadei, es handelt sich um eine totale Geisterstadt, ohne jegliches Leben. Nicht einmal Hunde oder Katzen gibt es.» «Und weshalb das?»
«Die Haustiere wurden damals alle getötet, weil sie in ihrem Fell möglicherweise kontaminiert wurden. Es gibt heute einzig wilde Tiere – Füchse, Rehe, Hirsche –, die in der Umgebung zu sehen sind.»
Schweigen in der Runde. Nach einigen Sekunden meldete sich HH wieder zu Wort.
Für die Nacht des Freitags, 25. auf den 26. April 1986, war lediglich eine Sicherheitsübung geplant, in deren Verlauf ein vollständiger Stromausfall in Reaktorblock 4 simuliert werden sollte. Eigentlicher Grund dafür: ein längst vorgesehenes Herunterfahren der Anlage im Hinblick auf Routineunterhaltsarbeiten. Im Rahmen des Experiments sollte gezeigt werden, dass selbst nach einer Reaktorabschaltung aufgrund von Stromausfall die noch vorhandene Rotationsenergie der auslaufenden Turbinen ausreicht, um die Zeit bis zum vollen Anlaufen der Notstromaggregate zu überbrücken. Was aber passierte, erinnert zwingend an den bekannten Zauberlehrling mit seinen Besen.
Den entscheidenden Konstruktionsfehler der Anlage konnten die Ingenieure im Verlaufe des Abends nicht kennen: Dass die gelieferten Angaben bei geringer Leistung extrem unzuverlässig waren, sodass plötzlich von überall her Alarmsignale aufheulten, was zu einem Chaos im Kontrollraum mit einer Kettenreaktion von menschlichen Fehlmanipulationen führte. Von diesem Moment an war die bevorstehende Katastrophe nicht mehr aufzuhalten, der Reaktor RBNK-1000 nicht mehr zu beherrschen. Es floss – aufgrund der Fehlüberlegungen – viel zu wenig Wasser in das System, der Druck im Kern stieg unaufhaltsam an, was die Ingenieure veranlasste, die sofortige Notabschaltung des Reaktors einzuleiten.
Eine Notabschaltung führt in der Regel dazu, dass sämtliche Kontrollstäbe gleichzeitig in den Reaktorkern eingefahren werden. Da die Steuerstäbe im Reaktorblock 4 aus Grafit bestanden, wurde die Kettenreaktion statt gebremst sogar noch gefördert, der Leistungsanstieg betrug innert weniger Minuten mehr als das Hundertfache. Durch die enorme Hitze von über 3000 Grad und den unglaublichen Druck kam es zu zwei Explosionen, die dazu führten, dass das Dach des Reaktors weggesprengt wurde. Durch das jetzt offene Dach gelangte Luft in den Reaktor und das heisse Grafit geriet in Brand. Resultat: Ein noch nie erlebter oder simulierter GAU in einem Atomkraftwerk.
Dieser Spielpark in Prypjat hätte am 1. Mai 1986 eröffnet werden sollen. Es kam nie dazu.
«Was passierte nach dieser Explosion?», fragte Ruth Bär nach.
«Frau Bär, sowohl die AKW als auch die Stadt waren Vorzeigeobjekte der damaligen UdSSR, die Behörden der Region stolz darauf. Um den Ruf ihrer beiden Juwelen nicht zu schädigen, hielten sie sich mit Informationen 36 Stunden zurück, die Bevölkerung wurde im Ungewissen gelassen, Moskau schon gar nicht orientiert. Höhepunkt dieser Desinformationskampagne: Der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, erfuhr vom GAU erst drei Tage nach dem Unfall – und das erst noch von schwedischen Ingenieuren, die, in einem eigenen Atomkraftwerk arbeitend, eine ungewohnte atmosphärische Veränderung über Europa festgestellt hatten.»
Als man endlich das Ausmass der Katastrophe realisiert hatte, war es für viele Menschen zu spät, die ersten Helfer am Unfallort – mit völlig unzureichender Schutzkleidung – bereits Stunden später tot. Niemand war auf diesen GAU vorbereitet, entsprechend mangelte es an allem, nicht einmal für die Kinder waren genügend Jodtabletten vorhanden, die Feuerwehr und Polizei unterdotiert, Schwangeren befahl man umgehend eine Abtreibung. Erstaunlicherweise kam es zu keiner Massenpanik, weil die Behörden immer wieder beteuerten, die Sache vollständig unter Kontrolle zu haben. Sie sprachen denn auch nur von einem «Störfall», der sich erst noch mitten in der Nacht ereignet hatte und somit praktisch von niemandem wahrgenommen wurde.
«Was man sich unbedingt in Erinnerung rufen muss», erklärte Herrlich, «ist der Umstand, dass die Rettungskräfte seinerzeit einfach abkommandiert wurden, sie Befehle auszuführen hatten. Es gab keine Befragungen, wer sich denn freiwillig melden würde. Tausende von Arbeitern und Armeeangehörigen wurden in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe zu Tätigkeiten am und im Reaktor gezwungen, die den sicheren Tod bedeuteten, auch Jahre später. Widerstand zwecklos.»
Am Nachmittag des 27. April, 36 Stunden nach der Explosion, musste es plötzlich schnell gehen, sehr schnell. Mit über 1000 Bussen wurden die 45 000 Bewohnerinnen und Bewohner aus Prypjat innerhalb weniger Stunden evakuiert und in die Region von Kiew gefahren. Überall, wo gerade Betten zur Verfügung standen, brachte man sie unter: in Turnhallen, Altersheimen, Spitälern. Um eine Massenpanik zu verhindern, versprach man ihnen, dass sie in drei Tagen nach Prypjat zurückkehren könnten und somit nur das Notwendigste mitzunehmen hatten. Tiere mitzunehmen war nicht erlaubt, aus den bereits erwähnten Gründen. Aber: Die Menschen aus Prypjat sollten ihre Wohnungen und Tiere nie mehr sehen. Ähnlich erging es den Bewohnenden unzähliger Dörfer in der Region, die Menschen wurden zwangsumgesiedelt, viele ihrer Wohnorte zerstört und die Häuser vergraben, weil kontaminiert.
«Holger, ich habe gelesen, dass die Häuser in Prypjat leer und zerstört sind. Wie denn das?»
«J. R., das ist korrekt. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde gestohlen, die Stadt im grossen Stil geplündert. Das alles passierte vor allem in den Jahren 1990 und 1991, als die Sowjetunion zerbrach, sich auch aus der Ukraine zurückziehen musste und die örtlichen Behörden mit der Situation völlig überfordert waren. »
«Was ist mit dem Diebesgut passiert?»
«Praktisch ausnahmslos wurde es auf dem Schwarzmarkt verkauft: Möbel, Velos, Motorräder, Autos – wobei viele Fahrzeuge gar nicht mehr funktionierten, weil von der Radioaktivität fahruntüchtig gestrahlt. Speziell Elektronik wurde gut verkauft, zum Teil aus der Kommandozentrale einer riesigen Radarstation ausgebaut und gestohlen.»
«Stimmt, ich habe einen Bericht darüber gelesen. Streng geheim, hiess DUGA Radar.»
«J. R., brillant», sagte HH zum Erstaunen aller, er, der mit Komplimenten normalerweise hinter dem Berg hielt. «Er war 800 Meter lang, bis zu 150 Meter hoch, riesig, und ist noch heute aus grosser Distanz zu sehen.»
Was weder Plünderer noch Käufer, die sich ein vermeintliches Schnäppchen gesichert hatten, wussten: Praktisch ausnahmslos wiesen die gestohlenen Güter eine starke radioaktive Strahlung auf.
«Holger, wie kann aber eine Stadt unbewohnbar bleiben, du aber konntest sie besuchen? Da geht für mich etwas nicht auf …», argumentierte Ritter.
Es war in der Tat eine gute Bemerkung, die HH jedoch leicht zu kontern wusste: Der 2017 über die Havarie gestülpte Sarkophag verhindert zwar das Austreten von Radioaktivität in die Luft. Die Böden aber bleiben auf ewig mit Plutonium 239, Cäsium 137 und Strontium 90 belastet, ganz zu schweigen von den 190 Tonnen mit schwerst radioaktivem Material im Inneren des Sarkophags, die nicht entsorgt werden können und in Zukunft weitere schwere Umweltschäden anrichten werden. Diese Schwermetalle sinken im Laufe der Zeit immer tiefer ins Erdreich. Zwar hat man mit dem Errichten des Sarkophags – der mit seiner silbernen Aussenhülle und mit viel Fantasie an die silberne Toblerone-Produktionsstätte in Bern erinnert – in seinem Innern auch eine ferngesteuerte Art von Entsorgungsanlage gebaut, welche die vorhandenen 190 Tonnen Material umlagern und neu in Särge umverteilen soll – aber wohin damit?
Besucher dürfen deshalb die vorgeschriebenen Pfade nicht verlassen, dürfen nichts vom Boden aufheben, die benutzten Schuhe wirft man nach dem Besuch am besten gleich weg. Der Besuch des Geländes ist einzig mit örtlichen «Reiseleitern» ab Kiew möglich, es gibt bis nach Prypjat drei scharfe militärische Kontrollen.
«Ich selber bin kein Gegner von Atomenergie, denke auch, dass die Kernkraftwerke in Deutschland und auch in der Schweiz auf einem technisch anderen Niveau als die alten UdSSR-Reaktoren sind, dennoch hat mich der Besuch betroffen gemacht. Erinnern wir uns: Es war menschliches Versagen, das zur Katastrophe geführt hat. Wäre das theoretisch nicht auch bei uns in Westeuropa möglich? Nicht alle AKW sind über jeden Zweifel erhaben …», sagte HH, ohne jedoch seinen französischen Kollegen anzuschauen.
«Das möchten wir uns nicht vorstellen», sagte Ruth Gnädinger, «im 30-Kilometer-Radius von Mühleberg liegen zum Beispiel Fribourg, Bern und Thun, um nur diese zu nennen.»
«Stimmt, und diese müssten von einem Tag auf den anderen aufgegeben werden. Dieses Chaos wäre beispiellos.»
«Verkehrszusammenbruch, Plünderungen, Aggressionen mit vielen Toten.»
«Frau Gnädinger, denken wir die Sache lieber nicht zu Ende. Was verblüffend ist: Überall in Prypjat hat sich die Natur zurückgemeldet, durch Beton und Asphalt hindurch. Zum Teil sieht man gewisse Gebäude gar nicht mehr, weil sie inzwischen hinter hohen Bäumen versteckt sind.»
«Also wie in Franz Hohlers Die Rückeroberung.»
Denkmal für jene Männer, die zuerst an die Arbeit mussten, die sogenannten «Liquidatoren» …
Holger Herrlich reichte während seines Vortrags zum besseren Verständnis Fotos vom Sarkophag und von Prypjat auf seinem Handy herum. Nach diesen Ausführungen nahm Joseph Ritter den Faden wieder auf, um den Kreis zu schliessen, direkt in Richtung Victorija Rudenko, wollte von den Damen nochmals – und mit Nachdruck – wissen, ob es nicht zuletzt wegen Nazar Klitschko «atmosphärische Störungen» zwischen Inhaberin und Geschäftsleiterin der Zürcher Niederlassung gebe, was wiederum verneint wurde, womit sich der Berner Kriminalist aber nicht zufrieden gab, nicht zufriedengeben konnte.
«Frau Bär, jetzt erleben Sie live, wie hartnäckig Ermittler sein können. Erinnern Sie sich noch, aus welchen Gründen und unter welchen Umständen Frau Rudenko eingestellt wurde?»
«Fiona, also Frau Decorvet, ist diese Verpflichtung nicht eingegangen, ohne vorher Erkundigungen über Frau Rudenko einzuziehen, die Auskünfte waren hervorragend, weshalb die Frau nach einer sechsmonatigen Probefrist fest angestellt wurde. Zur vollen Zufriedenheit von Fiona», worauf Ruth Gnädinger und Luzia Cadei beide mit einem «Ja, das stimmt» die Worte ihrer Freundin bestätigten.
«Moment mal, meine Damen … Da verabschiedet sich also ein Ehemann in Richtung einer Angestellten seiner Ehefrau und dennoch ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Ich bitte Sie …»
«Also, es ist so, Herr Ritter …», erwiderte Prisca Antoniazzi zögerlich.
«Jetzt bin ich aber gespannt, Frau Antoniazzi, wie ist es denn so?», worauf sogar die Schauspielerin leicht errötete, als stünde eine Beichte grösseren Ausmasses bevor.
«Nun, wie soll ich es sagen?»
«Am besten, wie es halt so ist», insistierte Ritter.
«Fiona hat zu Männern eine eher ungewöhnliche Beziehung. Ihre erste Ehe war ein Aufbegehren ihren Eltern gegenüber, jene mit Nazar Klitschko als gutaussehendem Diplomat auf der Botschaft der Ukraine in Bern als eine Türöffnung in Richtung Haute Volée zu sehen. Ich denke nicht, dass gross Liebe im Spiel war, deshalb schliesslich auch das Laisser-faire mit Victorija Rudenko.»
Nach dieser Bemerkung geschah Erstaunliches, denn plötzlich begannen die vier Damen über das Liebesleben von Fiona Decorvet zu reden, zögerlich zwar nur, sozusagen hinter vorgehaltener Hand, aber Ritter erfuhr dennoch das eine oder andere, das als Puzzleteil bei allfälligen Ermittlungen von Nutzen sein konnte. Dass die Vermisste momentan zumindest in einer «vorübergehenden Beziehung» stand, so Prisca Antoniazzi, schien ausser Frage zu stehen. Begründet wurde diese Aussage mit der Feststellung, dass man sich mit Fiona Decorvet in den letzten Wochen nur schwerlich verabreden konnte, «etwas, was sonst die normalste Sache der Welt ist», wie Ruth Bär ergänzte.
Weil sie das Privatleben der Galeristin nicht gross interessierte, verabschiedeten sich die übrigen drei Herren von der Tischrunde, um noch eine Weile auf Deck zu gehen. Joseph Ritter verabredete sich mit ihnen um 11.30 Uhr bei der Rezeption, in Erwartung der Ankunft der Hamburger Kollegen mit ihren Suchhunden. Diese Verabredung erging sicherheitshalber auch an Luigi Bevilaqua als SMS.
Joseph Ritter begann, gezielte Fragen zu stellen, um sich in der noch zur Verfügung stehenden Zeit ein möglichst klares Bild von Fiona Decorvet zu machen, damit er mit seinem Team – Claudia Lüthi, Elias Brunner und Stephan Moser – aufgrund konkreter Ansätze arbeiten konnte. Je nach Ausgangslage musste auch der Kriminaltechnische Dienst KTD der Kantonspolizei miteinbezogen werden, Eugen «Iutschiin» Binggeli und Georges «Schöre» Kellerhals, ebenso die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland in der Person von «Staatser» Max Knüsel, auch für Schwarzenburg zuständig. Wenig wahrscheinlich schien hingegen die Kontaktnahme mit Veronika Schuler, Rechtsmedizinerin beim Institut für Rechtsmedizin Bern IRM, da es aller Voraussicht nach keine Obduktion vorzunehmen galt. Ritter ertappte sich dabei, vom eigentlichen Thema abgeschweift zu sein.
«Kann mir jemand von Ihnen die Namen von Männern nennen, mit denen Frau Decorvet in den letzten Monaten oder Jahren liiert war?»
«Herr Ritter, das tönt beinahe so, als würde Fiona ihre Partner regelmässig wechseln», ereiferte sich wiederum Ruth Bär.
«Frau Bär, seien wir ehrlich, wir alle stehen doch vor einer Blackbox, für Sie als beste Freundinnen ist das Verschwinden ebenso rätselhaft wie für mich. Wenn wir ihren Weggang aus dem Theater nach dem Lesen einer SMS mit dieser Meldung in Zusammenhang bringen müssen, so ist von nun an alles wichtig, da können wir gar nichts ausklammern. Also: Können Sie mir Namen nennen, möglichst mit weiteren Informationen?»
«Haben Sie schon daran gedacht, jenen Absender ausfindig zu machen, der ihr gestern kurz nach 21 Uhr eine Message geschrieben hat? Danach ist sie ja aufgestanden und gegangen», stellte Ruth Gnädinger ihre Hilfe zur Verfügung.
«Ja, Frau Gnädinger, meine Mitarbeiterin erkundigt sich beim Provider, nur dauert das meistens mehr als bloss zwei, drei Stunden. Ich hoffe nur, es habe sich nicht um ein Prepaid-Handy gehandelt, sonst wird die Aufgabe fast unlösbar», gab Ritter zu bedenken.
«So viel ich weiss», antwortete Ruth Gnädinger, «hat Fiona nur ein Handy und das ist bei der Swisscom registriert», worauf die übrigen drei Damen nickten.
«Wie gesagt, wir sind an der Sache dran. Jetzt wäre ich um Namen froh», worauf das grosse Schweigen begann, denn keine der vier Freundinnen wollte als Petzerin gelten, als Schnuriwyb.
Prisca Antoniazzi war die Erste, die ihre Zunge lockerte, verbunden mit der Bitte, dass «dies alles unter uns bleibt», was der Leiter des Dezernats Leib und Leben der Kantonspolizei zu bestätigen vermochte. Der Name von Leevi Hämäläinen fiel als Erstes, ein erfolgreicher Architekt aus Jyväskylä in Finnland. Ritter bat Prisca Antoniazzi darum, Namen und Ortschaft zu buchstabieren, damit er korrekte Angaben auf seinem Aufnahmegerät hatte. Hämäläinen hatte erst vor drei Jahren die Innenräume der Villa von Fiona Decorvet in Schwarzenburg neu gestaltet, in modernem skandinavischem Stil mit sehr viel Holz und dazu passenden Materialien. Offenbar hatte der Finne die neuen Räumlichkeiten für eine gewisse Zeit gleich selber mit Fiona Decorvet geteilt, wie sich Prisca Antoniazzi recht vornehm ausdrückte. Haruki Kobayashi folgte als nächster Name, ein bekannter japanischer Performance-Künstler, der abwechslungsweise in Kobe und Paris lebte. Ritter liess sich auch diesen Namen buchstabieren, verbunden mit der Frage, ob es auch Schweizer mit entsprechenden Namen im Leben der Bernerin gab, à la Housi Knecht oder Franz Gertsch, was den vier Frauen für einen Augenblick ein Schmunzeln entlockte.
«Herr Ritter, Fiona ist von Berufes wegen international ausgerichtet, sehr kosmopolitisch. Sagt Ihnen der Name Kobayashi nichts?»
«Doch schon», versuchte sich Ritter entspannt zu geben, «als ehemaliger Formel-1-Fahrer für das Team Sauber, aber ich denke nicht, dass dieser Kobayashi auch euer Künstler ist. Auch nicht der Skispringer aus Japan», was für eine weitere leichte Entspannung sorgte.
Ein weiterer Name blieb trotz Nachhaken aus, entweder aus echter Unwissenheit heraus oder aber aus Furcht, dem Ermittler zu viel zu erzählen. Dieser wechselte deshalb das Thema, erkundigte sich, ob Fiona Decorvet «Feinde» oder «Ärger mit jemandem» hatte, im Bewusstsein, dass erfolgreiche Zeitgenossen immer mit Neidern konfrontiert wurden. Hier stiess er auf eine Mauer des Schweigens, was ihn nicht weiter zu erstaunen vermochte. Abgesehen davon stand er ja ganz am Anfang seiner Befragungen, weshalb er zurück auf die Herren Hämäläinen und Kobayashi zu sprechen kam. Viel erfuhr er nicht, nur, dass beide Liaisons – der Finne vor dem Japaner – jeweils ungefähr ein Jahr dauerten und nicht zuletzt deshalb scheiterten, weil weder der Skandinavier noch der Künstler aus dem Land der aufgehenden Sonne ihre Wohnorte verlassen und in die Schweiz wechseln mochten.
Um die vier Frauen nicht zu sehr zu strapazieren, bedankte sich Ritter und stellte in Aussicht, sie über den Verlauf der Ermittlungen zu informieren, erstmals am selben Abend, nach den Erkenntnissen der Durchsuchung mit den Spürhunden. Er erklärte ihnen auch, dass er sie übermorgen Dienstag gerne im Ringhof sprechen würde, einzeln, was zumindest gegen aussen zu keinerlei sichtbaren Verunsicherungen der vier Freundinnen von Fiona Decorvet führte.
Luzia Cadei hatte sich anerboten, als Transitstation zwischen Ritter und ihren Freundinnen zu amten. Ritter verabschiedete sich «vorläufig» von den Frauen. Auf seinem Handy-Display hatte er gesehen, dass Claudia Lüthi ihn zu erreichen versucht hatte. In diesem Moment kam auch Luigi Bevilaqua mit einem bereits ausgedruckten zweiseitigen Protokoll in englischer Sprache mit den Aussagen des Capitano zurück, damit «alles seine Ordnung hat». Darin stand schriftlich, was Ritter & Co. bereits selber erlebt hatten: Durchsage über die Lautsprecheranlage, die Auswertung der Videobänder, die Durchsuchung des Schiffs und weitere Einzelheiten.
Und dennoch konnte der Italiener mit einer neuen Erkenntnis aufwarten, denn auf einem bisher nicht visionierten Video war Fiona Decorvet um 21.13 Uhr während zwei Sekunden zu sehen, wie sie den Aussenbereich auf Deck 5 bei den Rettungsbooten betritt, ihre Aufmerksamkeit auf das Handy gerichtet, das sie in der Hand hält. Diese kurze Sequenz bestätigte jedoch nur, dass sie tatsächlich jene Zone betrat, in der ihre Handtasche gefunden wurde.
«J. R., wir sehen uns um 11.30 Uhr, das Schiff legt pünktlich nach Zeitplan im Cruise Center Steinwerder an. Der Capitano hat seine Security-Leute beauftragt, alle Passagiere, die von Bord gehen, also auch jene, die am Abend wieder aufs Schiff zurückkommen, genau mit den Fotos auf ihren Bordkarten zu vergleichen. Ich werde jetzt versuchen, mit einigen Offizieren zu sprechen, Man weiss ja nie …», vermeldete Bevilaqua. Ritter bedankte sich beim Mailänder für dessen Engagement.
Die fünf Kriminalisten trafen alle einige Minuten zu früh bei der Rezeption ein, der Berner informierte über den Stand der Dinge, wobei es zur eigentlichen Causa Decorvet keine Neuigkeiten gab, lediglich Informationen zu ihrem Privatleben. Zusammen mit unzähligen anderen Passagieren warteten sie anschliessend auf dem obersten Deck auf das Anlegen der Alberta Imperator. Capitano Enrico Tosso und seine Offiziere hatten keine Mühe, das Schiff zentimetergenau zu «parkieren», schliesslich hatten auch in der Schifffahrt längst Computer und Sensoren das Kommando über den Sextanten übernommen, sodass es eigentlich salopp ausgedrückt nur darum ging, die Navigationsvorgänge zu überwachen.
Holger Herrlich ging als Erster an Land, der nächste Passagier musste zwei, drei Minuten warten. Grund dafür war der Umstand, dass HH den bereitstehenden sieben Hunden der Spezialkräfte die vorhandenen Kleidungsstücke vor die Nase hielt, um eine Spur zu Fiona Decorvet aufnehmen zu können. Entsprechend schmal war denn auch der Durchgang, den die Passagiere zu beschreiten hatten. Selbstverständlich hatte Enrico Tosso zuvor über die Lautsprecheranlage bekanntgegeben, dass es «besonderen Umständen» wegen zu einer genaueren Personenkontrolle kommen werde. Die meisten Leute vermuteten beim Anblick der Deutschen Schäferhunde die Suche nach Drogen und stellten keine Fragen, liessen sich höchstens zu mehr oder weniger witzigen Bemerkungen verleiten.
Nach einer halben Stunde waren sowohl jene von Bord, die ihre Reise beendet hatten – wie Ruth Bär, mit zwei Rollkoffern, Luzia Cadei, Ruth Gnädinger und Prisca Antoniazzi –, als auch jene «Rückkehrer», welche für einige Stunden die Hansestadt besichtigen wollten, die meisten in Richtung Elbphilharmonie und dem in der Speicherstadt praktisch nebenan liegenden Miniatur Wunderland mit der grössten Miniatureisenbahnanlage der Welt.
Die Hundeführer betraten anschliessend mit ihren Tieren das Zugangsdeck, wo die «Schnüffler» nochmals die beiden Kleidungsstücke zu riechen bekamen. Ein Hund wurde ins Theater geführt, zu jenem Sessel, auf welchem Fiona Decorvet gestern Abend Platz genommen hatte. Zwei Schäferhunde führte man in den Aussenbereich von Deck 5, zu den Rettungsbooten, wo die leere Handtasche gefunden wurde. Die übrigen vier Vierbeiner teilten sich mit ihren Haltern auf: Zwei begannen auf dem untersten Deck in den Crew-Räumen wie Messe, allgemeine Anlagen und Kabinen, Letztere waren weit weniger luxuriös eingerichtet als die Passagierkabinen. Immerhin: Auf der Alberta Imperator teilten sich bloss zwei langjährige Crewmitglieder eine Kabine, zudem befanden sich diese aus Sicherheitsgründen über dem Wasserspiegel, zum Teil mit einem Bullauge ausgestattet, auch wenn es nicht geöffnet werden konnte, im Gegensatz zu ebenfalls vorhandenen Innenkabinen, die von Crewmitgliedern auf Ersteinsatz belegt waren, meistens Inder, Filipinos und Tamilen.
Es war keine Überraschung, verlief die Spurensuche auf diesem Crewdeck ergebnislos, sodass die Tiere eine Etage höher zum Einsatz gelangten, in den Personalräumen für Staff-Mitarbeitende, welche meistens in den Bereichen der Rezeption, der Fitness, der Animation und der Kinderbetreuung tätig waren, und Offiziere. Auch hier: Fehlanzeige. Als Nächstes kamen die Warenlager an die Reihe, diese Flächen waren durch die insgesamt acht Restaurants und zwölf Bars belegt.
François Hommard und Adalbert König hatten sich zuvor von ihren drei Kollegen in Richtung Flughafen Helmut Schmidt verabschiedet, nachdem ihnen das Trio Herrlich/Bevilaqua/Ritter unter Verdankung ihrer Hilfe mitgeteilt hatte, dass es für sie nichts mehr zu tun gebe.
Während die Hunde im Einsatz standen, kam Ritter endlich dazu, Claudia Lüthi anzupeilen. Diesen Anruf hatte er bewusst hinausgezögert, um genügend Zeit für seine Mitarbeiterin zu haben.
«Sorry, Claudia, ich wollte nicht unter Druck anrufen, deshalb erst jetzt. Und glaub mir, mit Desinteresse an deinen Erkundigungen hat das gar nichts zu tun …», begann er.
«J. R., das würde ich dir auch niemals unterstellen», lachte sie, «aber erzähl du mir zuerst den Stand der Dinge aus Hamburger Sicht», was Ritter stichwortartig auch ausführte.
«Jetzt aber zu dir. Stimmt es, dass Swisscom der Provider ist?»
«Ja. Aber es bedurfte schon der Hilfe der Staatsanwaltschaft, um an die Daten heranzukommen.»
«Knüsel?»
«Gut geraten, dein Max», was Ritter dran erinnerte, dass er erst seit einem Jahr mit Max Knüsel per Du war, auf dessen Vorschlag hin, anlässlich der Recherchen in Zusammenhang mit dem Doppelmord am Wohlensee, zu dem sich noch ein dritter in Genf gesellte.
Gleich zu Beginn der Erklärungen stand eine grössere Verwirrung: Der letzte Anruf von gestern Abend um 20.52 Uhr wurde von einem Prepaid-Handy aus getätigt, Fiona Decorvet hatte ihn aber weggedrückt, es gab keine Gesprächsdauer. Eingeloggt war der Anrufer in Herrliberg, an der «Goldküste», am rechten Zürichseeufer.
«Bringt uns wohl nicht gross weiter, Claudia …», bemerkte Ritter enttäuscht.
«Nur nicht so pessimistisch, J. R., Victorija Rudenko wohnt in Feldmeilen, wie ich herausgefunden habe, liegt gleich neben Herrliberg», konterte Claudia Lüthi.
«Immerhin ein Ansatz.»
«Da ist noch etwas, J. R. …»
«Nämlich? Claudia, mach es nicht so spannend!»
«Um 19.29, 21.09 und 21.13 Uhr hat man sie per SMS kontaktiert.»
«Genial, Claudia, genial! Wer denn?»
«Prepaid, leider, aber möglicherweise wurden die Kontakte, so die Swisscom, auf hoher See abgesetzt, eine genauere Ortung ist nicht möglich.»
«Das hingegen ist interessant, merkwürdig. Was sagen uns die übrigen Handydaten von Frau Decorvet?»
«Wir werten die Daten aus, mit einer Ruth Bär hat sie häufig telefoniert.»
«Ist eine Freundin von ihr, war auch auf dem Schiff, du kannst sie ruhig vernachlässigen, ebenso Prisca Antoniazzi, Luzia Cadei und Ruth Gnädinger, die zählen ebenso dazu. Ist dir sonst Verdächtiges aufgefallen?»
«Nein, nicht wirklich, aber bis du wieder in Bern bist, werden wir wohl mehr wissen. Weisst du schon, wann genau dein Flug geht?»
«Nein, noch nicht. Heute werde ich mit den italienischen und deutschen Kollegen zusammensitzen und das weitere Vorgehen absprechen. Ich melde mich, danke, Claudia.»
Inzwischen zeigten die Uhren auf der Alberta Imperator, dass die beiden ersten Stunden des Nachmittags an diesem 9. August bereits verstrichen waren. Ritter machte sich nach einem Telefongespräch mit seiner Partnerin Stephanie Imboden auf Spurensuche – zu den Spürhunden. Den ersten Vierbeiner fand er auf jenem Deck, auf welchem das Theater liegt. Der Hundeführer war im Gespräch mit Holger Herrlich, weshalb sich Ritter vorerst auf Distanz hielt, er wollte die beiden Herren in ihrer Diskussion nicht stören. Auch ohne Worte sah Ritter ihrer Gestik und Körperhaltung an, dass die Spurensuche kein Ergebnis gezeitigt hatte, eine Vermutung, die HH kurz danach bestätigte.
Der Spürhund hatte die Fährte auf der Suche nach Fiona Decorvet sofort aufgenommen, als er an den Sessel herangeführt wurde, auf dem die Vermisste Platz genommen hatte. Von dort aus begab sie sich offenbar direkt zu einem der insgesamt sechs Aufzüge, die allein im vorderen Bereich des Schiffes zur Verfügung standen. Auf Deck 5 gab es bei den Liften eine weitere Spur, die direkt zum Aussenbereich führte, dorthin, wo die Handtasche bei den Rettungsbooten lag. Ironie des Schicksals für die Ermittler: Kurz bevor man die Handtasche entdeckt hatte, wurde das Aussendeck gereinigt, die Handtasche offensichtlich übersehen, und mit diesen Arbeiten auch sämtliche mögliche Spuren beseitigt, also war man in dieser Beziehung so klug wie zuvor, weshalb sich Ritter auf tiefer gelegene Etagen begab, auf der Suche nach weiteren Vierbeinern mit ihren Haltern. Unterwegs verfolgte ihn kurz folgender Gedanke: Die Mitarbeitenden auf der Alberta Imperator wussten bestimmt, welche Zonen nicht unter Video-Überwachung standen. Was nun, wenn eine Reinigungskraft die Handtasche gefunden und Handy samt Bordkarte an sich genommen oder über Bord geworfen hätte? Aber weshalb dann nicht gleich die ganze Handtasche? Nein, diese Überlegung machte keinen Sinn, weshalb er sich wieder den Fakten widmete.
Ritter wurde im Bereich der Lagerräume fündig, wo inzwischen mehrere Hunde bellten und damit anzeigten, dass es jene Gerüche gab, die mit den Kleidungsstücken identisch waren. Weil die verschiedenen Kühlkammern und Lebensmittellager mit offener Ware für Tiere tabu waren, bemühten sich die Tierhalter darum, nach sichtbaren Spuren zu suchen, allerdings vergeblich, so sehr sie sich auch bemühten, Berge von Kisten und Kartons freizulegen. Capitano Enrico Tosso und einer der Offiziere standen ebenfalls vor Ort, nicht zuletzt, um einen Verstoss gegen die Lebensmittelvorschriften zu verhindern, denn Kisten mit offenen Früchten, in die die Hunde ihre Nasen gesteckt und an denen sie mit den Pfoten gescharrt hatten, hätten sofort entsorgt werden müssen. Das galt es zu verhindern, trotz allem Verständnis für die Sucharbeiten.
«Herr Ritter», Enrico Tosso wandte sich an den Schweizer, «die Tiere haben eine Spur gefunden, aber wir können uns keinen Reim darauf machen. Nirgends gibt es optische Hinweise darauf, dass Frau Decorvet sich tatsächlich hier aufgehalten hat. Es ergibt auch keinen Sinn. Meine Leute werden jedoch bis zur Abfahrt des Schiffs jede auch nur einigermassen zugängliche Fläche absuchen und sämtliche Kisten kontrollieren. Ich werde Ihnen in jedem Fall Bescheid geben, ungefähr um 19.00 Uhr. Wir werden auch neu einzuladende Ware für einige Stunden separat zwischenlagern, um mögliche Spuren nicht zu verwischen.»
«Danke, Capitano. Eine Frage hätte ich noch.»
«Prego.»
«Es gibt ja auch Ware, die das Schiff verlässt …»
«Ja, natürlich, Essensreste. Und Fäkalien, aber beides wird auf dem Schiff getrocknet und anschliessend verbrannt, um Energie zu gewinnen. Die Imperator ist diesbezüglich das vermutlich modernste und sauberste Schiff der Welt, mit eigener Kläranlage. Alles, was wir nicht verwerten können, wird maschinell zerkleinert und geht zum Rezyklieren von Bord. Sie denken aber hoffentlich nicht, dass …»
«Sagen wir es so: Ich hoffe es nicht.» Diese Hypothese bedeutete auch das Ende dieses Gesprächs.
Weil es an Bord keine weiteren Indizien zum Aufenthalt der Fiona Decorvet gab, einigte man sich mit Holger Herrlich, die Suche abzubrechen, was gleichzeitig auch bedeutete, dass die Herren Bevilaqua, Herrlich und Ritter sich vom Kapitän verabschiedeten, mit der Aussicht, weiter miteinander in Kontakt zu bleiben. HH schlug seinen beiden Kollegen vor, doch mit ihm zur nicht sehr weit entfernten Davidwache zu kommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.