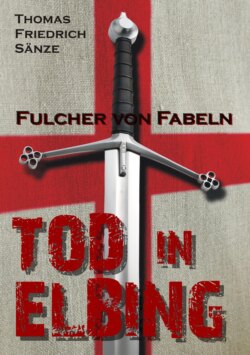Читать книгу Fulcher von Fabeln - TOD IN ELBING - Thomas Friedrich Sänze - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеTrübe flackerndes Licht blendete meine Augen. Ich drehte mich weg und zog mir grunzend die Decke übers Gesicht. Mit dem Erfolg, dass sie mir weggerissen wurde.
„Fulcher! Wacht auf!“
Ich war hart. Dazu extrem steif. Steif in jeder nur denkbaren Beziehung. Nur nicht an der einen wichtigen Stelle, auf die es vor allen anderen und insbesondere für einen Mann ankam. Das fiel mir immer als erstes auf, wenn ich mitten in der Nacht durch ein schmerzhaftes Rütteln an der linken Schulter aufgeweckt wurde.
Nur langsam kam ich zu mir. Ganz langsam. Noch langsamer. Mit einem schalen Geschmack im Mund. Ich drehte mich mit einem lauten Schmatzen zur Seite und versuchte herauszufinden, ob dieses Empfinden eher von dem abgestandenen Wein oder von dem faden Bier von gestern herrührte. Da ich beides in mehr als ausreichender und finanziell ruinöser Weise genossen hatte, war es mir jedoch unmöglich, das im Nachhinein genau festzustellen. Vielleicht hatte ich auch nur einmal wieder aus Versehen im Schlaf eine Wanze verspeist. Was nicht die erste ungewollte Mahlzeit dieser Art gewesen wäre und sicherlich auch nicht die letzte, die ich in diesem feuchten Loch, in dem ich mit meinem Leidensgenossen hauste, unfreiwillig genoss. Auf meinem Lager tummelte sich bestimmt mehr Ungeziefer als es in der Hölle Teufel gab. Jede Form von Reinlichkeit war da vollkommen sinnlos und eine Teufelsaustreibung wäre vermutlich schon eher von Erfolg gekrönt.
„Würdet Ihr nicht immer so viel saufen, kämet Ihr morgens auch aus dem Bett!“
Die nörgelnde Stimme verursachte mir Kopfschmerzen. Es war nicht morgens, sondern mitten in der Nacht. Diese Kombination aus früh, kalt und dunkel war absolut nicht mein Ding! Langsam öffnete ich meine Augen, erst das eine, dann das andere. Gleich darauf bereute ich es zutiefst, denn ich sah direkt in die hässliche Visage meines Kammerkumpans Jacop von Berg. Im Halbdunkeln konnte ich zwar nichts Genaues erkennen, konnte mir aber vorstellen, wie er sein blasses, teigiges Gesicht mit den Schweinsaugen breit grinsend über mich beugte.
Ich hätte das als Omen betrachten und im Bett bleiben sollen, denn ich verabscheute diesen fetten Kerl. Wobei Abscheu noch viel zu milde ausgedrückt war. Ich hasste ihn, und zwar abgrundtief. Er hatte in der Frühe immer diese penetrant gute Laune und machte sich ein diebisches Vergnügen daraus, mir auf die Nerven zu fallen. Als er auch noch an meiner rechten Schulter rüttelte, war an Schlaf nicht länger zu denken. Ohne hinzusehen schlug ich ihn. Das war sozusagen unser morgendliches Ritual. Er ging mir auf die Nerven, und ich verkloppte ihn. Seltsamerweise hielt ihn das aber nie davon ab, mich weiterhin jeden Morgen aus dem Bett zu zerren. Ich glaube, er stand darauf. Verhauen zu werden machte ihn an. Das war so ein typisches Mönchsding. Sie liebten es zu leiden.
Ich hörte ihn ächzen, als meine Faust die riesige Wanne traf, die manche wohl als Bauch bezeichnet hätten und grinste zufrieden in mein Kissen. Das Grinsen verging mir jedoch als ich ihn würgen hörte. Meine Nackenhaare stellten sich auf, als ich voller Schaudern an das letzte Mal zurückdachte. Einer meiner morgendlichen Hiebe hatte seinen Magen getroffen, und er hatte mir daraufhin direkt in den Nacken gekotzt.
Diesmal hatte ich jedoch Glück. Jacop würgte nur einen Rülpser heraus. Ich war furchtbar erleichtert, auch wenn mich sein unmenschlich stinkiger Atem fast ins Jenseits beförderte. Mühsam drehte ich mich und setzte mich probeweise auf. Ich hatte Jacops Atem überlebt. Darüber freuen konnte ich mich aber nicht wirklich. Ich hatte nämlich nicht die geringste Lust zum Aufstehen, zum Atmen, zum Leben und überhaupt zu allem.
Benommen versuchte ich, meine Augen aufzuhalten. Ich fror. Es war Ende Oktober und schweinekalt in unserer Gruft. Wieder einmal nahm ich mir vor, Jacop bei nächstbester Gelegenheit zu züchtigen. Wohl wissend, dass ich das sowieso wieder vergessen würde.
Jacop sah offenbar ein, dass ich halbwegs wach war und entfernte seine fetten Massen mit wehender Kutte aus der Kammer. Die Holztür fiel mit einem Knall hinter ihm zu. Allein blieb ich zurück in diesem dunklen Loch, das wir gemeinsam bewohnten. Wie immer war ich ziemlich verwundert, wie dieses kleine fette Mönchlein es durch die enge Tür schaffte, ohne darin stecken zu bleiben. Gähnend nahm ich die Hände hoch und reckte mich ausgiebig. Die funzlige Kerze, die auf dem wackligen dreibeinigen Hocker in der Ecke stand, tauchte den Raum in flackerndes Licht. Das Türrätsel war vermutlich nur eines der vielen Geheimnisse des Lebens, das ich niemals würde lösen können. Ein weiteres wäre, wie es Jacop nur schaffte, bei der kargen Ordenskost so fett und feist zu werden, während mir mein Magen in steter Regelmäßigkeit an den Kniekehlen hing. Sogleich fing derselbe an, sich mit hungrigem Knurren zu melden.
Laut fluchend suchte ich nach meinen Stiefeln. Das war gar nicht so einfach, da sie sich immer an den Stellen befanden, wo kein vernünftiger Mensch nach ihnen suchen würde. Ich fand sie schließlich – welch eine Überraschung – unter dem Bett. Ich war mir fast sicher, dass Jacop sie dorthin befördert hatte. Bestimmt lachte er sich in sein fettes Fäustchen bei der Vorstellung, wie ich mich flach auf dem mit Stroh bedeckten Boden wälzte, nur um mühsam mein Schuhwerk hervorzukramen.
Seit meiner Ankunft vor mehreren Wochen teilte ich jetzt schon die mickrige, stinkende Kammer mit diesem fetten Schwein. Gäbe es in dem Raum doch bloß ein Fenster, ich hätte ihn schon lange daraus hinausgestürzt. Auf der anderen Seite war es wohl ganz gut, dass es keines gab, es hätte mich sonst in eine ständige Versuchung versetzt, selber zu springen.
Nachdem ich endlich die Stiefel hervorgeangelt hatte, klaubte ich meine Unterkleidung aus ungefärbtem Leinen vom strohbedeckten Boden und schlüpfte in mein wollenes Oberzeug. Mein weißer Ordensrock hatte schon deutlich bessere Zeiten gesehen aber trotzdem war mir gleich wärmer zumute. Ich glaubte mich dunkel daran zu erinnern, dass ich auch irgendwann einmal eine Kapuze dazu gehabt hatte. Aber vielleicht war das auch nur Einbildung. In einem schon fast panischen Anfall von Würdebedürfnis versuchte ich, aus den einzigen Kleidungsstücken, die ich noch besaß, Dreck und Flecken zu entfernen sowie die Falten zu glätten. Der Anfall ging vorbei. Ich gab es auf. Statt zu versuchen, ordentlich auszusehen, setzte ich mich aufs Bett und zog die Stiefel an. Danach erhob ich mich und ließ einen letzten Blick durch die Kammer schweifen. Zwei Pritschen, ein Hocker, eine Kerze, ein schiefes Holzkreuz an der Wand über Jacops Lager und, der einzige Luxus den es gab, ein strohgefülltes Kopfkissen auf dem meinen. Das war so ziemlich die ganze Einrichtung der Kammer. Als Ordensritter konnte man damit durchaus zufrieden sein. Immerhin musste ich nicht mit allen anderen auf einem mit Wollresten vollgestopften Bettsack im Dormitorium pennen. Alles in allem hätte ich es also weitaus schlechter treffen können.
Ich gab es auf, mir durchs Haar zu streichen, da ich nur eine Glatze vorfand. Ersatzweise kratzte ich mich also hinterm Ohr. Der Verlust der Haare missfiel mir am Dasein als Ordensritter stets am meisten. An den kahlgeschorenen Kopf, der meinen Segelohren so richtig Geltung verschaffte, würde ich mich wohl nie gewöhnen. Das war ein ziemlich gewaltiger Nachteil bei den Frauen. Deshalb hatte ich meine Haare früher auch immer etwas länger getragen, als es eigentlich erlaubt war.
Aber das war damals gewesen. In einem anderen Leben. Als ich noch ein richtiger Mann war. Im Hier und Jetzt war ich nur noch ein Fleisch gewordener Weinschlauch.
Mit einem abgrundtiefen Seufzer, blies ich die Ruine von einer Kerze aus und verließ die Kammer. Den Mantel ließ ich, wie meistens, weg. Er war viel zu alt und zerlöchert, als dass man ihn am helllichten Tage hätte herzeigen können. Hauptsächlich nutzte ich ihn sowieso nur noch als Decke zum schlafen.
Der Kreuzgang vor der Kammer war stockdunkel, nur vereinzelt erhellten Fackeln manche Stellen. Das passte zu meiner Stimmung, und den Weg fand ich sowieso im Schlaf. Wie in jedem Kloster war der Kreuzgang gut durchdacht gestaltet, denn er diente als zentraler Versammlungsort für das manchmal mehr, häufig jedoch eher weniger geordnete Zusammenleben unserer Ordensgemeinschaft. Neben seiner Funktion als Durchgangs- und Verbindungsraum zwischen Kirche, Kapitelsaal, Refektorium, Skriptorium und Dormitorium spielten sich hier unser Alltagsleben und alle damit verknüpften Menschlichkeiten ab. Ähnlich wie die Krämer auf dem städtischen Marktplatz nutzten die versammelten Ordensmitglieder den Kreuzgang, um Geschäfte zu machen, Witze zu reißen, Intrigen zu schmieden sowie sich gegenseitig zu beleidigen oder zu verprügeln.
Raschelnde Kutten und verhaltener Lärm waren zu hören. Die Glocke läutete Matutin, der Nachtgottesdienst begann. Das hieß für alle, aufstehen. Egal ob alt oder jung, krank oder gesund, Ritter oder Mönch. Nur von November bis Januar war es gestattet, ein wenig länger zu schlafen. Es war der 1. November, wir schwelgten also in dieser süßen Phase. Stockfinster und mitten in der Nacht war es dennoch.
Was für ein Glück es doch für uns alle war, dass unser Tagesablauf im Kloster durch das Läuten der Glocken geregelt wurde. Auf ein Uhr Matutin oder Vigilien, wie es auch genannt wurde, folgten drei Uhr Laudes mit weiteren Gebeten, sowie sechs Uhr Prim, die Zeit für das eigentliche Morgengebet. Kaum hatte man diesen Gebetsmarathon hinter sich, folgte neun Uhr Terz mit drei Psalmen. Um zwölf Uhr Sext nahm man zwischen Sext und Non die einzige Mahlzeit des Tages ein. Nur von Ostern bis Pfingsten wurde so richtig auf den Putz gehauen und es gab zwei Mahlzeiten. Um 15 Uhr Non ging es dann weiter, zur Prim, Terz, Sext und Non wurde je ein Hymnus mit drei Psalmen gesungen. Um 18 Uhr Vesper folgten vier Psalmen und ein Hymnus. Während der vierzigtägigen Fastenzeit, der Quadragesima, wurde die einzige Tagesmahlzeit erst nach der Vesper eingenommen. Zum Schluss folgte 21 Uhr Komplett, das Abendgebet und die Schlafenszeit.
Man gewöhnte sich zwar daran, mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen zu werden, um Gott zu huldigen. Allerdings brachte dieses dauernde Gehuldige meine Laune regelmäßig auf den Tiefpunkt. Die Aussicht auf weitere Hymnen und Gebete betäubte ich normalerweise im Voraus mit einem zünftigen Vollrausch. Jedes Mal wenn ich diesen langen deprimierenden Gang täglich in aller Herrgottsfrühe hinunterschlurfte, um meine Gebete zu verrichten, meldete sich lautstark der Kopfschmerz in meinen noch verbliebenen Gehirnwindungen. Jacop war der Ansicht, dies käme alleine von meinen Besäufnissen. Allerdings wusste ich es natürlich besser. Es lag an der Fleischeslust. Vielmehr am beständigen Mangel an derselben. Hinzu kam dann noch dieses alltäglich erzwungene Rumgebete und -gesinge. Es war wirklich kein Wunder, dass ich allmählich den Verstand verlor. Beziehungsweise mir die größte Mühe gab, ihn mir wegzusaufen. Besoffen zu sein war für mich zum Überlebensmittel geworden. Genau deshalb führte ich in der Regel immer einen vollen Weinschlauch bei mir, gefüllt mit allem, was berauschte. Leider wollte es das Schicksal, dass ich gestern meinen ganzen Vorrat an Laune machenden Getränken auf einmal verbraucht hatte. So musste ich wohl oder übel nüchtern am Gottesdienst teilnehmen. Es gab nicht viele Qualen, die hätten schlimmer sein können.
Als ich am Dormitorium vorbeikam, überrannte mich fast eine Horde übereifriger Mönche. So schnell, wie sie aus dem Schlafraum gestürmt kamen, hatten sie es offenbar sehr eilig, ihre kleinen schmutzigen Seelen zu retten. Verwundern tat mich das nicht wirklich, waren diese Mönchlein doch zu alle den wunderschönen Handlungen fähig, die mir im Leben nicht mehr vergönnt waren. Freuden voller Wonnen, die man nur in den Schößen, Mündern und Hintern von Frauen – oder im Falle der Mönche wahrscheinlich eher von Männern – fand und welche das Leben überhaupt erst lebenswert machten.
Erschöpft lehnte ich mich einen Moment an die Wand und versuchte, meinen pochenden Kopf mitsamt den gereizten Nerven zu beruhigen. Nüchtern war dies für mich in der Regel keine ganz leichte Aufgabe. Ich brauchte wirklich dringend was zu saufen. Aus tiefster Seele vor mich hinfluchend schlurfte ich weiter. Schatten tanzten um die wenigen Lichtquellen herum. Es konnte im Kreuzgang zu dieser Stunde ziemlich unheimlich sein. Schon manch wackerer Ordensmann hatte bei seiner Seele geschworen, Geister und Dämonen erblickt zu haben. Selbst den Teufel leibhaftig hatte manch einer schon hier angetroffen. Wundern tat das niemanden, denn das Saufen war neben Hurerei eines der am weitesten verbreiteten Phänomene im Orden, vor allem in den jetzigen Zeiten. Ich persönlich wäre geradezu entzückt gewesen, dem Teufel hier im Kreuzgang zu begegnen. Wenigstens wäre das dann einmal etwas Reales, denn die Schatten in meiner Seele waren viel beunruhigender und bedrohlicher als alle wahnhaft weinseligen Fantasien zusammen es je hätten sein können.
Pechschwarze Gedanken durchzogen meinen Geist und tiefste Schwermut überkam mich. Wie immer, wenn ich zu lange nüchtern und mit mir selber alleine war. Ohne betäubenden Rausch vermischten sich Frust, Wut, Verzweiflung, Selbstmitleid, Ohnmacht und das Gefühl völliger innerer Leere mit grenzenlosem Selbsthass. In meiner Seele herrschte tiefste Düsternis wenn der Schmerz kam und meinen Geist überwältigte.
Mit ein oder zwei mentalen Plagen wäre ich wohl noch fertig geworden, aber da mich alle immer in gemeinschaftlicher Gleichzeitigkeit überfielen, zehrte das besonders an meiner geistigen und seelischen Verfassung. Wenn es wieder einmal so schlimm kam, lag meine einzige Rettung auf dem Grunde eines leeren Kruges.
Viele behaupten, Kummer und Sorgen könne man nicht ertränken, da sie schwömmen. Da ich jedoch festgestellt hatte, dass es nur einer ausreichend großen Menge Weins bedurfte, um sie zumindest zu betäuben, war ich durchaus optimistisch, sie oder mich irgendwann tot gesoffen zu haben. Die Verzweiflung verlieh dieser Hoffnung Flügel. Letztendlich war Saufen das Einzige, was mich noch am Leben hielt. Sofern man mein Dasein noch als Leben bezeichnen konnte, denn das meiste davon bekam ich ohnehin nicht mehr mit. Wäre ich nicht ständig betrunken gewesen und hätte ich nicht mein Schwert mitsamt Rüstung bereits versoffen, wäre ich aus reiner Verzweiflung bestimmt irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, mich in meine rostige Waffe zu stürzen. Da ich aber wie alle anderen auch unbedingt in den Himmel wollte und mein Schwert schon lange versetzt war, fiel der Selbstmord wohl oder übel aus und ich versuchte stattdessen, meine Sinne beständig in einem Zustand der Betäubung zu lassen, der in der Tat näher am Tod als am Leben war.