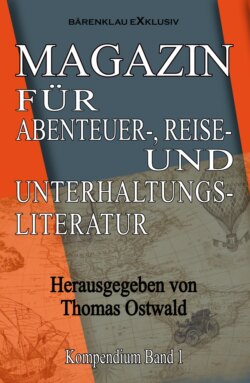Читать книгу MAGAZIN für Abenteuer-, Reise- und Unterhaltungsliteratur - Thomas Ostwald, Hymer Gregory - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neues um Sherlock Holmes
ОглавлениеIn der Einleitung zu meinem Artikel über die Entwicklung der Indianergeschichten bei Karl May erwähnte ich auch die berühmte Detektiv-Figur C. Doyles, den Meisterdetektiv Sherlock Holmes – oft kopiert, nie erreicht! Dadurch habe ich offensichtlich das Interesse einer größeren Leserschar angeregt, wie mir einige Zuschriften bewiesen. Nun, mit Doyles Figur werden wir uns im Graff-Anzeiger sicher noch häufiger beschäftigen, auch in Bezug auf die Romanheft-Serien, die in Deutschland ab 1907 erschienen (vgl. auch den Artikel von Werner G. Schmidtke!). Dieser Artikel soll einige Informationen zu Sherlock Holmes vorab bringen.
Zunächst einmal sei auf das „Holmes-Museum“ hingewiesen, das sich in einem Restaurant befindet und von einem findigen Geschäftsmann in der Northumberland Street (oder Road) Nr. 10, in der Nähe des Trafalgar Square in London eingerichtet wurde. Das „Restaurant-Museum“ ist voll von „Erinnerungsstücken“ an Doyles fiktive Figur – denn Sherlock Holmes hat nie gelebt! Der staunende Besucher findet die berühmte Geige, auf der der berühmte Detektiv – oft tief in Gedanken versunken – „herumgekratzt“ hat, natürlich seine berühmte karierte Mütze (Deerstalker-Mütze), die Pfeife und vieles andere. Bei diesen Formen der Verehrung fühlt sich mancher Leser vielleicht an Karl Mays Figuren erinnert, denen teilweise ja noch heute ähnliches widerfährt – siehe auch meine Ausführungen in dem erwähnten Artikel in Bezug auf die plötzliche Realisierung Winnetous, wenn der Segeberger Darsteller auftritt.
Doch damit noch lange nicht genug – Sherlock Holmes begeistert auch heute noch zahlreiche Leser durch seine scharfsinnigen Kombinationen, und Doyles Bände, einmal im Heyne-Verlag als Taschenbücher erschienen, haben inzwischen den Verlag gewechselt und kommen nach und nach wieder als Neuauflagen bei Ullstein heraus. Noch immer greift der Krimi-Freund, trotz der zahlreichen „modernen Detektive“, denen Computer und große Polizeizentralen mit riesigen Karteiarchiven zur Verfügung stehen, gern wieder auf den „Altmeister“ zurück.
Die „Welt am Sonntag“ berichtete am 8. Juni 1975: „Der Detektiv, der so viele Geheimnisse enthüllte, gibt inzwischen selber Rätsel auf: Sherlock Holmes, fast neunzig Jahre alt und schon mehrfach gestorben, erlebt in Amerika ein Comeback, das die Krimifans staunen lässt. Allein in den letzten Monaten erschienen sechs neue Bücher zum Thema, obwohl es schon zweitausend (!) Schriften über den Mann gibt, dessen Verstand so scharf ist wie sein Profil.“ Man hört, liest und staunt: zweitausend Schriften über eine fiktive Figur! Wann endlich kommt jemand auf die Idee, eine Biographie Winnetous zu erstellen? Das Rezept, nach dem auch schon Baring-Gould verfuhr, habe ich bereits im GA 5 beschrieben: Sorgsame Auslese und Auswertung jedes kleinen Details, das der Autor in den zahlreichen Geschichten „preisgegeben hat“. Baring-Gould wusste schließlich über Stouts Detektiv-Figur Nero Wolfe besser Bescheid als der Autor selbst! Seine Wolfe-Biographie (und hier kann ich mich gleich korrigieren) erschien im Jahre 1972 im Ullstein-Taschenbuch Verlag, ist jedoch leider vergriffen und bestenfalls noch antiquarisch zu bekommen. Auch seine Holmes-Biographie, genauso herrlich zu lesen wie der Wolfe-Band, ist seit Jahren vergriffen. Aber der Holmes-Fan kann jetzt wieder aufatmen – zahlreiche Biographien kommen auf den amerikanischen Buchmarkt, und vielleicht erscheint auch die eine oder andere wieder in deutscher Sprache. Gleich einflechten muss ich dabei, dass mir z.Zt. noch keine bibliographischen Angaben vorliegen und ich deshalb weder Verlag noch Preis dem Interessenten angeben kann.
Ach so, Sie meinen, diese Biographien wären kaum wissenschaftlich zu nennen und bestenfalls etwas für „ganz verrückte Holmes-Fans“? Da muss ich widersprechen, denn auch Sherlock Holmes ist inzwischen auf der Couch des Psychiaters gelandet – warum dann nicht auch eine Untersuchung Winnetous? „Die Welt“ schreibt weiter: „Mr. Holmes jedoch gehört zu den wenigen Romanfiguren, denen regelrechte Biographien gewidmet wurden. Die amüsanteste dürfte die von Williams S. Baring-Gould sein, die zu dem Schluss kommt, Holmes sei im Jahre 1957 im Alter von 103 Jahren auf einer Londoner Parkbank gestorben und habe sich in den letzten Tagen seines Lebens ausschließlich von „gelee royale“ ernährt.
Während Baring Gould selber Detektiv-Arbeit leistete und jede Seite aller Holmes-Stories auf biographische Details abklopfte, wendet Nicholas Meyer in seinem soeben in New York erschienenen Roman „The Seven-Percent-Solution“ („Die Sieben-Prozent-Lösung“) andere Methoden an. Wobei der Titel nicht die Lösung eines Falles meint, sondern die siebenprozentige Kokain-Lösung, die sich der Meister laut Conan Doyle gelegentlich zu injizieren pflegte – aus Langeweile, weil er seine Probleme immer so schnell löste.
Nicholas Meyer stützt sich in seinem Roman auf einen fiktiven Bericht des Holmes-Freundes Dr. Watson, der in den Stories bekanntlich als Ich-Erzähler auftritt. Dieser Bericht, in hohem Alter aufgezeichnet, wird nun freilich den Verehrern des Superdetektivs nicht so recht schmecken; denn er kratzt heftig an einigen Tabus, die das Idol umgeben.
Watson-Meyer erzählt vom jungen Studenten Holmes, der hoffnungslos kokainsüchtig ist und dessen Lehrer Professor Moriarty heißt. Mit Tricks und Tücke gelingt es Watson, ihn nach Wien zu locken. Dort machte gerade der junge Dr. Sigmund Freud seine ersten psychoanalytischen Experimente (zeitlich käme das durchaus hin).
Freud fordert den Holmes-Komplex zutage: auf der Psychiater-Couch! An dieser Stelle möchte ich das Zitat aus der „Welt“ kurz unterbrechen, um alle May-Kenner und Freunde aufmerksam zu machen, wie sich doch die Bilder gleichen: Man lese und staune, was den Komplex des Superdetektivs einst verursachte: „Die Mutter hat den Vater betrogen, der Vater hat sie dafür umgebracht. Und der böse Professor Moriarty hat dem Studenten alles erzählt. So wird der Weiterhin Holmes’ erklärt, so gerät Professor Moriarty in der Sicht seines Studenten zum Weltfeind Nr. 1. Erst als Holmes geheilt ist und nur noch gelegentlich kokst, wendet er sich zusammen mit Watson der Detektivarbeit zu.“
Eine große Gefahr der Verleumdung besteht immer dann für eine (auch fiktive) Romanfigur, wenn sie sich wenig dem „schwachen Geschlecht“ widmet und ständig von einem männlichen Begleiter beraten und unterstützt wird. Nicht erst seit der Frage des Homosexuellen-Magazins „Him“: Winnetou schwul? ist dem May-Freund dieses Problem bekannt: A. Schmidt spukt noch immer mit seinem „Sitara“ in zahlreichen Köpfen umher. Der Schaden, der durch solche oft als „Clownerie“ bezeichneten Abhandlungen entstehen kann, trifft den Autor am wenigsten: May ist lange tot, und auch Doyle lebt nicht mehr, denn, fast möchte man sagen natürlich, widerfuhr seinem Helden ähnliches. Ein Beispiel davon nennt die „Welt“ ebenfalls: „Die BBC drehte 1964 eine zwölfteilige Fernsehserie. 1970 machte sich Billy Wilder in dem Film „The Private Life of Sherlock Holmes“ (in Deutschland bisher nicht gezeigt) insofern einen Jux, als er eine russische Ballerina einführte, die den Meister beschwor, mit ihr ein Kind mit Wunderhirn zu zeugen. Dr. Watson hat größte Mühe, den widerstrebenden Holmes von dem Verdacht der Homosexualität freizuhalten.“ Nun, was um Winnetou und Old Shatterhand gemunkelt wurde und noch wird, muss hier nicht noch extra erwähnt werden. Dass aus solchen „Männerfreundschaften“ Rückschlüsse auf die Autoren gezogen werden, ist völlig unsinnig. Man sollte doch dabei nicht vergessen, dass jeder „Held“ ein Pendant braucht, um zum einen seine Überlegenheit immer wieder zu demonstrieren (Holmes lässt Watson immer erst seine eigenen Schlüsse ziehen, dann spielt er „kaltlächelnd“ seine – fast immer zutreffenden – Gedankengänge aus), zum anderen aber auch, um einen Vertrauten zu haben, der weiß, wie der „Held“ handeln würde und ihn deshalb in der oft zitierten „letzten“ Minute aus der Gefahr retten kann. Ein Held ohne Gegenstück würde schließlich langweilig und öde wirken. Dabei darf das Pendant durchaus auch „Held“ sein, in seinen
Eigenschaften an den „Haupthelden“ heranreichen und ihn auch in einigen wenigen Dingen übertreffen.
Das macht dann den „Haupthelden“, mit dem der Leser sich identifizieren kann, gleich wieder menschlicher. Mit anderen Worten: Die „Hauptfigur“ braucht einen Handlanger, der die Fehler machen darf, die vom anderen dann wieder ausgebügelt werden. Selbst verständlich muss auch die Hauptfigur hin und wieder Fehler begehen, um nicht völlig unglaubwürdig zu Autor Conan Doyle werden. Dann darf die zweite Verkörperung des Helden, die weniger „glänzende Ergänzungsperson“, beweisen, dass sie würdig ist, der Freund des Helden zu sein.
Sherlock Holmes bietet noch einige interessante Vergleichsmöglichkeiten zum Werk Karl Mays, auf die wir später eingehen werden. Er wurde in fast hundert Sprachen übersetzt und rangiert damit – wenn man den Angaben des verstorbenen Doyle-Sohnes glauben darf – direkt hinter der Bibel. Holmes regte immer wieder zu Nachdichtungen an, wie auch Mays Winnetou und Old Shatterhand. Zahlreiche Autoren griffen die Gestalt des „Superdetektivs“ auf und veränderten sie im Grunde nur geringfügig (vgl. Schmidtke, a.a.O.). Das berühmte Krimi-Team Dannay/Bennington, die gemeinsam unter dem Pseudonym „Ellery Queen“ veröffentlichen, versuchten sogar mit der Holmes-Figur die mysteriösen Morde des „Rippers“ – natürlich in fiktiver Form – aufzuklären. 1967 erschien bei Ullstein: „Sherlock Holmes gegen Jack the Ripper“, ein Roman, in dem Holmes herausfindet, dass der Ripper nach Art der Vampire zu bestimmten Zeiten mordet, um sein Leben zu verlängern (mit dem Blut der Opfer). Auch dieses Buch ist leider vergriffen.
Es wäre hier noch nachzutragen, dass Sherlock Holmes selbst Auskunft gibt, warum er überhaupt einen Begleiter braucht: „Wenn ich mich bei meinen verschiedenen kleinen Untersuchungen mit einem Gefährten belastet habe, so geschah dies nicht zufällig oder aus einer Laune heraus! Watson besitzt nun einmal ein paar beachtliche Charakterzüge, die er in seiner Bescheidenheit kaum bemerkt oder doch ebenso untertreibt, wie er meine Leistungen überschätzt. Ein Verbündeter, der unsere Schlussfolgerungen und Handlungen voraussieht, kann leicht gefährlich werden – bleibt hingegen die Zukunft ein stets gut versiegeltes Buch für ihn und stürzt ihn jede neue Entwicklung in ungläubiges Staunen, ist er ein geradezu idealer Helfer“ (zitiert aus der Geschichte „Der bleiche Soldat“, Zitat wiedergegeben im Ravensburger Taschenbuch 239, „Sherlock Holmes und Dr. Watson“).
Kurze Hinweise zu Doyle, die wir dem Handbuch der Literatur, Bl-Verlag, S. 242, entnommen haben:
Sir Arthur Conan Doyle wurde am 22. Mai 1859 in Edinburgh geboren und starb in Crowborough (Sussex) am 7. Juli 1930. Nach dem Studium der Medizin wurde Doyle praktischer Arzt in Southsea. Später unternahm er Reisen nach West-Afrika und in die
Polargegend. In den letzten Lebensjahren interessierte sich Doyle stark für den Spiritismus, über den er einige Studien veröffentlichte. Durch psychiatrische Studien angeregt, begann er Detektivromane zu schreiben, die Weltruhm erlangten; im Mittelpunkt stehen Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv, und sein Freund Dr. Watson.
Relativ unbedeutend blieben Doyles Romanzen und seine historischen Romane. Hauptwerke: A study in scarlet (R., 1887, eine der ersten Holmes-Geschichten). Abenteuer des Dr. Holmes (R., dt 1895/96). Der Hund von Basketville (R., dt. 1903). History of spiritualism (Studie 1936). Ausgabe: Sir A.C.D., Ges. Werke in Einzelausgaben, dt. Übersetzung hrsg. von N. Eme, Hamburg 1959 ff. Auf ca. 20 Bände berechnet.
Literatur: Norden, P., CD. A biography. Engl. Übers. New York 1967,
Nachtrag dazu:
Auch das Thema „Sherlock Holmes“ reizte mich immer wieder, und so habe ich für den KIBU-Verlag insgesamt sechs Holmes-Geschichten geschrieben, die später als Taschenbuch-Sammelbände in einem anderen Verlag noch einmal erschienen und teilweise auch als Hörbücher herauskamen.