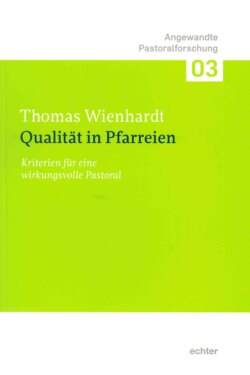Читать книгу Qualität in Pfarreien - Thomas Wienhardt - Страница 11
Оглавление1 Grundlegung: Kirche und Qualität
Im ersten Abschnitt der Grundlegung wird auf den Auftrag von Kirche eingegangen, der sich seit dem II. Vatikanischen Konzil mit dem Begriff Sakrament verbindet.
Abbildung 2: Schritt 1
Im zweiten Teil der Grundlegung wird ein Instrument eingeführt, das nachfolgend zur Anwendung kommen soll, um das weitere Vorgehen zu strukturieren. Dieses Instrument hat seinen Urspurng in einem anderen Kontext, wird aber bereits in einigen Handlungsfeldern der katholischen Kirche zum Einsatz gebracht. Es ist also naheliegend, darauf zuzugreifen. Neben einer Erläuterung und Einführung soll es auch um eine theologische Fundierung gehen.
1.1 Die Kirche und ihr Auftrag
1.1.1 Kirche als Sakrament
Kirche ist durchaus greifbar. In das Gebäude „Kirche“ kann jeder hineingehen . Man erhält einen Eindruck von dem, was Kirche sein soll, der je nach Baustil variiert. Je nach persönlichen Geschmack spricht der jeweilige Stil mehr oder weniger an.
Kirche ist auch in einem anderen Sinne greifbar. Es sind die Bilder, die über die Medien vermittelt werden. Man bekommt Amtsträger zu Gesicht oder in aktuellen Serien Klosterschwestern, mit denen man erfundene Geschichten miterleben kann. Und es sind offizielle Vertreter der Kirche vor Ort, mit denen man bei der Feier von Sakramenten oder auch bei einer Beerdigung in Kontakt kommt. Aus der Kirche können Menschen ein- aber auch austreten.
Kirche ist greifbar. Für ethische Kommissionen sind Kirchenvertreterinnen wichtige, kritisch-reflektierte Mitarbeiterinnen. Für die Entwicklungszusammenarbeit zeigt sich ein großes weltweites Netzwerk an kirchlichen Strukturen. Auch gesellschaftspolitisch ist die kirchliche Struktur territorial wie auch z. B. mit Verbänden sehr breit aufgestellt. Allein die Caritas entfaltet ein großes Gewicht, das die Gesellschaft mit gestaltet.
Kirche ist sichtbar. Sie ist da, sie agiert und wirkt, und das schon seit langer Zeit. Es gibt ein einheitliches „Gewand“, das sie erkennbar macht. Es gibt Regeln, nach denen das Miteinander intern funktioniert, Positionen und Aufgaben sind ebenfalls auszumachen. Kirche hat einen Auftrag und damit eine Mission, für die sie steht und die sie erfüllen möchte. Man kann also soziologisch festhalten, dass Kirche eine Institution unserer Gesellschaft darstellt.
Unter dieser Perspektive unterscheidet sich Kirche nicht von anderen Institutionen. Nur Auftrag und spezifisches Tun unterscheidet sie.
„Auf analoge Weise läßt sich dieses Institutionsverständnis auch auf die Kirche übertragen. Die Kirche zeigt sich in ihrem institutionellen Charakter soziologisch dort am deutlichsten, wo ihre geschichtlich gewordenen, ‘typischen’ Grundvollzüge in einem gewissen Sinn ‘formalisiert’ worden sind, wo also ihre Verkündigung und Lehre (Martyria), ihr gottesdienstlichsakramentales Leben (Liturgie) und ihr Dienst an den Armen in Gemeinde und Gesellschaft (Diakonia) eine ‘objektive’, gegenüber den einzelnen Glaubenden relativ eigenständige, allgemein verbindliche und repräsentative Form annehmen. ‘Verbindlich’ meint: Dieses Handeln bringt den Sinngehalt des Glaubens der Gemeinschaft normativ zur Geltung. ‘Repräsentativ’ besagt: Es geschieht stellvertretend und im Namen der ganzen Gemeinschaft. In solchen Handlungsweisen tritt die Kirche als Gemeinschaft im Glauben in relativer Eigenständigkeit den einzelnen Glaubenden und anderen gesellschaftlichen Gebilden in ihrer Umwelt gegenüber; hier ‘objektiviert’ sie sich in einer die einzelnen übersteigenden Form, so daß auch rechtlich gültig gesagt werden kann: Die Kirche verkündet das Evangelium, sie bekennt ihren Glauben, sie betet und feiert Gottesdienst, sie dient den Menschen, sie erläßt Normen und Weisungen usw.“ 14
Diese Wahrnehmung ist völlig richtig. Aber es ist wie bei einer Münze - es gibt genauso eine zweite Seite, deren Missachtung dazu führt, dass man die Münze als ganze nicht wahrnehmen würde.
Auch Kirche ist sozusagen „zweiseitig geprägt“. Hätte sie nur die soziologische Dimension, so könnte sie nicht die ihr eigentlich zugedachte Aufgabe erfüllen. Sie ist Teil der Gesellschaft, darin muss sie wirken. Dazu braucht sie die institutionelle Gestalt. Aber durch diese Gestalt wirkt letztlich etwas Größeres, das dahintersteht.15
Kasper verweist zur Beschreibung dieses Phänomens von Kirche auf ein Bild, das schon die Kirchenväter verwendet haben: auf den Mond. Der Mond würde nachts nicht zu sehen sein (wie das bei der Mondfinsternis der Fall ist), wenn er nicht von der Sonne beschienen würde. Dieses Licht wirft er auf die Erde zurück, er wird für unsere Augen sichtbar. So ist es auch mit der Kirche. Sie selbst leuchtet nicht von sich aus, sondern weil sich etwas auf ihr spiegelt. Zumindest sollte dieses Leuchten durch sie deutlich werden. Das ist ihr Grundmoment, sie ist ein Reflektor, sie verweist auf etwas, das über ihr steht.16 Das Konzil formuliert in Lumen Gentium zu Beginn:
„Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten (…). (LG 1)
Kirche ist „mehr“. Sie ist komplex, denn in ihr zeigt sich etwas, das sich in rechtlichen Institutionen oder Organisationen wie Parteien und Vereinen nicht zeigt. Dort geht es um geregelte Einheiten, die letztlich kollektives Handeln vereinfachen sollen. Kirche ist per se anders. Es gibt die sichtbare Seite mit ihren Regeln, der Hierarchie, den Gemeinden und Gemeinschaften, aber es gibt genauso gut das göttliche Element, das durch all diese Elemente wahrnehmbar werden soll. Die institutionelle Seite soll dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft immer mehr einem heilvollen Zustand annähert. Das Konzil beschreibt dies mit der Aussage von der komplexen Wirklichkeit:
„Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfaßt und trägt sie als solches unablässig (…); so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst (…). Deshalb ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seines Leibes (vgl. Eph 4,16) (…).“ (LG 8)
Somit ist die Zweiseitigkeit der „Münze“ ein Konstitutivum von Kirche. Wie eine Münze ist Kirche nicht schon der Zweck an sich, sondern dient einem Zweck. Sie ist ein Instrument, ein Werkzeug. Es ist da, es muss entsprechend seiner Funktion eingesetzt werden. Allein die Präsenz des Werkzeugs verweist schon auf das Veränderungspotential, das mit dem Werkzeug verbunden ist. Dies sind Bilder, die versuchen den Auftrag und die Wirklichkeit von Kirche zu beschreiben.
Kirche ist nicht nur Werkzeug, sondern auch Zeichen. Das II. Vatikanische Konzil spricht in der Beschreibung des Wesens der Kirche davon, dass Kirche „in Christus gleichsam das Sakrament“ (LG 1) ist.
„Die Übertragung des Sakramentsbegriffs vermag den klassischen Gegensatz zwischen der Vorstellung der Kirche als unsichtbarer Gnadengemeinschaft und gesellschaftlichen Gebilde zu überbrücken. Innere und äußere Dimension der Kirche verhalten sich zueinander wie die innere Wirklichkeit des Sakramentes (res sacramenti) und die äußere Zeichengestalt (sacramentum tantum). Die Kirche ist nicht eine um sich selbst kreisende und auf ihren Erhalt als gesellschaftliche Institution fixierte Religionsgesellschaft. Die Kirche ist vielmehr im Heilswillen Gottes verankert.“17
Ein Sakrament fungiert als ein Zeichen und Werkzeug und verweist auf etwas anderes, etwas, das nicht unmittelbar sichtbar ist, sondern mit einer Handlung oder einem Gegenstand verbunden ist, so wie Bilder auf Erinnerungen verweisen und Personen wieder sehr lebendig werden lassen. Ein Sakrament verweist auf die Zuneigung Gottes, es macht durch rituelles Handeln die Nähe Gottes zugänglich und erfahrbar. Kirche als Sakrament hat die Aufgabe, als ein Realsymbol auf die Gnade zu verweisen, um so Veränderung zu bewirken. Kirche ist nicht das Licht Christi selbst, sondern der Widerschein.18
Nicht die Kirche, sondern „Christus ist das Licht der Völker“ (LG 1). Sie ist „nur“ Zeichen und Werkzeug. Als Zeichen verweist sie auf die eine transzendente Wirklichkeit, auf Gott und auf sein Heilswirken. „Werkzeug“ beschreibt ihren Dienstcharakter, ihre Instrumentalität: Kirche dient dem Reich Gottes und dem von Gott für die Menschen gewollten Heil. Sie hat einen universalen Heilsauftrag für die Menschen - als „Sakrament des menschlichen Heils“ (LG 59).19 Oder anders gesagt:
„Die Existenz der Kirche ist Proexistenz. Die Kirche ist nicht für sich, sondern für andere da; Kirche gibt es um des Menschen, um der Menschen willen.“20
Kirche ist somit nicht schon das Heil oder Christus selbst, vielmehr verweist sie auf Christus. Zugleich kann das Heil durch sie gefunden werden, Christus wird durch die Kirche gegenwärtig.21 Die folgenden drei Zitate erläutern dies:
„Als ‘Sakrament’ vergegenwärtigt die Kirche die heilende Liebe Gottes in Jesus Christus ‘totum, sed non totaliter’; d. h. sie vermittelt den (geistgewirkten) Gehalt der Liebe Gottes in seiner ganzen Fülle (vgl. Eph 1,23), aber von ihrer (menschlich-endlichen und sündigen) Gestalt her nur in unvollkommener Weise. Das völlige Zusammenstimmen beider Seiten bleibt der vollendeten Gestalt des Reiches Gottes Vorbehalten.“22
„Die sakramentale Wesensbestimmung der Kirche besagt also, dass die Kirche Zeichen und Werkzeug ist für Christus und sein eschatologisches Heil. Durch sie soll das Mysterium, das Christus ist, geschichtlich aufleuchten; die Kirche soll Christus ihre Stimme, ihre Hände und ihre Herzen leihen, damit er durch sie in der Geschichte der Menschen wirksam gegenwärtig sein kann als Hoffnung auf die künftige Vollendung.“23
„Als Volk Gottes und als rechtlich-gesellschaftlich organisiertes Volk Gottes ist die Kirche aber nicht nur Heilsanstalt, sondern die Fortsetzung, die bleibende Gegenwart der heilsgeschichtlichen Aufgabe und Funktion Christi, seine Gegenwärtigkeit in der Geschichte, sein Leben, eben Kirche im eigentlichen und vollen Sinn.“24
Das Verständnis als Sakrament hebt also die komplexe Wirklichkeit von Kirche hervor.25 Mit dieser Wirklichkeit ist das Reich Gottes, das Heil für die Welt schon anfanghaft präsent, auch wenn es erst eschatologisch gesehen zur Vollendung kommt (LG 3, 5, 9).26 Auch das kann durch den Vergleich mit einem Werkzeug verständlich werden: mit dem Einsatz eines geeigneten Werkzeugs z. B. für den Hausbau wird Stein für Stein das Ziel vollendet. „Sakrament“ ist mit Kasper ein „begriffliches Mittel“27, um auszudrücken, dass Christus der Ursprung und Bezugspunkt der Kirche ist und sie zugleich zum Dienst an den Menschen beauftragt ist.28 Der Geist wirkt dabei in der Institution, d. h. auch durch die formalisierten Vorgänge.29 Diese institutionalisierten Formen existieren von Anfang an, z. B. Taufe, aber auch Leitungsamt oder Konzilien.30
1.1.2 Der Auftrag
Nun bliebe ein Werkzeug unnütz, wenn nicht klar wäre, wofür man dieses Werkzeug gebrauchen kann. Genauso ist ein Zeichen, z. B. ein Straßenschild, unwichtig, wenn es nicht eine Aufgabe erfüllen würde. Das gilt auch für die Kirche. Die Kirche hat ihren Ursprung bei Christus und hat sich nachösterlich gesammelt, um den „umfassenden Heilswillen Gottes“31 zu verwirklichen.
„Vor allem aber wird dieses Reich offenbar in der Person Christi selbst, des Sohnes Gottes und des Menschensohnes, der gekommen ist, ‘um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die Vielen’ (Mk 10,45). Als aber Jesus nach seinem für die Menschen erlittenen Kreuzestod auferstanden war, ist er als der Herr, der Gesalbte und als der zum Priester auf immerdar Bestellte erschienen (vgl. Apg 2,36; Hebr 5,6; 7,17-21) und hat den vom Vater verheißenen Geist auf die Jünger ausgegossen (vgl. Apg 2,33). Von daher empfängt die Kirche, die mit den Gaben ihres Stifters ausgestattet ist und seine Gebote der Liebe, der Demut und der Selbstverleugnung treulich hält, die Sendung, das Reich Christi und Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. So stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar. Während sie allmählich wächst, streckt sie sich verlangend aus nach dem vollendeten Reich; mit allen Kräften hofft und sehnt sie sich danach, mit ihrem König in Herrlichkeit vereint zu werden.“ (LG 5)
Die Kirche hat also einen Auftrag, eine Mission, die sie erfüllen soll. Sie ist gesandt, um das „Reich Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen“ (LG 5).
„Aber die Kirche mit all ihren Institutionen ist ein Mittel für die Menschen, und diese sind ihr Zweck.“32
Das Werkzeug dient auf diese Weise einer Verbesserung der Zustände in der Welt. Schon für die Propheten im Alten Testament gehört die kritische Wahrnehmung des Sozialen zu ihrem Glauben. Es ist ein Gebot der Nächstenliebe, dass sich Kirche für einen positiven Fortschritt unserer Gesellschaften einsetzt. Das drückt sich auch in der Option für die Armen aus.33
„Das Ziel der Mission ist die eschatologische Einheit der Völker, die Beförderung von Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen und damit die Heraufführung der einen Welt in Frieden und Freiheit.“34
„Darum hat die Kirche von Anfang an bis zum heutigen Tag ihre Mission immer so verstanden, dass sie im pädagogischen, diakonischen und politischen Bereich am Aufbau einer humanen Welt und eines friedlichen Zusammenlebens der Menschen mitwirkt.“35
Natürlich ist die Heilssendung an den konkreten Problemen zu verwirklichen. Zugleich ist das Heil im christlichen Verständnis immer etwas Größeres, das von Gott her kommt. Indem man als Glaubender Christus nachfolgt, wird man ihm ähnlich. Man empfängt so die Liebe Gottes und kann darauf antworten. Als Glaubender ist man gleichzeitig aufgefordert, dies wieder in die Gemeinschaft zurückzugeben.36
„Erst dann, wenn die Einsammlung der ganzen dazu bereiten Menschheit zur Einheit mit Gott und untereinander geglückt ist, hat auch die Kirche ihr Ziel erreicht (…). Indem sie identisch wird mit der ganzen versöhnten Menschheit, findet sie selbst zu ihrer eigenen vollen Identität. (…) So nimmt (…) die Kirche dieses Reich in seinem ganzen Sinngehalt als durch Christus in der Welt angekommener Friedens-, Gerechtigkeits- und Lebenswille Gottes ‘realsymbolisch’ vorweg; sie darf im Vollzug der Nachfolge Jesu bereits in der Geschichte die Antizipation des alle Geschichte transzendierenden und vollendenden Reiches Gottes sein.“37
Kirche ist pilgerndes Volk Gottes, eine Weggemeinschaft, die auf die Vollendung hofft, die ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Kirche ist von den Menschen in ihr geprägt, daher kann das Ziel nicht abschließend erreicht werden.38 Kirche ist Teil der Welt, sie ist kein fertiger Idealzustand, sondern auf dem Weg. Das endgültige Heil bleibt also unerreicht und kann erst letztlich durch das göttliche Element geschenkt werden.39
„Die Kirche steht im Zeichen des schon erschienenen und doch noch nicht vollendeten Heils. Die Einheit, der Friede und die Versöhnung mit Gott und der Menschen untereinander (…) sind in der Kirche in vorläufiger und antizipatorischer Weise schon präsent, und sie sollen durch die Kirche als Zeichen und Werkzeug allen Menschen zuteil werden.“40
Das Werkzeug „Kirche“ hört zu diesem Zweck zunächst auf das Wort Gottes, um dann die Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Liturgie, Verkündigung und Diakonie sind dazu wichtige Handlungsbereiche, um die Liebe Gottes den Menschen zuteil werden zu lassen.
„Die Liebe Gottes wird in Jesu Proexistenz offenbar; sie ist Gottes innerstes Wesen. (.,.,) Liebe kann ja nicht bei sich selber bleiben; (…) sie will sich selbst verströmen und sich selbst mitteilen. (…) das Heil, welches die Kirche bezeugt, ist Gottes Selbstmitteilung; es ist Gott selbst und die Gemeinschaft mit ihm (…).“41>
Der Auftrag an die Kirche geht also vom Beispiel Jesu aus, der selbst mit seinem Leben und seiner Hingabe für andere ein leuchtendes Beispiel gegeben hat, dem die Glaubenden nachzufolgen aufgerufen sind. Die Mission der Kirche lebt also von und aus der Liebe Gottes, die den Menschen zuteil werden soll. Das Reich Gottes und seine Herrlichkeit sind wünschenswerte Idealzustände, die es lohnt anzustreben.42 Sie enthalten einen wesentlichen Mehrwert, der das Leben erst richtig erfüllt.
„Deshalb ist die der Kirche aufgetragene Mission Epiphanie der Herrschaft und Herrlichkeit Gottes in der Geschichte.“43
„Sie soll die Wunden heilen, welche die Entfremdungen unter den Menschen und im Menschen geschlagen haben; in ihr soll die neue Schöpfung in zeichenhafter Weise schon jetzt Sichtbar werden.“44
Als „Sakrament des universellen Heils“45 hat Kirche einen Dienst an und in der Welt zu leisten. Gott neigt sich seiner Schöpfung zu. Das war und ist in besonderer Weise mit Jesus zu erfahren. Am Beispiel Jesu wird auch deutlich, wie Kirche ihren Dienst für das Heil in der Welt umsetzen kann.46 Konkret greifbar wird dieser Auftrag mit Hilfe von theologischen Schlüsselbegriffen, die sich in der kirchlichen Praxis wiederfinden: wie z. B. „Frieden“ im Sinne einer größeren „heilen“ Ordnung, „Befreiung“ aus einer „sündhaften“ Struktur oder die „Option für die Armen“, „Hoffnung“ gegen Hoffnungslosigkeit, „Leben“ aus dem Glauben heraus gegen vielfältige Lebensgefährdungen (z. B. Orientierungslosigkeiten, Frustrationen, Manipulationen, Zwänge, aber auch die Art und Weise des Sterbens) oder auch „Heilwerden“ an Leib und Seele (als ganzheitlicher Blick auf den Menschen).47
Um den eigenen Auftrag als Kirche ausfüllen zu können, wirkt der Geist Gottes in der Kirche, wenn auch nicht nur in ihr. Die Kirche ist gefordert, die Zeichen der Zeit und die darin enthaltene Botschaft für das Wirken der Kirche stets wahrzunehmen und zu bedenken. Sie muss diese entgrenzende Kraft des Geistes immer wieder neu als Gabe empfangen und sich dadurch herausfordern lassen. Der Geist fordert immer wieder heraus, das Evangelium neu in die jeweilige Zeit und Kultur hineinzutragen.48
„Er rüttelt die Kirche auf (…), indem er Erneuerungsbewegungen anstößt, die bewährte alte Formen erneuern und neue Formen der Frömmigkeit und des geistlichen Lebens erschließen, und der Kirche, oft nach Zeiten der Krise, neu einen Weg in die Zukunft eröffnen.“49
Kirche soll ihren Auftrag in der Gesellschaft verwirklichen. Dazu ist sie Sakrament. Ihre konkreten Aufgaben können dabei vielfältig sein, um das Sich-Durchsetzen des Heilswillens Gottes zu befördern: so z. B. als einende und befriedende Kraft in der Gesellschaft aufgrund ihrer Transzendenzverwiesenheit, in ihrer Orientierungsbzw. Sinngebungsfunktion aufgrund von Jesu Tod und Auferstehung oder z. B. als ethisch-kritische Kraft mit alternativen Sichtweisen.50
1.1.3 Volk Gottes und Communio51
Nach Klinger ist das Zweite Vatikanische Konzil
„das Programm einer Ekklesiologie des Volkes Gottes.“52
Kirche als Zeichen und Werkzeug zeigt sich im Verständnis des letzten Konzils weniger als „Staat“ oder societas perfecta.53 Das II. Vatikanische Konzil spricht vom pilgernden Gottesvolk, das im Neuen Testament die alttestamentliche Volk-Gottes-Theologie aufnimmt und fortführt. Die Kirche ist dieses Volk Gottes, das universal ausgerichtet ist.54 Es ist eine Gemeinschaft, die in Gott ihren Ursprung hat, die sich im Hier und Heute zeigt und damit historisch, anfällig für sündhaftes Tun, anwesend und greifbar ist.55 Laut Bucher sprengt die Rede vom „Volk Gottes“ jede Verengung auf institutionelle Fragen und wendet sich dem Menschen zu.56
Kasper erachtet den Begriff Communio als grundlegend. Demnach ist Kirche eine Gemeinschaft, die das Wesen der Kirche näher beschreibt. Es gilt die grundsätzliche Teilhabe aller am Mysterium.57 Durch die Taufe wird der Glaubende hineingeführt in diese Gemeinschaft, dem Volk Gottes und bekommt auf diese Weise Anteil am sakramentalen Wesen der Kirche. So entsteht kirchliche Gemeinschaft, das Volk Gottes.
„Koinonia/communio bedeutet ursprünglich nämlich nicht Gemeinschaft, sondern participatio/Teilhabe, näherhin Teilhabe an den von Gott geschenkten Gütern des Heils: Teilhabe am Heiligen Geist, am neuen Leben, an der Liebe, am Evangelium, vor allem aber an der Eucharistie.“58
Alle haben aufgrund der Taufe Anteil am Propheten-, Priester- und Königsamt Jesu.59 Mit Klinger verweist gerade der Begriff „Volk Gottes“ auf die grundlegende Gleichheit der Getauften und darauf, dass Kirche gemeinsam agieren muss.60 Alle sind gesandt und sind für die Ausgestaltung der Kirche und deren Mission mitverantwortlich.61 Somit gilt eine grundsätzliche Gleichberechtigung, womit nicht unterschiedliche Rollen und Aufgaben ausgeschlossen werden.62
„Kirche wird vielmehr verstanden als die von Gott geschaffene Communio aller Menschen in der gemeinsamen Teilhabe am Glauben sowie an den Heilsmitteln und Heilsdiensten.“63
Communio ist auch eine Anfrage an den kommunikativen Stil dieser Gemeinschaft bzw. an die Art des Miteinanders. Dazu gehört das gegenseitige Wahrnehmen und Zuhören, ein gegenseitiges Ergänzen und das gemeinsame Agieren.64
Communio wird ebenfalls bezogen auf die Beziehung von Ortskirchen und Universalkirche verstanden. Die Ortskirchen sind selbst als Kirche zu verstehen, aber sie stehen in Beziehung, in Gemeinschaft mit anderen Ortskirchen. Als Ortskirche gehört sie bei relativer Selbständigkeit zu einer größeren Einheit, die sich in der katholischen Kirche durch den Primat des Papstes zeigt. Auch die Hierarchie gehört zur Communio, die ihre spezifische Aufgabe erfüllt.65
1.1.4 Grundeigenschaften (notae ecclesiae) und Grundvollzüge
Vier wichtige Eigenschaften der Kirche zeigen sich bereits im Glaubensbekenntnis, wenn von der „einen, heiligen, katholischen und apostolischen“ Kirche die Rede ist.
„Diese vier theologischen Grundeigenschaften der Kirche gelten seit der Patristik als die Erkennungszeichen der wahren Kirche Jesu Christi, die sie von allen häretischen und schismatischen Gemeinschaften unterscheidet.“66
Als solche sind sie mit Siebenrock mehr „Zielgestalt“ als bereits umgesetzte Realität, sie sind also auch eine Aufgabe.67 Sie sind „inhaltlich-theologische Grundeigenschaften“68. Sie beschreiben die universale Kirche, für die sichtbare Institution „Kirche“ sind sie Aufgabe und zeigen sich eher als Kriterien zur Reflexion des eigenen Handelns.69
Einheit
Die Redeweise von der „einen Kirche“ ist zunächst eine ontologische. Christen folgen Christus nach, sie haben Anteil am „Leib Christi“, Anteil am Volk Gottes. Das verbindet sie mit Jesus und damit mit dem Vater und untereinander. Christen bilden also eine Einheit.70
Ontologisch gesehen gilt, dass Kirche „eins ist“, also eigenständig existiert in Abgrenzung nach außen.
„Als nicht mit den anderen Seienden, mit der Welt oder seiner Umwelt einfach identisches, ist es es selbst, geht sein eigenes Sein nicht im Sein der anderen Seienden auf.“71
Zum anderen ist ontologisch eine Innenseite mitgedacht: Es gibt intern eine stimmige Einheit, eine innere Klarheit, die die Abgrenzung nach außen erst möglich macht.72 So gesehen ist ontologisch bereits das Christsein einend.
„Man kann also zunächst von einer ontologisch notwendigen Einheit aller Christen sprechen, die als solche aber nicht notwendig ihren Ausdruck finden muss in institutionell sichtbaren Gemeinden. Allerdings tendiert die Wirklichkeit dahin, sich auch zur Erscheinung zu bringen. Die Grundeinsicht in die faktisch notwendige Einheit aller Christen begründet vom Anfang des Christentums an eine Dynamik der Ortsgemeinden auf die Praxis der Einheit aller Gemeinden der bewohnte Welt, der oikoumené, hin.“73
Kirche subsistiert in den verschiedenen Ortskirchen.74 Das letzte Konzil spricht davon, dass die eine Kirche in der römisch-katholischen Kirche subsistiert.
Kirche bleibt trotz aller Spaltungen das eine Volk Gottes.75
„Hier hat das Konzil mit dem alten patristischen Modell der Kirche als ‘Communio ecclesiarum’ eine Möglichkeit eröffnet, um die vom Geist geschenkte Einheit auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Vielheit von kirchlichen Gemeinschaften zu realisieren.“76
Die katholische Kirche hat von Anfang an über formalisierte Elemente (z. B. Taufe, Eucharistie, Glaubensbekenntnis, Ämter, Synode) verfügt, mit denen sie ihre Identität und damit ihr Sein durch die Zeit hindurch deutlich machen konnte. Daraus erwächst eine Einheit. Der Geist wirkt durch solche formalisierten Strukturen, die der Einheit dienen sollen. Auch durch Charismen wirkt der Geist, deren Vielfalt einen gemeinsamen Raum bzw. Rahmen in der Kirche brauchen. Institutionelles wie Charismen können sich gegenseitig korrigieren und so den Blick auf geistreiches, heilvolles Handeln als Kirche öffnen. Die übergeordneten Institutionen ermöglichen dabei die größere Einheit. Gerade Formalisierungen haben dabei die Chance, gemeinsame Räume abzustecken, in denen ein gemeinsames Agieren möglich wird. Zugleich braucht auch die Institution Menschen mit Charisma, d. h. Begabungen, diedem Grundanliegen heute Wirkkraft verleihen.77
Heiligkeit
Die Kirche an sich besteht aus sündigen Menschen. Aber Gottes Liebe kommt durch die Kirche zum Ausdruck, besonders in den Sakramenten und hier besonders in der Eucharistie. Die Kirche hat auf diese Weise Anteil an der Heiligkeit Gottes.78
„Im Empfang dieser ‘heiligen Gaben’ konstituiert sich die Kirche als ‘Gemeinschaft der Heiligen’, als ‘Communio Sanctorum’.“79
Gemeint ist dies in Form einer Teilhabe an den Sakramenten und damit am Leib Christi. Oder anders gesagt, ist damit die „Teilhabe am Heiligen“80 gemeint, das insbesondere in den ,,‘sancta’, den heiligen Zeichen der eucharistischen Mahlgemeinschaft“81, präsent wird. Gott ist die Quelle des Heiligen. Daraus bildet sich die Gemeinschaft der Geheiligten, die aber zu einem entsprechenden Leben herausgefordert sind, wodurch die „sancta“ erst ihre Wirkung entfalten.82 Mit diesem Verständnis verbindet sich noch eine eschatologische Bedeutungsebene, indem nicht nur die lebenden Gläubigen gemeint sind, sondern auch die bereits „Vollendeten“.83
Zugleich gilt, dass Kirche durch Menschen geprägt wird und so immer der Sünde ausgesetzt ist. Entgegen dem Wunsch, die Heiligkeit im Handeln spürbar zu machen, zeigt sich stattdessen die Fehlbarkeit. Kirche erreicht nie von sich aus die endgültige Heiligkeit, um die sie sich immer wieder neu bemühen muss und wozu das Leben stets herausfordert. Kirche ist also „ecclesia semper reformanda“.84
„Z. B. manifestiert sich diese ‘strukturelle Sündigkeit’ der Kirche dann, wenn eine allgemeine Mittelmäßigkeit und Sattheitjeden radikalen, an die Wurzel der glaubenden Existenz gehenden Anruf des Evangeliums für immer mehr Gläubige fast a priori abfängt; oder wenn sich eine Kirche bzw. eine Gemeinde so sehr in einem binnenkirchlichen ‘Milieu’ einschließt und dabei in einer institutionellen Selbstgenügsamkeit aufgeht, daß sie nicht mehr wirklich offen ist für die realen Nöte der Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche (…).“85
So spricht auch das II. Vatikanische Konzil davon, dass die Kirche sündhaft ist und stets der Reinigung bedarf (LG 8). Das Wirken der Kirche kann ihre Heiligkeit verdecken und doch bleibt die Kirche das Volk Gottes, denn der Kern der Kirche ist ein heiliger. Auf das Wirken des Geistes sollte darum geachtet werden, um wieder auf die Spur des Heiligen zu kommen.86 Mit Siebenrock ist Heiligkeit unter dem konziliaren Verständnis von katholisch zu verstehen, demnach es Heiligkeit auch außerhalb der Kirche geben kann, wenn Menschen vom Geist Christi erfüllt handeln.87
Katholizität
Mit „katholisch“ im ursprünglichen Sinn ist die universale Kirche gemeint. Gott will das Heil der ganzen Schöpfung zukommen lassen;
„dazu dient ihm das (empirisch so partikuläre) Volk Gottes, (…) das schließlich in seiner universal-sakramentalen Präsenz überall anzutreffen ist, wo Menschen sich vom Geist der Liebe Gottes erfüllen lassen (…).“88
„Katholisch“ enthält demnach auch die Aufgabe, dass die Botschaft des Glaubens eine universelle Zugänglichkeit bei den Menschen erreicht. „Katholisch“ ist ein Auftrag.
Die Katholizität „ist damit jenes opus hominum, das im tripolaren Spannungsfeld zwischen göttlicher Forderung, menschlichem Versagen und göttlicher Versöhnung und Beistandsverheißung je geschichtlich neu zu gewinnen ist.“89
Die universale Kirche subsistiert laut Konzil in der katholischen Kirche, die institutioneil und sakramental in Kontinuität zur Urkirche steht (LG 8).
Nach Kehl wird die universale Kirche in Form konzentrischer Kreise gedacht, die nach außen hin einen abnehmenden Bezug zur sichtbaren Institution Kirche haben. Im Zentrum zieht letztlich Christus alles an sich und will zum Heil führen.90
Wenn Menschen den Glauben bzw. seine Grundanliegen wirklich leben, wird die universale Kirche sichtbar (Werkzeugcharakter), die größer als die sichtbare katholische Kirche zu denken ist. Dagegen kann es im Extremfall sein, dass sich die institutioneil sichtbare Kirche rein auf äußere Zeichenhaftigkeit beschränkt, weil die Mitglieder den Glauben nicht wirklich leben. Das Zeichen ist trotzdem gegeben, muss sich aber nicht zwingend im Handeln zeigen.
„Während bei der universalen Kirche die Werkzeugfunktion direkt und unmittelbar ist und die Zeichenfunktion ambivalent bleibt, ist dies bei der institutionellen Kirche gerade umgekehrt. Durch ihre institutionelle Verfasstheit und durch die ausdrückliche Verkündigung der biblischen Botschaft und Jesu Christi sowie durch die liturgische Feier der Sakramente besteht das spezifische sakramententheologische Merkmal der institutionellen Kirche gerade in der eindeutigen sakramentalen Zeichenhaftigkeit (signum). Hingegen ist die Werkzeugfunktion hier nur mittelbar, nämlich gebunden an ihre Zeichenhaftigkeit und abhängig davon, ob ihre Mitglieder auf allen Ebenen den Glauben nicht nur bekennen und verkünden (Orthodoxie), sondern auch tatkräftig leben (Orthopraxie).“91
Als „Gemeinschaft der Glaubenden“ braucht die Institution Kirche also auch „orthopraktisch Glaubende“, damit sich ihre Werkzeugfunktion ausprägt.92
Apostolizität
Kirche muss sich immer wieder neu in die Zeit hinein aktualisieren, sie bekommt ihre Identität erst im Bezug zum Ursprung, zu Christus. Darum muss Kirche an der Tradition anknüpfen, die von den Aposteln her kommt. Sie muss auf diese Weise den Kern ihres Glaubens bewahren, der über die Zeit hinweg nicht verloren gehen darf.93 Natürlich muss der Glaube im Heute neu verstanden und damit auch interpretiert werden. Glaube trifft hier auf andere Zusammenhänge, eine gewisse „Übersetzungsleistung“ ist notwendig. Apostolisch ist dies dann, wenn die Überlieferung inhaltlich authentisch bewahrt bleibt. Dazu gehört im katholischen Verständnis die Teilhabe an der apostolischen Leitungsvollmacht, d. h. die apostolische Sukzession.94 Dabei geht es nicht nur um die Lehre, sondern genauso um das Handeln im Sinne der Apostel:
„Wahrhaft apostolisch ist die Kirche erst, wenn sie in der Nachfolge der Apostel - und d. h. in der Nachfolge Jesu - lebt und wirkt, wenn sie also den ‘Aposteln’, den Erstzeugen und Erstzeuginnen und damit Jesus Christus selbst im orthopraktischen Glaubensvollzug die Treue hält.“95
Apostolizität ist insofern ein Korrektiv, das Kirche im Blick behalten muss. Lehre und Praxis brauchen den Bezug zum Ursprung.96
Grundvollzüge
Die Grundeigenschaften von Kirche sind Grundkriterien. Sie sind „Kennzeichen“ von Kirche. Im Unterschied dazu können die Grundvollzüge
„verstanden werden als Handlungsformen, in denen diese vier wesenskonstitutiven Kennzeichen in der Praxis der Kirche ihre konkrete und erfahrbare Gestalt gewinnen.“97
Diese Ausdrucksformen in der Praxis der Kirche, d.h. die Grundvollzüge, sind also wesentlicher Teil der Praxis von Kirche. Denn damit orientiert sie sich am Handeln Jesu und baut auf seine Präsenzzusagen auf (z.B. in der Weltgerichtsrede, Mt 25,31-46), in denen er sein Bei-Sein verspricht, wenn die Jünger ihm in seinem Sinne nachfolgen. Sie waren auch schon Teil der Praxis der ersten Gemeinden: Apg 2,42-45 beschreibt, dass die ersten Christen an dieser Praxis der Grundvollzüge festhielten.
„Gemeinschaft, Beten, Brechen des Brotes (d.h. Feier des Herrenmahles), Bewahrung der Lehre der Apostel und Hilfe für Bedürftige“98
waren markante Merkmale der Ur-Gemeinden. Diese Praxisformen halten sich als Orthopraxie durch: als Umsetzungsform des Glaubens der Gläubigen. Die Notae“, d. h. die Kennzeichen der Kirche, das Handeln Jesu, seine Präsenzzusagen, die urgemeindliche Praxis und die orthopraktische Umsetzung durch die Gläubigen stecken laut Haslinger die theologische Grundlage für die Bedeutung der Grundvollzüge ab.99
Die Grundvollzüge (Martyria, Leiturgia, Diakonia, Koinonia) sind gegeneinander nicht eindeutig abgrenzbar, wenngleich sie den praktisch-kirchlichen Vollzug differenzieren, und auch nicht untereinander hierarchisierbar. Sie sind zu leben, wodurch Kirche an ihrem Ursprung auch im Heute anschließt.100 Koinonia hat als Grundfunktion ihren Ansatzpunkt bei der fundamentalen Beziehung zwischen Gott und Mensch, die in der Konsequenz auch ein gelingendes, solidarisches Miteinander unter den Menschen herausfordert.101 Martyria, oder auch Verkündigung, beinhaltet die Bezeugung des Glaubens im Heute und den Versuch, das „Größere“ den Menschen verständlich wahrnehmbar zu machen. Dabei geht es nicht nur um Predigt, sondern auch um Gespräche, Katechese, Religionsunterricht, Begegnungen, Rituale, Kommunikationsformen u. v. m. Dabei sollte die Botschaft auf eine Weise erinnert werden, dass sie den Menschen anspricht und anregt.102 Leiturgia oder auch Liturgie erinnert und vergegenwärtigt das Heilsgeschehen. Liturgie ist „Feier“ der Gemeinde. Liturgie ist zentraler Raum spiritueller Vertiefung des Glaubens, an dem alle Getauften partizipieren sollen. Die gottesdienstlichen Formen müssen den Voraussetzungen der Menschen Rechnung tragen.103 Diakonischer Dienst im Sinne Jesu meint an der Seite der Armen und Benachteiligten zu stehen. Übliche Machtmechanismen müssen somit hinterfragt werden.104
Gott kommt den Menschen entgegen. Gott kann also wahr- und aufgenommen werden. Dazu gibt es verschiedene Wege, z. B. das Hören auf biblische Texte, gipfelt aber in der Feier der Eucharistie. Gläubige antworten letztlich auf die Erfahrung dieses Entgegenkommens. In der Liturgie wird die kirchliche Gemeinschaft zu dem, was sie inhaltlich ausmacht. Der Gottesdienst erinnert an Jesus und macht ihn gegenwärtig. Der Mensch erfährt Heiligung und Heilung. Daraus erwächst die Motivation, davon zu erzählen. Die Verkündigung trägt die Botschaft nach außen, sie legt also Zeugnis ab und gibt sie weiter. Im diakonischen Handeln antwortet der Gläubige auf Gott, indem er die Not der Menschen wahrnimmt und Antworten auf deren Leiden und deren Bedürftigkeit sucht. Dazu gehört sowohl ein soziales Einzelengagement als auch ein politisches Wirken. Dabei ist der Gläubige in eine Gemeinschaft (Koinonia) hereingenommen, die von einem guten Miteinander und einem guten gegenseitigen Beistehen geprägt sein sollte: einem Beachten der gegenseitigen Würde und damit des gemeinsamen Priestertums.105
1.1.5 Sakrament des Geistes - Kirche und Welt
Kirche ist gleichsam Sakrament und hat als solches eine trinitarische und damit auch eine pneumatologische Seite.106 Es ist der Geist, der uns in der Kirche Christus immerwieder neu vergegenwärtigt.
„Die Kirche ist also von ihrem Ursprung her beides: Stiftung Jesu Christi und deren Verwirklichung im Geist. Sie ist Institution und Ereignis. Sie besagt Bindung an den konkreten Ursprung und zugleich geistliche Freiheit zu deren schöpferisch-geschichtlicher Vergegenwärtigung. (…) Sie ist in einem sichtbaren menschlichen Gefüge die wirksame Gegenwart und geschichtliche Existenzform des Geistes Jesu Christi. Sie ist biblisch gesprochen ‘Bau im Heiligen Geist’ (1 Kor 3,16 f.; Eph 2,22), dogmatisch formuliert ‘Sakrament des Geistes’.“107
Kirche verweist als Sakrament auf etwas Größeres und ist auf das Reich Gottes angelegt. Sie hat eine „Mission“, einen Auftrag, der sich nach außen, zu den Menschen hin richtet.
Kirche agiert als solches nicht in einem bisher „gottlosen Lebensraum“. Dieser Rahmen ist vielmehr der Rahmen der Schöpfung Gottes, sie begegnet also Menschen,
„die Subjekte ihrer Geschichte mit Gott sind und bleiben. Die Menschen haben bereits eine Geschichte mit Gott, bevor sie vom kirchlichen Handeln in all seinen Dimensionen berührt und angesprochen werden (…).“108
Kirche ist laut Kasper gefordert, auf die schöpferische Kraft des Geistes, die auch außerhalb der Kirche wirkt, zu achten, d. h., die Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Und zugleich ist sie damit gefordert, aus diesem Geist heraus zu leben. Das ist nötig, um ihren Auftrag immer besser zu erfüllen. Weil der Geist in der gesamten Schöpfung aktiv ist, muss Kirche auf die Zeichen der Zeit wie auch auf die Entwicklungen in der Gesellschaft achten und fragen, was das für das Wirken der Kirche im Heute bedeutet.109
„Als Christen haben wir also keinen Grund, den Geist in die Mauern der Kirchen eingesperrt zu denken. Im Gegenteil, wir sollen aufmerksam hinhören auf die ‘Fremdprophetie’ des Geistes in den ‘Zeichen der Zeit’. Durch sie kann uns, wie das II. Vatikanum anerkennt, der Geist selbst den Geist des Evangeliums in neuer und tieferer Weise erschließen.“110
Der Blick auf Christus und sein Wirken hilft, das Wirken des Geistes erkennen zu können. Diese pneumatologische Sichtweise fordert zu einer positiven Beziehung von Kirche und Welt bzw. Gesellschaft heraus.
Das Konzil spricht dabei den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen ihre jeweilige Autonomie zu:
„Wenn wir unter Autonomie der irdischen Wirklichkeiten verstehen, daß die geschaffenen Dinge und auch die Gesellschaften ihre eigenen Gesetze und Werte haben, die der Mensch schrittweise erkennen, gebrauchen und gestalten muß, dann ist es durchaus berechtigt, diese Autonomie zu fordern. Das ist nicht nur eine Forderung der Menschen unserer Zeit, sondern entspricht auch dem Willen des Schöpfers. Durch ihr Geschaffensein selber nämlich haben alle Einzelwirklichkeiten ihren festen Eigenstand, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen Ordnungen, die der Mensch unter Anerkennung der den einzelnen Wissenschaften und Techniken eigenen Methode achten muß.“ (GS 36)
Die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft sind damit auch aus theologischer Sicht in ihrer Eigenständigkeit anzuerkennen. Sie sind geschaffen und daher gewollt. Sie bilden keinen Gegensatz zur Kirche. Unabhängig von ihr entfalten sie ihre eigenen Codierungen und Regeln und tragen so zur Bereicherung und Gestaltung der Gesellschaft bei. Die Selbständigkeit der Subsysteme muss in der modernen Gesellschaft als wichtige Teilfunktion zum wirkungsvollen Zusammenleben wahrgenommen werden. Durch Arbeitsteilung entfaltet die moderne Gesellschaft ihre so wichtige Leistungsfähigkeit.
Auch die Kirche kann von diesen Teilsystemen profitieren:
„Wie es aber im Interesse der Welt liegt, die Kirche als gesellschaftliche Wirklichkeit der Geschichte und als deren Ferment anzuerkennen, so ist sich die Kirche auch darüber im klaren, wieviel sie selbst der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt. Die Erfahrung der geschichtlichen Vergangenheit, der Fortschritt der Wissenschaften, die Reichtümer, die in den verschiedenen Formen der menschlichen Kultur liegen, durch die die Menschennatur immer klarer zur Erscheinung kommt und neue Wege zur Wahrheit aufgetan werden, gereichen auch der Kirche zum Vorteil.“ (GS 44)
Die Gesellschaft nützt der Kirche. Die dort erzielten Leistungen auf den verschiedenen Handlungsfeldern, u. a. der Wissenschaft, fordert Kirche nicht nur heraus, sondern hilft ihr auch weiter. Das Konzil verweist z.B. auf die Rolle der Philosophie, die immerwieder als Disziplin in Anspruch genommen wurde, um den Glauben zu verkünden. Von der Philosophie hat auch die Theologie profitiert, was zu einem tieferen Verständnis des eigenen Glaubens beitrug. So kann auch die sichtbare Institution Kirche wesentlich von den verschiedenen Disziplinen lernen.
Aus der Sicht des Konzils ist es geradezu eine Notwendigkeit, dass sich die Verkündigung inkulturiert und damit anknüpfungsfähig macht:
„Diese (…) angepaßte Verkündigung des geoffenbarten Wortes muß ein Gesetz aller Evangelisation bleiben. Denn so wird in jedem Volk die Fähigkeit, die Botschaft Christi auf eigene Weise auszusagen, entwickelt und zugleich der lebhafte Austausch zwischen der Kirche und den verschiedenen nationalen Kulturen gefördert (…).“ (GS 44)
Dazu benötigt die Kirche die Menschen, die sich mit den verschiedenen Denkformen, Institutionen oder auch Disziplinen wirklich auskennen. Kirche muss also auf Fachwissen zurückgreifen und dieses für sich fruchtbar machen. Es ist Aufgabe des ganzen Volkes Gottes, den Geist wahrzunehmen, der in den Anregungen, dem Fachwissen und den Weiterentwicklungspotentialen heutigen Wissens steckt, und es auf die Kirche anzuwenden.
„Es ist jedoch Aufgabe des ganzen Gottesvolkes, vor allem auch der Seelsorger und Theologen, unter dem Beistand des Heiligen Geistes auf die verschiedenen Sprachen unserer Zeit zu hören, sie zu unterscheiden, zu deuten und im Licht des Gotteswortes zu beurteilen, damit die geoffenbarte Wahrheit immer tiefer erfaßt, besser verstanden und passender verkündet werden kann. Dadie Kirche eine sichtbare gesellschaftliche Struktur hat, das Zeichen ihrer Einheit in Christus, sind für sie auch Möglichkeit und Tatsache einer Bereicherung durch die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens gegeben, nicht als ob in ihrer von Christus gegebenen Verfassung etwas fehle, sondern weil sie so tiefer erkannt, besser zur Erscheinung gebracht und zeitgemäßer gestaltet werden kann. Die Kirche erfährt auch dankbar, daß sie sowohl als Gemeinschaft wie auch in ihren einzelnen Kindern mannigfaltigste Hilfe von Menschen aus allen Ständen und Verhältnissen empfängt.“ (GS 44)
Dieses Fachwissen dient auch dem Engagement, das Menschen nicht direkt der Kirche, sondern der Gesellschaft und ihren Problemlagen zuteil werden lassen. Denn so wirken sie im Sinne des Reiches Gottes.
1.1.6 Grundgestalten von Kirche
Über die Zeit hinweg entwickelten sich verschiedene Grundformen kirchlicher Gemeinschaft:
„die Hausgemeinde bzw. Personalgemeinde oder Basisgemeinde, die Ortsgemeinde oder Pfarrgemeinde, die bischöfliche Ortskirche oder Teilkirche und deren Vereinigungen (Patriarchat, Bischofskonferenz, Nationalkirche, Kontinentalkirche) sowie die Gesamtkirche bzw. Weltkirche.“111
Typische Formen menschlicher Gemeinschaft werden so zu kirchlichen Orten, zu Orten der Begegnung mit Gott und werden damit auch zu Grundgestalten von Kirche, jeweils historisch konkretisiert. Jede Grundgestalt von Kirche unterscheidet sich dadurch, dass sie eine spezifische Form einer Vergemeinschaftung aufweist. Damit sie aber Kirche ist, müssen sich in jeder Grundgestalt die Grundvollzüge (zumindest prinzipiell) und die Grundeigenschaften von Kirche zeigen.112
Damit kommen die frühkirchlichen Gemeindeformen in den Blick. Das sind gerade die Hausgemeinden, die durch enge Beziehungen und gemeinsame Wertvorstellungen sowie entsprechend differenzierte Rollen geprägt waren. Die Hauskirche wurde durch die Taufe konstituiert, mit der Menschen in eine neue Gemeinschaft aufgenommen wurden. Die Liebe war das deutlichste, auch missionarische Zeichen nach außen. Mit Herrenmahl und Verkündigung waren die Hausgemeinden vollständig Kirche. Diese Grundgestalt war „Gründungszentrum und Baustein der Ortsgemeinde“.113
Daneben können als weitere Grundgestalten die (monastische) Personalgemeinde, die sich insbesondere in den klösterlichen Gemeinschaften zeigt, oder mit Wiedenhofer die aktuellen Basisgemeinden benannt werden. Neuere theologische Ansätze versuchen,
„die christliche Familie als ‘Hauskirche’ (Ecclesia domestica) zu begreifen.“114
Ortskirchen
Kirche, existent in der Welt, zeigt sich vollwertig in seinen Teilstrukturen. D. h., die Ortskirchen sind, unter der Leitung eines Bischofs, genauso Kirche wie die Gesamtkirche. Auch in den Ortsgemeinschaften zeigt sich Kirche. Dort sind in gleicher Weise die kirchlichen Grundvollzüge zu finden.
„Kirche ist zunächst überall dort, wo geglaubt wird. Da der Glaube vom Hören kommt (Röm 10,17) und in der Liebe wirksam wird (Gal 5,6), gibt es den Glauben nie in der rein privaten Existenz und in der reinen Innerlichkeit. Der Glaube ist wesentlich auf den Mitglaubenden angewiesen. (…) Am dichtesten ereignet sich diese Gemeinsamkeit des Glaubens in der Feier der Eucharistie. In der eucharistischen Mahlgemeinschaft verdichtet sich Kirche am realsten und am greifbarsten. Schließlich verwirklicht sich Kirche in der Interkommunion solcher eucharistischer Gemeinschaften und in ihrer Gemeinschaft des Glaubens und der Diakonie über die ganze Welt.“115
Gemeinde ist also auch ein Ort, an dem Kirche ganz anzutreffen ist. Hier ist Kirche konkret erfahrbar, hier ist sie wahrnehmbar. Zugleich gehört zum Kirche-Sein auch die Verbindung und die Einbindung in die gesamte Gemeinschaft der Kirche.116
„Sowohl die Universalkirche wie auch die vielen Orts- und Parikularkirchen (…) gelten im vollen Sinn als Kirche (ecclesia); allerdings nur, wenn sie in einer solchen wechselseitigen Beziehung zueinander stehen, daß sie miteinander wirklich die ‘Communio ecclesiarum’, die ‘Gemeinschaft der Kirchen’ bilden.“117
Universal- wie auch Ortskirche sind Kirche,
„so daß einerseits die Universalkirche nur ‘in und aus’ den Ortskirchen besteht (LG 23), nur in ihnen (…) ‘da ist’ (LG 26), und anderseits die Einzelkirchen nur in der kommunikativen (d. h. letztlich in Glaubens- und Eucharistiegemeinschaft miteinander stehenden) Einheit aller Kirchen ihr eigenes Kirche-sein verwirklichen.“118
Den Ortskirchen kommt es also als Aufgabe zu, Glaube vor Ort inkulturiert zu leben und die Grundvollzüge mit dem Leben der Menschen zu verbinden. Das differenziert die Ortskirchen. Zugleich müssen die Ortskirchen immer auch den Blick auf die Gesamtkirche, auf die größere Einheit gerichtet halten, auf das verbindende Miteinander.119
Gemeinde - Kirche lokal
Kirche ist Zeichen und Werkzeug. Kirche lebt in und aus ihren kleineren Einheiten und existiert nicht nur als große Einheit. Also müssen auch die kleinen Einheiten Zeichen und Werkzeug sein.
„Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen. Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess 1,5), das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen, ‘auf daß durch Speise und Blut des Herrn die ganze Bruderschaft verbunden werde’. In jedweder Altargemeinschaft erscheint unter dem heiligen Dienstamt des Bischofs das Symbol jener Liebe und jener ‘Einheit des mystischen Leibes, ohne die es kein Heil geben kann’. In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird.“ (LG 26)
Gemeinde lebt aus den Grundvollzügen kirchlichen Handelns.120 Die Gemeinden vor Ort, in denen die Grundvollzüge von Kirche präsent sind, sind also auch Kirche.121 Sie sind eine Form, mit der sich Kirche in der Geschichte verwirklicht.122 Die Pfarrei ist die kirchenrechtliche Struktur der Ortsgemeinde. Mit dieser Größe ist erst einmal eine Einheit definiert, die Kirche vor Ort deutlich und präsent macht. Sie umfasst ein bestimmtes Territorium oder eine bestimmte Personengruppe (Personalpfarrei), dessen bzw. deren Leitung durch einen Pfarrer wahrgenommen wird. Die Kirche wird so in einem Raum ansprechbar und wahrnehmbar. Sie hat einen konkreten Ort, an dem sie sich versammelt. Hier wird der christliche Glaube im Rahmen lokaler Kultur und Tradition gelebt. Hier wird in den sozialen Raum hinein interagiert. Gemeinde wird als Pfarrei und damit als Institution greifbar. Was für die Gesamtkirche gilt, gilt auch hier. Hier sind die Grundvollzüge zu finden: durch die Taufe haben die Gläubigen Anteil am Volk Gottes und werden Teil der größeren Gemeinschaft. Sie selbst sind Beteiligte. Eine Pfarrei ist Communio, weil sie eine Gemeinschaft von Glaubenden darstellt, die in Beziehung zu Gott stehen. Hier findet Sammlung statt, aber auch Sendung, damit Kirche heute ihren Auftrag erfüllt.123
„Das Ziel der Grundsendung der Kirche im Ganzen und konkret der Ortsgemeinden liegt im Heil der Menschen.“124
Das Tun der Kirche vor Ort in den Gemeinden zielt wie die Kirche gesamt auf das Heil der Menschen.125 Dabei bezieht sich Heil auf den ganzen Menschen, also sowohl auf Seele wie auch den Leib, und bezieht die soziale Dimension mit ein. Alle Getauften sind in diese Sendung eingebunden.126
Das Konzil hat den Blick auf die Ortskirche wieder geöffnet und damit den Blick auch auf die Gemeinden gerichtet. Damit kommen Basisgemeinden, Personalgemeinden oder andere Gemeinschaften in den Blick. Insbesondere die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland in den 1970er Jahren hat sich damit beschäftigt.
„Denn der einzelne Christ ist heute mehr als in früheren Zeiten darauf angewiesen, in seinem Glauben durch andere mitgetragen und bestärkt zu werden, wie er umgekehrt nur durch aktive Teilnahme am Leben einer Gemeinde zu einem reifen persönlichen Glauben kommen mag. Die Synode geht deshalb von der Erwartung aus, dass die Bildung und Erneuerung lebendiger Gemeinden eine der wichtigsten Aufgaben und Ziele der kirchlichen Reformbemühungen ist.“127
Mit Kasper geht die Gemeinsame Synode von dieser Voraussetzung aus und versucht darauf aufbauend eine Definition von „Gemeinde“:
„Die Gemeinde ist an einem bestimmten Ort oder innerhalb eines bestimmten Personenkreises die durch Wort und Sakrament begründete, durch den Dienst des Amtes geeinte und geleitete, zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst an den Menschen berufene Gemeinschaft derer, die in Einheit mit der Gesamtkirche an Jesus Christus glauben und das durch ihn geschenkte Heil bezeugen.“128
Kasper macht folgende Strukturelemente129 aus:
1. Basis der Gemeinde sind „Wort und Sakrament“130, insbesondere die Eucharistiefeier.
2. Ziel der Gemeinde: „Verherrlichung Gottes“ und „Dienst an den Menschen“.
„Zur christlichen Gemeinde gehört deshalb die Spannung zwischen Sammlung und Sendung, Aktion und Kontemplation, Offenheit und Eindeutigkeit.“131
3. Gemeinde lebt aus der „Einheit und Vielfalt aller Charismen, Dienste und Ämter“132. Dazu gehört die gegenseitige Achtung und Kooperation.
4. Das Amt steht der Gemeinde einerseits gegenüber, andererseits steht es in deren Dienst. Es muss also mit den anderen Diensten kooperieren und diese zur deren Aufgabe befähigen.133
5. Eine Gemeinde ist verortet in der Universalkirche und im Bistum und besteht darüber hinaus selbst aus Untergliederungen in Form von Gemeinschaften im Raum der Gemeinde.134
Lehmann verweist darauf, dass mit dem Begriffswechsel von Pfarrei zu Gemeinde manche Bilder von lokaler Kirche verändert wurden. Demnach wird statt einer territorialen Verwaltungseinheit der freie Zusammenschluss von Personen betont, die sich aufgrund ihres Glaubens versammeln. Damit wird Kirche in der Gemeinde vor Ort konkret greifbar als Lebensraum, in dem Personen wichtig sind und der eine Funktion für das eigene Leben wie auch im Rahmen des Sozialraums erfüllt. Statt einer starren Verwaltung wird eine lebendige Gemeinschaft beschrieben, die situativ agiert und erfahren wird. Gemeinde betont außerdem die grundlegende Gleichheit der Getauften.135
Zum soziologischen Verständnis von Gemeinde gehört mit Lehmann ein gewisser Ortsbezug und dauerhafte soziale Beziehungen. Außerdem wird damit zu rechnen sein, dass mehrere Generationen Zusammenleben. Das theologische Verständnis diesem Begriff sehr nahe, hat aber die zentrale Differenz, dass sich Gemeinde im Bekenntnis zu Jesus Christus versammelt. Ihr geht es zum einen um die Sammlung von Menschen (egal welcher Nationalität, welchen Milieus usw.) und um die Sendung, die den Heilswillen Gottes, der sich an alle Menschen richtet, weiter umsetzt bzw. voranbringt.
„Die Konstituierung der christlichen Gemeinde zielt nicht auf die Sammlung von Anhängern, sondern dahin, daß Gottes Botschaft von Frieden und Freiheit allen Menschen verkündet und zuteil wird.“136
Das schließt ein, dass die Gemeinde mit allen Gliedern zum Dienst beauftragt ist - in der Vielfalt der Zuständigkeiten und Begabungen. In jeder Gemeinde ist Kirche präsent, auch wenn die Einheit mit der Gesamtkirche konstitutiv ist und der Bischof der eigentliche Leiter der Gemeinde ist. Eine Gemeinde muss dann den Blick auf den Auftrag aus dem Evangelium dauerhaft gerichtet halten. Hier kommen die Grundvollzüge kirchlichen Handelns wieder ins Spiel. Als kirchliche Gemeinde muss sie dann dafür Sorge tragen, dass diese Dimensionen aktiv bearbeitet werden. Insofern haben sie dann auch gemeindebildende Funktion.137
Die Gemeinden bzw. Pfarreien sind vielen Herausforderungen unterworfen, die sich auch in veränderten Erwartungen der Menschen äußern. Wichtig erscheint aber, dass der Ortsbezug weiterhin eine wichtige Funktion der Gemeinde ist. Kirche und damit das Christentum wird durch die Territorialpfarrei vor Ort präsent. Trotz einer hohen Mobilität gepaart mit großen Aktions- und Lebensradien der Menschen bleibt die Wohnwelt für viele immer noch ein wichtiger Lebensschwerpunkt (z. B. für Familien, Senioren). Zugleich kann der lokale Sozialraum durch eine territoriale Struktur ganz anders im Blick bleiben. Randviertel, die ihre eigene soziale Problematik haben, können für eine dort präsente Gemeinde zu einem diakonischen Auftrag werden. In einem solchen Fall, aber auch in anderen, kann Gemeinde eine Netzwerkstelle sein, die über Angebote anderer (kirchlicher) Träger oder anderer Gemeinden informiert oder auch supplementär zu anderen Trägern Leistungen anbietet.138
„Gemeinde“ ist vielfachen Diskussionen ausgesetzt. Hier sei lediglich Haslinger kurz angeführt: Laut Haslinger müsse die Gemeinde zur Grundhaltung zurückkehren, sich in den Dienst an den Menschen zu stellen. Ervergleicht eine Gemeinde mit einer Berghütte. Sie gibt zeitlich begrenzt Obdach, versorgt und stärkt die Wanderer. Sie hilft Ihnen, Ihre Wege gehen zu können. Dazu liegen sie auf den Wegen der Menschen, die unterwegs sind. Die Hütte ist auch der Raum, in dem Wanderer zu einem Austausch untereinander kommen. Die Hüttenwirte haben eine gewisse Autorität, indem sie auf Fehlverhalten hinweisen. In besonderer Weise sind sie aber dazu da, mit der Berghütte die Wanderer zu unterstützen. Haslinger betont auf diese Weise und angesichts der Herausforderungen pluralisierter Lebenswege, dass ein einseitiges Konzentrieren auf das Bild der Pfarrfamilie (im Sinne eines ständigen Eingebunden-Seins mit maximaler Aktivität) nicht mehr an den Menschen entlang denkt und damit die „Hütte“ abseits der Wege der Menschen steht. Die Gemeinde muss weg von einer gewissen Selbstreferentialität hin zu dem, was der Dienst an den Menschen sein kann.139
1.1.7 Gemeinsames und besonderes Priestertum
Der katholischen Kirche ist eine hierarchische Ordnung eigen. Sie hat Dienstcharakter. Sie dient dem kirchlichen Grundauftrag. Außerdem hat die Hierarchie, insbesondere mit dem Bischofskollegium und dem Papst, eine einheitsstiftende Funktion.140 Die Amtsträger (Bischof, Priester, Diakon) erfüllen daher eine Funktion, agieren aber auch aufgrund sakramentaler Weihe, die nicht an eine Rolle oder Tätigkeit gebunden ist, sondern ein inneres Merkmal darstellt (absolute Ordination). Diese Weihe ist verbunden mit dem Heiligungs- (Sakramente), Lehr- (Verkündigung) und Leitungsamt (z. B. Gemeindeleitung). Dem Bischof kommt dabei die Ordinationsgewalt zu.141
Zugleich wird allen Gläubigen die gleiche Würde zugesprochen.142 Alle bilden das Volk Gottes. Alle haben Teil am Priester-, Propheten- und Königsamt Christi. Sie verfügen über einen gemeinsamen Glaubenssinn und über unterschiedliche Charismen, die die Kirche vielfältig und lebendig machen. Dieses gemeinsame Priestertum verbindet sich schließlich strukturell mit einer Stärkung des synodalen Elements in der Kirche. Dazu wurden Rätestrukturen eingeführt, um die Mitwirkung und Teilhabe der Gläubigen zu gewährleisten.143
„Die Grundstruktur der Kirche als des einen Volkes Gottes ist charismatischer Art. Innerhalb der großen und einen Gemeinschaft aller Gläubigen kommt jedem Christen sein Charisma, seine Funktion zu.“144
Das besondere Charisma des Amtes ist das der Leitung, indem es besonders die Einheit im Blick behält und die verschiedenen Charismen im Lebensraum der Kirche integrativ zusammenhält. Allein das benötigt schon einige Führungskompetenzen (z. B. kommunikative Qualitäten).145
„Das amtliche Priestertum ist das sakramental hervorgehobene Zeichen für das, was inhaltlich (…) allen Gläubigen zukommt, nämlich die Vergegenwärtigung des Heilsdienstes Christi in der Welt. Dieser allgemeinen Sendung zu dienen, sie auch strukturell wirksam zu ermöglichen und lebendig zu halten, das ist die Sendung des besonderen Priestertums in der Kirche.“146
„Weil die Kirche unaufgebbar an die Vor-gabe Jesu Christi gebunden ist, weil sie allein von seinen Gaben lebt und mit seinem ‘Amt’ betraut ist, den Menschen das Evangelium zu verkünden (Prophetenamt Jesu), sie zur Einheit zu führen (Hirtenamt Jesu) und ihnen das Heil zu vermitteln (Priesteramt Jesu), darum gibt es in ihr ein Amt, das diese allgemeine Sendung der Kirche auf besondere Weise darstellen und ihr dienen soll (LG 10-12; 20f; 31 -36).“147
Grundlage ist die Gleichheit der Getauften. Zugleich gibt es eine Vielzahl von Charismen und Diensten, die aufeinander verwiesen und aufeinander angewiesen sind. Auch das Amt hat ein spezielles Charisma, das einen eigenen Dienst und eine eigene Sendung beinhaltet.148 Gemeinde wird so aus einer Menge von Charismen heraus gestaltet, die nicht alle im Leitungsamt zu suchen sind oder konzentriert werden sollten: Verkünder, Lehrer, Seelsorger, Manager, Verwalter usw. sind entflechtbare Rollen. Vielmehr integriert Leitung die verschiedenen Charismen, leistet also einen Dienst an der Einheit. Kirche lebt als Communio also in einer Spannung und einem Miteinander von gemeinsamen und besonderen Priestertum, d. h. aus je eigenen Charismen heraus, was sich sowohl in hierarchischer Struktur als auch in synodalen Gremien niederschlägt.149
Kirche ist kein Zweck an sich, sondern dient der größeren Sache, ihrem Auftrag. Das gilt auch für das Amt, das Christus sichtbar machen soll, aber das nicht selbst schon Christus ist. Das Amt ist also „Dienst und Sendung“150: Es gibt sich für die Welt hin, es ist kein typischer „Job“, sondern fordert die Person als Ganzes in seinem Sein. Die Person wird dazu gesandt.151
Amtsträger und Laien sind also aufeinander verwiesen. LG 37 nennt hierzu einige Rechte und Pflichten, die für ein gutes Miteinander wichtig sind:
„Die Laien haben wie alle Christgläubigen das Recht, aus den geistlichen Gütern der Kirche, vor allem die Hilfe des Wortes Gottes und der Sakramente, von den geweihten Hirten reichlich zu empfangen. Und ihnen sollen sie ihre Bedürfnisse und Wünsche mit der Freiheit und dem Vertrauen, wie es den Kindern Gottes und den Brüdern in Christus ansteht, eröffnen. Entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, die sie einnehmen, haben sie die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären (…). Die Laien sollen wie alle Gläubigen das, was die geweihten Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer und Leiter in der Kirche festsetzen, in christlichem Gehorsam bereitwillig aufnehmen (…). Die geweihten Hirten aber sollen die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern. Sie sollen gern deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrauensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen und ihnen Freiheit und Raum im Handeln lassen, ihnen auch Mut machen, aus eigener Initiative Werke in Angriff zu nehmen. Mit väterlicher Liebe sollen sie Vorhaben, Eingaben und Wünsche, die die Laien vorlegen, aufmerksam in Christus in Erwägung ziehen. (…) Sie können mit Hilfe der Erfahrung der Laien in geistlichen wie in weltlichen Dingen genauer und besser urteilen.“ (LG 37)
Das Amt hat auf der Ebene der Gemeinde die Aufgabe, Geistesgaben zu fördern. Glaube lebt aus dem Hinhören und Reflektieren auf das Wort - es kann weder durch Indoktrination oder durch Abstimmung erfasst werden. Es braucht ein gemeinsames Suchen, in dem sich Amt und Gemeinde hineinbegeben. Der Hirtendienst des Amtes trägt seinen Teil durch die priesterliche Aufgabe bei, die die kommunikative, hinhörende, geistliche Führung beinhaltet, mit der es auch das gemeinsame Priestertum ermöglicht.152
1.1.8 Zusammenfassung - Damit Kirche wirkt
Pneumatologie und Eschatologie verweisen die Kirche auf das, was im Zentrum des Glaubens steht. Nicht die Kirche an sich steht im Zentrum des Glaubens. Kirche hat einen Auftrag und dient dem „Reich Gottes“.153 Der Begriff „Sakrament“ macht dies deutlich.
Wie eine Münze ist Kirche also nicht einfach nur von einer Seite aus zu betrachten, sondern weist eine gewisse Komplexität auf, die auf das Größere verweist, auf Christus. Darin gründet auch ihr Auftrag. Eine Münze hat dann einen realen Wert, wenn sie einen Nutzen generiert. Der Auftrag der Kirche ist, das Heil, das von Christus ausgeht, in die Welt zu tragen. Diesen darf sie nicht verfehlen, sonst stellt sich die Frage, welchen „Wert“ Kirche hat. Das Konzil macht an dieser Stelle deutlich, dass Kirche stets der Reinigung bedarf. Anders gesagt muss Kirche mit ihrer gesellschaftlichen Institution auftragsgemäß handeln, um die gewollte Wirkung zu erreichen. Dazu ist es wichtig, die Zeichen der Zeit wahr- und ernstzunehmen. Der Geist wirkt auch in der Schöpfung. Demnach stellt sich die Frage, welche Veränderung nötig ist, um den Auftrag in der heutigen Zeit angemessen und nah am Menschen zu erfüllen. Die Kirche sollte darauf achten, welche Potentiale in den Teilsystemen und den wissenschaftlichen Disziplinen stecken, um den Sendungsauftrag zu erfüllen. Das eigene Tun muss also reflektiert und schließlich verbessert werden, um nicht irgendeine Wirkung zu entfalten, sondern um die gesellschaftliche Seite der Kirche möglichst gut zur Wirkung zu bringen. Kirche kann nicht alles aus sich selbst heraus, die Gnade muss mitgedacht werden. Trotzdem ist die Kirche gerufen, ihre Möglichkeiten zu nutzen, damit Kirche das Licht Christi spiegeln kann.
Für das weitere Vorgehen in dieser Forschungsarbeit werden folgende Punkte als Orientierungsrahmen dienen. Sie fließen am Ende als Eckpfosten in ein Qualitätsmodell ein:
• Kirche kann nicht „irgendwie“ sein, sie muss eine Aufgabe erfüllen. Sie kann ihren Auftrag missachten, dann würde sie zwar noch für den Glauben stehen, aber ohne Wirkung oder sogar mit negativer Wirkung verbleiben. Sie würde „sündig“.
• Kirche ist auch eine weltliche Institution, die verantwortungsbewusst gestaltet werden muss.
• Kirche ist Sakrament, d. h. Zeichen und Werkzeug: sie verweist auf etwas, aber sie soll auch etwas bewegen - bei aller eschatologischen Vorläufigkeit.
• Der Auftrag ist: das Reich Gottes in der Welt entfalten, d. h., den Heilswillen Gottes in die Welt tragen und dort konkretisieren. Das kann nicht irgendwie ausgestaltet werden. Orientierung bietet das Handeln Jesu, aus der z. B. auch die Option für die Armen abgeleitet wurde. Die Verbesserung der Zustände in der Welt ist Element der Heilssendung.
• Kirche kann nicht ohne die Grundkriterien ihrer Existenz gedacht werden: „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“.
• Kirchliches Handeln bewegt sich in vier Grundvollzügen: Liturgie, Verkündigung, Diakonie und Koinonia. Das sind die zentralen Handlungsbereiche.
• Kirche als Volk Gottes sagt etwas aus über das Miteinander in der Kirche. Als Getaufte haben alle Anteil am gemeinsamen Priestertum. Sie sind Subjekte des Glaubens und des Glaubenslebens.
• Zugleich gibt es eine substantielle Rollenverteilung in der katholischen Kirche, in der ordinierte Amtsträger einen wichtigen Dienst ausübt . Ihnen kommt Leitung zu, aber auch der Heiligungs- und Lehrdienst. Das wird gerade in Gemeinden erfahrbar. Den Laien kommt aufgrund ihrer Teilhabe am Priester-, Propheten- und Königsamt ein Eigengewicht zu. Amt und Laien benötigen ein gutes Miteinander.
• Ortsgemeinden sind relativ selbständig, sind aber zugleich auf andere Gemeinden und den größeren Rahmen angewiesen (Kooperation).
• Kirche als Sakrament des Geistes macht deutlich wie wichtig auch das charismatische und damit das verändernde Element in der Kirche ist. Dinge, die von außen („Welt“) auf die Kirche einströmen, können wichtige Anregungen enthalten. Die Welt ist Schöpfung Gottes, und auch dort wirkt der Heilige Geist.
1.2 Das methodische Raster: EFQM
1.2.1 Qualitätsmanagement – ein Überblick
Qualitätsentwicklung entstammt der industriellen Produktion. Als die japanische Wirtschaft nach dem II. Weltkrieg am Boden lag, entwickelte der US-Amerikaner Deming ein Programm, um dortige Betriebe wieder konkurrenzfähig zu machen. Er war über die Jahre hinweg erfolgreich. Mit Hilfe eines Ansatzes dauerhafter Verbesserung entwickelte er ein erstes Qualitätsmanagementskonzept. Dabei betonte er den Zusammenhang zwischen Kosten und Qualität. Die japanischen Unternehmen griffen seinen Ansatz erfolgreich auf und entwickelten ihn vielfach weiter. Sie wurden zu internationalen Vorbildern, deren Konzepte mehrfach kopiert wurden. Mit dem Deming-Prize werden in Japan Unternehmen geehrt, die Qualitätsentwicklung systematisch implementieren. Die USA haben in den 1980er Jahren die Ideen aufgegriffen und eine eigene nationale Qualitätsinitiative entwickelt: das Modell des MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award), das auf sieben Kriterien beruht. In Europa wurde diese Idee Ende der 1980er Jahre aufgegriffen. Man entwickelte hier das EFQM-Modell.154
Seitdem hat sich in Europa wie auch in Deutschland vieles in Richtung Qualitätsmanagement getan. EFQM wird stetig verbessert, auch das zweite Modell, die DIN-ISO-9000-Norm wird immer wieder angepasst. Inzwischen hat Qualitätsmanagement im sozialen Bereich z. B. in sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen Einzug gehalten, wenn auch aufgrund staatlicher Anforderungen. Es entwickelten sich hier spezifische Anpassungen und Modelle, die den Rahmenbedingungen der Handlungsbereiche entsprechen sollten. So haben die Caritas wie auch die Diakonie als kirchliche Einrichtungen Modelle des Qualitätsmanagements aufgenommen und eigene Ansätze entwickelt. Selbst die Erzdiözese Freiburg hat sich mit Qualitätsentwicklung beschäftigt und bringt es im Rahmen der Visitation gezielt zum Einsatz. Dazu gibt es eigenständige Handreichungen.155
Was ist unter Qualität zu verstehen?
Wie wird Qualität definiert? Das lateinische Wort „qualitas“ heißt auf Deutsch „Beschaffenheit“ und gibt einen Hinweis auf das Verständnis von Qualität.156 Qualität nimmt den aktuellen Zustand einer Sache oder einer Leistung in den Blick. Nach der DIN-Norm wird Qualität definiert als
„Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale (…) Anforderungen (…) erfüllt (…).“157
Auch wenn es verschiedene Grundphilosophien zum Thema Qualität gibt, so kann doch diese formale Definition als gemeinsames Merkmal ausgemacht werden. Qualität bezieht sich also auf die Beschaffenheit eines Produkts oder einer Dienstleistung und ist zunächst ein neutraler Begriff, d. h., Qualität kann gut oder schlecht ausfallen. Diese Bewertung hängt vom Anwendungskontext ab, für den in irgendeiner Form geklärt sein muss, wann etwas gut ist und wann nicht (Anforderungen).
Das kann entweder anhand von Merkmalen eines Produkts objektiv festgelegt werden (produktbezogen) oder - und das ist für den Dienstleistungssektor anschlussfähiger - es wird durch die Wahrnehmung eines Kunden bestimmt (kundenbezogen), der wiederum aufgrund von Eigenschaften, die ihm wichtig sind, die Güte einer Sache oder einer Dienstleistung einschätzt. Sie ist damit nicht einfach vorhanden oder nicht, sondern muss sehr differenziert anhand von Messkriterien betrachtet werden. Qualität ist dabei nicht wie ein Naturgesetz zu verstehen. Vielmehr ist das Verständnis für Qualität ebenfalls im Fluss, da es von Standards oder Gesetzen abhängig ist. In einer Marktsituation muss also kontinuierlich Qualität justiert werden.158
Wichtig dabei ist, dass trotz der Forderung, den Kunden in die Beurteilung einer Qualität einzubeziehen (kundenbezogene Anforderungen), dieser nicht die einzige Beurteilungsdimension einer Dienstleistung sein kann. Selbstverständlich ist der Kunde eine zentrale Perspektive und dort speziell die Dimensionen „Potential“ (Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit einer Organisation), „Prozess“ (Verlauf der Dienstleistung) und „Ergebnis“. Dabei spielen Erwartungen und Einschätzungen aus der Vergangenheit eine Rolle. Neben dem Kunden wirft ein Unternehmen auch den Blick auf die Konkurrenz, woraus sich Mindeststandards ableiten lassen. Aber letztlich ist die eigene Organisationssicht entscheidend. Deren Anforderungen für die Dienstleistung und deren Bereitschaft, bestimmte Maßnahmen einzuführen, sind ebenfalls Voraussetzung, die die Qualität mitbestimmen. Laut Bruhn macht es Sinn, den Hauptaspekt auf die Kundenperspektive zu richten. Bruhns Beispiel zeigt es: Ein perfekter Flug hilft nichts, wenn der Kunde zu spät kommt. Dienstleistungen erfüllen zwar häufig „produktbezogene“ Anforderungen, aber profitieren muss letztlich der Nutzer.159 Pfarreilich würde das bedeuten, dass z. B. eine Sakramentenvorbereitung theologisch korrekt sein, aber völlig am Leben der Menschen Vorbeigehen kann.
In Abgrenzung dazu bezeichnet Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000:2005 die Maßnahmen, die getroffen werden, um eine Organisation bzgl. Qualität zu steuern. Der Begriff Qualitätssicherung (DIN EN ISO 9000:2005) bezeichnet wiederum nur einen methodischen Teil innerhalb des Qualitätsmanagements, bei dem zugesagt wird, dass auf bestimmte Qualitätsanforderungen geachtet wird. Es hat insofern eine vertrauensstiftende Funktion.160
Welche Elemente gibt es?
Eine gängige Art und Weise, um den umfassenden Qualitätsbegriff etwas mehr zu schärfen, ist die Einteilung in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (nach Donabedian):161
• Strukturqualität meint die Rahmenbedingungen, in denen sich eine Organisation bewegt. Das sind die Mittel und Ressourcen bei der betrachteten Einrichtung selbst (auch personell) oder z. B. gesetzliche Spielregeln, die für die Einrichtung gelten (so z. B. das Gesundheitssystem bei Heimen).
• Prozessqualität meint den Erstellungsvorgang zur Erbringung einer Leistung. Man kann an dieser Stelle zwischen „technischer und funktionaler Qualität“162 unterscheiden. „Technisch“ beschreibt, was in einer Organisation, z. B. einer Non-Profit-Organisation (NPO), angeboten wird. „Funktional“ meint den Vorgang einer Leistungserbringung an sich. Hier spielt z. B. das Zusammenspiel zwischen Kunde und Mitarbeitenden eine Rolle, in dem die subjektive Einschätzung wichtig ist.
• Die Ergebnisqualität nimmt die Wirkungen in den Blick. Dazu braucht es entsprechende Indikatoren, an denen die Wirkungen abgelesen werden können.
Was ist die Idee bzw. das Ziel?
Qualität im industriellen Prozess nahm anfangs die Vermeidung von Fehlern in den Blick, um so die Produktion zu verbessern. Das Konzept hat sich auf die Betrachtung einer ganzen Organisation ausgeweitet. Die „Fehler-Vermeidung“ im Sinne eines andauernden Verbesserungsprozesses steht weiterhin im Fokus. Dazu wurden gerade in Japan verschiedene Methoden und Instrumente entwickelt. Bekannt sind z. B. Six Sigma, Lean Management oder Kaizen. Nach Zink handelt es sich aber bei diesen Konzepten um Betrachtungen, die in einer Organisation nur Ausschnitte in den Blick nehmen, aber nicht das System als Ganzes - im Sinne eines umfassenden Qualitätsmanagement-Ansatzes wie es EFQM darstellt.163
„Wenn man rekapituliert, dass ein ganzheitliches Managementkonzept eine normative, eine strategische und eine operative Dimension haben sollte - und diese Dimensionen darüber hinaus durch einen horizontalen und vertikalen „Fit“ zu einem integrativen Ansatz werden müssen dann zeigt sich relativ schnell, dass alle hier vorgetragenen „Innovationen“ eher Partialkonzepte sind.“164
Total Quality Management (TQM) meint „total“, d. h., alles wird in den Blick genommen. Eine Organisation wird also nicht dadurch auf Dauer besser, dass man nur an einer Stellschraube dreht. Ein Systemansatz wird benötigt. Es muss im System verankert werden, dass es einen dauerhaften Veränderungsprozess braucht. Dazu soll die gesamte Organisation betrachtet werden.
TQM meint nicht, gewisse Qualitätsvorgaben zu übernehmen und dann in einer Organisation umzusetzen. Im Gegenteil, jede Organisation muss für sich eine passende Operationalisierung finden, die auch zum eigenen Auftrag passt. Es handelt sich bei TQM mehr um ein Führungsverständnis, das zur Anwendung kommt. Qualität ist demnach kein Ziel, sondern ein laufender Verbesserungsprozess, der ausgerichtet am Kunden und zusammen mit den Mitarbeitenden aktiv umgesetzt wird, insbesondere mit Blick auf die eigenen Leistungen.165
TQM meint also eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Mit Zink bezieht sich das auf die folgenden Blickwinkel:166
• Systemansatz: Veränderung muss das ganze System in den Blick nehmen und somit die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Elementen einer Organisation beachten. Dazu gehört die Einbettung in die Gesellschaft, aber auch der Zusammenhang zwischen Verhalten und Strukturen.
• Relevante Interessengruppen: Letztlich muss eine ganzheitliche Führungsweise alle Zielgruppen im Blick haben und für alle einen Nutzen generieren. Damit ist deren Motivation verknüpft, einen Beitrag für die Organisation zu leisten. Zink führt Kunden, Mitarbeitende, Finanziers, Partner und die Gesellschaft als Zielgruppen an.
• Nachhaltigkeit: Exzellenz bedeutet nach Zink, kurzfristige Erfolgsausrichtungen zu überwinden. Stattdessen muss es um Verantwortungsübernahme für kommende Generationen gehen.
• Zukunftsorientierung: Zur ganzheitlichen Betrachtung gehört demnach auch, sich als dauerhaft lernende Organisation auszurichten und Innovation und Verbesserung auf Dauer zu stellen. Es braucht eine Form der andauernden Reflexion, um stets nah am Auftrag entlang zu handeln.
Welche Grund-Modelle gibt es?
Im Prinzip sind gerade im deutschsprachigen Raum zwei wesentliche Modelle zu identifizieren, an denen entlang Qualitätsmanagement in einer Organisation aufgebaut werden kann: die Norm der deutschen Industrie, DIN ISO 9000, und auf der anderen Seite das europäische Modell der European Foundation for Quality Management (kurz EFQM). Zwischenzeitlich hat sich DIN ISO 9000 in den letzten Ausprägungen an EFQM angenähert.167 Nach Malorny ist die DIN-Norm mit ihrem eigenen Aufbau aber noch nicht als TQM zu sehen:
„Daher ist die Umsetzung der Normenanforderungen zwar ein erster Schritt auf dem Weg zum TQM, eine ausreichende Antwort auf das Ausschöpfen der Leistungspotenziale ist die DIN EN ISO 9000 ff. jedoch nicht.“168
Die ISO-Norm wurde zunächst als Qualitätssicherungssystem entwickelt, das auch dazu dient, rechtliche Anforderungen zur Sicherheit von Produkten zu erfüllen. Die Dokumentation von Abläufen spielt dabei eine wichtige Rolle.169 Mit Zink sollte es aber mehr darum gehen, „ob das Richtige gemacht wird“, statt nur darauf zu achten, dass „etwas richtig gemacht“ wird.170
„Das heißt: Im Vordergrund allen Handelns steht hier die Ausrichtung auf den Kunden.“171
DIN ISO 9000 kann daher eher als Qualitätssicherungssystem und weniger als Modell für Qualitätsmanagement und damit -entwicklung im Sinne eines TQM für eine gesamte Organisation verstanden werden. Die Zertifizierung eines Pflichtteils genügt nicht, um eine Organisation wirklich dauerhaft und nachhaltig fortzuentwickeln. Das Risiko besteht, dass man sich nach erfolgreicher Zertifizierung zurücklehnt und die Dinge wieder ihrem Lauf überlässt. Es muss also statt der Sicherung von Qualität vielmehr um einen dauerhaften Entwicklungs- und Verbesserungsprozess, d. h., um Qualitätsentwicklung gehen. Nur dann wird eine Organisation dauerhaft lernen.172
„Obwohl auch die DIN EN ISO 9000 ff. als modellhafter Ansatz des Qualitätsmanagements gilt, sind die erreichbaren Nutzeffekte gleichwohl eingeschränkt.“173
„Der deutlichste Unterschied hinsichtlich des TQM-Gedankens wird beim Grundsatz der Ergebnisorientierung deutlich. (…) ISO-orientiertes Qualitätsmanagement ist (…) zunächst auf die Erfüllung der Normforderungen der 9001er-Norm gerichtet, die ein ‘Mindestmaß’ darstellen.“174
Nicht nur mit Blick auf die Ergebnisorientierung ist nach Vomberg das EFQM-Modell insgesamt deutlich weitreichender als die Grundansätze des DIN EN ISO 9000 ff.175 Im Folgenden wird das Modell EFQM bevorzugt. Für pastorale Zwecke scheint es als Instrument wesentlich anknüpfungsfähiger zu sein. Es ist bereits für soziale Einrichtungen adaptiert worden, was für seine Anpassungsfähigkeit spricht.
1.2.2 Das EFQM-Modell für Excellence
Das Modell nach EFQM scheint ein hilfreicher Ansatz zu sein. Es sei an dieser Stelle näher vorgestellt.
„Das EFQM-Modell für Excellence ist eine strukturierte Methode, um einen Einblick in das Niveau der Excellence einer Organisation zu erhalten (…).
Der Zweck besteht in der Schaffung einer exzellent operierenden Organisation (‚..).“176
Das EFQM-Modell ist ein Führungsinstrument. Es betrachtet eine Organisation ganzheitlich. Dazu gehört die Erfassung eines aktuellen Standes anhand von leitenden Kriterien. Management und Organisation werden von diesem Stand ausgehend laufend verbessert.177
Hinter den leitenden Kriterien verstecken sich einige Grundkonzepte, die sich quer durch die Kriterien wiederfinden. Es handelt sich um grundlegende Herangehensweisen, die eine Organisation zur Exzellenz führen sollen. Dazu gehört die Ausrichtung am Leistungsempfänger („Kunde“), die Wertschätzung der Mitarbeitenden usw. Das Modell EFQM 2013 enthält folgende Grundkonzepte178:
• „Nutzen für den Kunden schaffen“: Eine Dienstleistung oder ein Produkt bestimmt seine Qualität wesentlich auf der Basis der Zufriedenheit des Nutzers. Der Kunde muss also mit seinen Erwartungen wahrgenommen werden. Die Organisation steht in Kontakt mit Kunden und bindet sie auch in die Entwicklung neuer Produkte mit ein. Auf Rückmeldungen wird angemessen reagiert. Allerdings stellt das nicht professionelle Standards in Frage, die in den jeweiligen Fachbereichen gelten. So muss sich der Kunde z. B. auf die Sachkenntnis eines Bankberaters oder eines Arztes verlassen können, dass er den richtigen Weg zur Erfüllung seiner Wünsche einschlägt.
• „Die Zukunft nachhaltig gestalten“: In diesem Punkt verbirgt sich die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft. Hier stehen eher langfristige Gewinne als kurzfristige Effekte im Vordergrund. Exzellente Organisationen setzen sich auch für nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Beachtung sozialer, ökologischer und ökonomischer Faktoren) ein.
• „Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln“: Ein Produkt muss hergestellt, eine Dienstleistung erbracht werden. Prozesse der Leistungserbringung haben Einfluss auf die Qualität. Wertschöpfungsketten müssen bewusst gemacht, dauerhaft bedacht und angepasst werden, um Aufwand und Qualität in ein effizientes Verhältnis zu bringen. Dazu ist es auch wichtig, auf die Kultur der Zusammenarbeit zu achten oder Ressourcen im benötigten Maße zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Partnern zusammen können eigene Fähigkeiten fortentwickelt werden.
• „Kreativität und Innovation fördern“: In einer exzellenten Organisation sind alle gefordert, für die Fortentwicklung mit innovativen Ideen einen Beitrag zu leisten. Es muss um eine kontinuierliche Verbesserung gehen, wozu es eine auf Dauer gestellte Reflexionstätigkeit braucht. Innovation und Lernen bleiben dann nicht mehr zufällig, sondern werden systematisch der Organisation eingepflanzt. Fischer verweist im Zusammenhang mit der Entwicklungsorientierung einer Organisation auf den Deming-Kreislauf, der das Grundprinzip konsequenter Entwicklung ist: plan - do - check - act (planen - umsetzen - überprüfen - verbessern).
• „Mit Vision, Inspiration und Integrität führen“: Gute Organisationen haben Führungspersonal, das die Zukunft gezielt angeht und vorbildlich, auch bezüglich Ethik und Haltungen, vorangeht. Sie binden Mitarbeitende ein und schaffen eine positive Kultur der Beteiligung und der Fortentwicklung. Sie benennen den strategischen Handlungskern und motivieren die Mitarbeitenden in der Organisation, diesen umzusetzen.
• „Veränderungen aktiv managen“: Dabei kommt es darauf an, gesellschaftliche Entwicklung abzusehen und rechtzeitig reagieren zu können. Exzellente Organisationen verfügen über Bewertungsmaßstäbe, um den eigenen Stand zu bewerten und ggf. Handlungsbedarf zu erkennen, der wiederum schnell abgedeckt wird.
• „Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein“: Die Zufriedenheit des Mitarbeitenden hat großen Einfluss auf die Qualität. Mitarbeitende werden also in ganz eigener Weise in Qualitätsmodellen beachtet. Sie werden wertgeschätzt und können aktiv mitwirken. Ihre Potentiale werden gezielt genutzt. Es wird genügend für deren Wohlbefinden gesorgt.
• „Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen“: Die Orientierung am Ergebnis ist im Qualitätsmanagement ein wichtiges Element. Dazu müssen die Ergebniskriterien klar sein, an denen sich eine Organisation orientieren soll. Die entscheidenden Faktoren und Messkriterien werden dazu festgelegt. Dies sollte so erfolgen, dass eine Organisation festmachen kann, woran es liegt, dass ein Ergebnis nicht erreicht wird. Mit diesen Ergebnissen muss systematisch gearbeitet und Konsequenzen für das Handeln der Organisation abgeleitet werden. Die Ergebniskriterien sind besonders für die Führung von hoher Relevanz.
Andere Übersichten ähneln sich im Kern dieser Aufstellung und differieren um einzelne Elemente. Im Grunde sind aber immer Kunden-, Mitarbeiter, Prozess-, Führungs- und Ergebnisorientierung enthalten.
Aufbauend auf den Grundansätzen ist als Kernstück von EFQM das Kriterienmodell hervorzuheben (siehe Abbildung 3179). Hier werden Befähiger- und Ergebniskriterien benannt, zwischen denen eine Wechselwirkung zu erwarten ist. Die Leistungserstellung („Befähiger“) wird anhand von fünf Kriterien-Bereichen („Führung“, „Strategie“, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Partnerschaften und Ressourcen“, „Prozesse, Produkte und Dienstleistungen“) erfasst, die Wirkungen oder auch Ergebnisse einer Organisation durch vier Kriterien-Bereiche („Kundenbezogene Ergebnisse“, „Mitarbeiterbezogene Ergebnisse“, „Gesellschaftsbezogene Ergebnisse“, „Schlüsselergebnisse“). Jedes Kriterium sammelt eine Reihe von Teilkriterien, die das Tun und die Wirkung konkret fassbar machen. Die Teilkriterien werden anhand von Orientierungspunkten erläutert, die als Beispiele dienen.180
Abbildung 3: EFQM-Kriterienmodell
Die Kriterien mit ihren Teilkriterien sind folgende. Zuerst wird das Kriterium kurz beschrieben, um dann die Teilkriterien zu benennen. Hier zunächst die Befähigerkriterien:
• Führung:
„Exzellente Organisationen haben Führungskräfte, welche die Zukunft konsequent gestalten und verwirklichen. Sie agieren als Vorbilder in Bezug auf geltende Werthaltungen und ethische Grundsätze und schaffen kontinuierlich Vertrauen. Sie sind flexibel und ermöglichen der Organisation, vorausschauend zu agieren und rechtzeitig zu reagieren, um anhaltenden Erfolg der Organisation zu gewährleisten.
1a. Führungskräfte entwickeln die Vision, Mission, Werte und ethischen Grundsätze und sind Vorbilder.
1b. Führungskräfte definieren, überprüfen und verbessern das Managementsystem und die Leistung der Organisation, 1c. Führungskräfte befassen sich persönlich mit externen Interessengruppen. 1d. Führungskräfte stärken zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisation eine Kultur der Excellence.
1e. Führungskräfte gewährleisten, dass die Organisation flexibel ist und Veränderungen effektiv gemanagt werden.“181
• Strategie:
„Exzellente Organisationen verwirklichen ihre Mission und erreichen ihre Vision, indem sie eine auf die Interessengruppen ausgerichtete Strategie entwickeln. Leitlinien, Pläne, Zielsetzungen und Prozesse werden entwickelt und umgesetzt, um diese Strategie zu realisieren.
2a. Die Strategie beruht auf dem Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der Interessengruppen und des externen Umfelds.
2b. Die Strategie beruht auf dem Verständnis der eigenen Leistungen und Fähigkeiten.
2c. Die Strategie und unterstützende Leitlinien werden entwickelt, überprüft und aktualisiert.
2d. Die Strategie und unterstützende Leitlinien werden kommuniziert, umgesetzt und überwacht.“182
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
„Exzellente Organisationen wertschätzen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen eine Kultur, die es erlaubt, wechselseitig nützliche Ziele für die Organisation und für die Menschen zu erreichen. Sie entwickeln die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördern Fairness und Gleichberechtigung. Sie kümmern sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie kommunizieren, belohnen und erkennen in einer Art an, die Menschen motiviert, Engagement fördert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihr Können und ihr Wissen zum Wohl der Organisation einzusetzen.
3a. Personalpläne unterstützen die Strategie der Organisation.
3b. Das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entwickelt.
3c. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln abgestimmt, werden eingebunden und zu selbständigem Handeln ermächtigt.
3d. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunizieren wirkungsvoll in der gesamten Organisation.
3e. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden belohnt, anerkannt und betreut.“183
• Partnerschaften und Ressourcen:
„Exzellente Organisationen planen und managen externe Partnerschaften, Lieferanten und eigene Ressourcen, um ihre Strategie und Leitlinien sowie die wirkungsvolle Durchführung von Prozessen zu unterstützen. Sie gewährleisten, dass sie ihren Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft wirksam steuern.
4a. Partner und Lieferanten werden zu nachhaltigem Nutzen gemanagt.
4b. Finanzen werden zum nachhaltigen Erfolg gemanagt.
4c. Gebäude, Sachmittel und Material werden zur Unterstützung der Strategie nachhaltig gemanagt.
4d. Technologie wird gemanagt, um die Realisierung der Strategie zu unterstützen.
4e. Informationen und Wissen werden gemanagt, um die effektive Entscheidungsfindung zu unterstützen und um die Fähigkeiten der Organisation aufzubauen.“184
• Prozesse, Produkte und Dienstleistungen:
„Exzellente Organisationen gestalten, lenken und verbessern Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, um Wertschöpfung für Kunden und andere Interessengruppen zu generieren.
5a. Prozesse werden gestaltet, gelenkt und verbessert, um den Nutzen für die Interessengruppen zu optimieren.
5b. Produkte und Dienstleistungen werden entwickelt, um optimale Werte für Kunden zu schaffen.
5c. Produkte und Dienstleistungen werden effektiv beworben und vermarktet.
5d. Produkte werden erstellt, geliefert und gemanagt, um den laufenden Erfolg der Organisation zu sichern.
5e. Kundenbeziehungen werden gemanagt und vertieft.“185
Unter jedem Teilkriterium findet sich eine Liste von Hinweisen, so dass genauer fassbar wird, woauf es sich beziehen kann. Das Teilkriterium ld verweist z. B. darauf, dass die Führung für Mitarbeiterinnen eine inspirierende Kraft hat und daher ihr Verhalten eine Rolle spielt. 3e hat als einen Orientierungspunkt, dass auf das rechte Verhältnis von Arbeit und Freizeit in Zeiten andauernder Erreichbarkeit zu achten ist, während 4e z. B. das kreative Potential von Netzwerken betont und 5a z. B. den Prozesseigner so stärkt, dass er selbständig Leistungserstellungsprozesse entwickeln und verbessern kann.186
Bei den Ergebniskriterien geht es durchgängig darum, dass mit Leistungsindikatoren die jeweiligen Ergebnisbereiche überprüft werden. Die Betrachtung soll dabei differenziert nach Segmenten (z. B. Kunden, Mitarbeiterinnen, Organisationsteile) erfolgen. Dabei sollten Trends in den Blick kommen, die Entwicklungen der letzten Jahre deutlich machen, woraus sich Handlungsbedarf und damit Ziele ableiten lassen. Der Vergleich mit anderen Organisationen lässt die Qualität der eigenen Ergebnisse vertieft beurteilen. Wichtig erscheint dabei, dass Ursachen für bestimmte Trends und Zusammenhänge verstanden werden, so z. B. welche Verursacher dafür sorgen oder welche Auswirkungen sich damit für andere Organisationsbereiche ableiten lassen. Das Verstehen kann für Vertrauen in künftige Leistungen sorgen.
Konkret erfasst werden die Ergebnisse in verschiedenartiger Form. Bezüglich Kunden oder Mitarbeiterinnen können Umfragen, Fokusgruppen oder Beschwerden bzw. Mitarbeitergespräche betrachtet werden. Bezüglich der Gesellschaft können das Pressemeldungen oder Rückmeldungen von der Politik sein und bezüglich der Schlüsselergebnisse sind es finanzielle oder auch nicht-finanzielle Größen. Überhaupt braucht es in jedem Fall passende Wirkungsindikatoren oder -messgrößen („Leistungsindikatoren“), die vorher identifiziert werden. Das Ziel der Exzellenz ist es, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden, der Mitarbeiterinnen, der Gesellschaft oder der Interessengruppen zu erfüllen oder zu übertreffen.187
Die „RADAR-Logik“ ermöglicht die systematische Bewertung der eigenen Organisation. Anhand dieses Vorgehens wird deutlich, inwieweit die Ergebnisse in der Strategie verankert sind, integrierte Ansätze entwickelt wurden, um anvisierte Ergebnisse zu erreichen, und das Vorgehen systematisch erfolgt, es laufend überprüft wird bzw. Lernprozesse auf Dauer geschaltet sind.188
Die Kriterien müssen in den jeweiligen Kontext einer Organisation hinein übersetzt und angepasst werden.
„Das bedeutet, dass jede Organisation für sich den Qualitätsbegriff operationalisieren und damit für die jeweiligen Zwecke anwendbar machen muss.“189
TQM ist demnach nicht nur für die Industrie und Wirtschaft relevant, sondern auch für Non-Profit-Organisationen. Qualität ist nicht nur ein Thema bei Produkten, sondern auch bei Dienstleistungen. Es muss von Organisation zu Organisation geklärt werden, wie Wirkung oder auch Leistungserstellung erfasst werden kann. Die Kriterien geben dazu bereits viele Anhaltspunkte. Letztlich können so Stärken und Schwächen wahrgenommen und geeignete Handlungsansätze gefunden werden.190
Bei Anwendung von TQM ist damit zu rechnen, dass sich positive Veränderungen einstellen. Entsprechende Effekte wurden z. B. für Firmen nachgewiesen. Allerdings wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Einführung von TQM keinen kurzfristigen Effekt bringt, sondern langfristig greift. Die Veränderung der Organisationskultur oder der Arbeitsweisen der Mitarbeiter braucht viel Zeit. Außerdem kann auch bei TQM nicht ausgeschlossen werden, dass eine Organisation falsche Entscheidungen trifft.191
„Managers that embrace TQM for quick gains will be surely disappointed. To get the benefits from TQM, one must be patient. It improves performance in the long-haul.“192
1.2.3 Kann TQM auf Kirche vor Ort angewandt werden?
Natürlich hat die Methode des Qualitätsmanagements ihren Ursprung im industriellen Bereich. Und natürlich fließen daher Ansätze, die zunächst in anderen Zusammenhängen erstellt wurden, ein. Somit müssen wir uns die Frage stellen, ob und wie eine Anwendung des Instruments EFQM, wenn auch in veränderter Form, auf die Pastoral denkbar ist. Bereits erfolgte Übertragungen im Bereich z. B. ehrenamtlicher Vorstandsarbeit in einer NPO oder durch die Caritas oder auch im Rahmen der Visitation in der Erzdiözese Freiburg legen nahe, dass angepasste TQM-Modelle anwendbar sind. Caritas und Diakonie betonen hierbei den theologischen Bezugspunkt als Grundfaktor ihrer Tätigkeit.193 Auch der Verband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) bezieht TQM als ein Mittel ein, um die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kindertageseinrichtung auf der Basis des theologischen Grundauftrags zu verbessern. Dabei wird betont, welchen Nutzen TQM für die Umsetzung des kirchlichen Auftrags hat und dass das spezifisch christlich geprägte Tun der Einrichtungen und der Gemeinden wirkungsvoller zum Tragen kommt.194
Kunden und Dienstleistungen
Beim Begriff „Kunde“ scheint sich ein Grundkonflikt zwischen dem Selbstverständnis von Kirche und Wirtschaft aufzutun.
„Erschließen der Kundenbegriff und der Dienstleistungsgedanke das Wesen pastoralen Handelns oderverschließen sie ehereinen adäquaten Zugang?“195
Nitsche und Hilberath machen darauf aufmerksam, dass begriffliche Unklarheiten zu unterschiedlichen, unausgesprochenen Verständnissen und damit zu Missverständnissen führen. Dies gelte auch für den Begriff des Kunden und damit zusammenhängend für den Begriff der Dienstleistung. Der Kundenbegriff meint keine manipulative Instrumentalisierung oder Verzweckung des Menschen, um Ziele zu erreichen. Oder, mit dem Beispiel von Nitsche/Hilberath, wer bei „Kunde“ an einen areligiösen Nutzer eines kirchlichen Rituals (z. B. bei einer Hochzeit) denkt, der sich einfach nur „bedienen“ lässt, der übersieht die Beziehung zwischen Dienstleister und Nutzer, die von einem wechselseitigen Einbringen und hoffentlich positivem Ergebnis geprägt ist, und der wird den Begriff sicherlich anders werten.196
Kirche hat auch Adressaten, an die sie sich mit ihren Leistungen und dem Heilsangebot richtet. Nach Stauss sind das ihre Kunden, egal ob es einen Markt gibt oder nicht.
„In diesem Sinne bezeichnet auch eine Kundenbeziehung keineswegs zwingend eine Markt- oder Warenverbindung, sondern die Beziehung einer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu den Leistungsempfängern.“197
Kunde meint dann die Personen, für die oder mit denen eine Leistung erbracht wird. Auch Kirche müsse es laut Stauss um eine dauerhafte Beziehung zu diesen Menschen gehen, und dazu müsse dem Beziehungsaufbau und der Kontaktpflege oder dem Wiedergewinnen oberste Priorität eingeräumt werden, was systematisch angegangen werden müsste.198
Es ist nicht gemeint, dass die Ehrlichkeit im Umgang mit den Menschen verloren geht, damit ein bestimmter Zweck erfüllt wird.199 Im Gegenteil: Diese Beziehung zum Menschen ist notwendig, um den Menschen wirklich in den Blick nehmen zu können, um den Menschen ins Zentrum kirchlichen Tuns zu rücken. Denn das Heil des Menschen ist ja der Zweck der Kirche200. Dann erst kann auch das pastorale Tun beim Menschen ankommen, der Auftrag also erfüllt werden, wenn man wie Jesus fragt: „Was soll ich Dir tun?“ (Heilung eines Blinden bei Jericho: Mk 10, 51). So wird Kirche inkulturiert in die Lebenswelt der Menschen. Nur dann werden die Kontexte der Menschen genügend beachtet.
„In der Pastoral ist die Verwendung des Kundenbegriffs hilfreich, wenn hiermit auf ein beziehungsorientiertes Handeln verwiesen wird, in dem die Orientierung an der Lebenswelt und an den Bedürfnissen der Menschen im Mittelpunkt steht (…)“201.
Auf diese Weise kann der Kundenbegriff zu einem Suchinstrument werden, das der Pastoral hilft, immer wieder neu nach den Bedürfnissen der Menschen zu fragen. Stauss erhebt in diesem Zusammenhang sogar die Anfrage an die Kirche, ob sich denn Kirche nicht für die Beziehungen zu ihren Mitgliedern interessiere:
„Warum können zwar Kunden profitorientierter Unternehmen erleben, dass sich diese (aus Eigeninteresse) um sie bemühen, an ihren Meinungen und Einschätzungen interessiert sind, sie langfristig binden oder auch wieder gewinnen wollen, während sie als Mitglieder von ‘Nonprofit-’ Kirchen oft nur deren Eigeninteresse an finanzieller Zuwendung wahrnehmen (…)?“202
Pott macht als Hauptfunktionen des Kundenmanagements deutlich:
„die Sammlung und Aufbereitung von Informationen über den Kunden, die darauf aufbauende strategische Planung der Arbeit mit dem Kunden, die Vorbereitung und Aushandlung von Vereinbarungen, einschließlich des Aufbaus entsprechender Kontaktsysteme sowie die Kontrollfunktion, die überwacht, ob die angestrebten Ziele erreicht werden konnten.“203
Ein Gläubiger, der an einem Gottesdienst teilnimmt, konsumiert kein religiöses Angebot, sondern muss selbst zum Träger der Botschaft werden. Insofern kann das nicht mit dem typischen Kunden gleichgesetzt werden, der im Supermarkt einkauft. Allerdings ist an dieser Stelle der Kundenbegriff in seiner differenzierten Form zu beachten. Denn auch der Friseur hat Kunden oder der Erlebnispädagoge, der ein Angebot für eine Gruppe durchführt. Beide setzen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, die Mitwirkung des Kunden voraus. Als „externer Faktor“ geht der Kunde damit in den Leistungserstellungsprozess mit ein. Der Kundenbegriff erscheint also auch da verwendbar, wo ohne den Kunden keine Leistung erbracht werden kann.204
Und damit sind wir bereits beim Begriff der Dienstleistung. Sie ist eine Leistung, die für oder mit dem Kunden erbracht wird. Dabei ist der Begriff in seiner Weite zu sehen. Er bezieht sich auch auf Leistungen, die den Kunden als sogenannten „externen Faktor“ in die Erstellung mit einbinden müssen. So ist eine Beratung ohne den Klienten nicht möglich. Der Kunde ist damit Ko-Produzent der Leistung. Zugleich wird daran das „Uno-actu-Prinzip“ deutlich, dass Erstellung und Nutzung der Leistung durch den Kunden zeitlich zusammenfallen (im Gegensatz z. B. zur Herstellung von Autos, die auch gelagert werden können) und dass Dienstleistungen durch immaterielle Anteile dominiert werden (z. B. Atmosphäre der Beratung). Daraus folgt, dass eine Organisation (z. B. Caritas) Fähigkeiten (Potentiale) bereit halten muss, um z. B. eine Beratung durchführen zu können. Mit dem Kunden wird dann die Dienstleistung erbracht (Prozess), um eine nutzenstiftende Wirkung (meist immateriell) beim Kunden zu erreichen (Ergebnis). Die Potential-, Prozess- und Ergebnisdimension sind typische Merkmale einer Dienstleistung.205
Im Falle der Pastoral gibt es sowohl Angebote, die man konsumieren kann (z. B. ein Vortrag), bis hin zu Angeboten, bei denen der sogenannte externe Faktor größtes Gewicht entfaltet (z. B. bei Exerzitien oder Andachten). Das Mitwirken der Gemeindemitglieder spielt eine wichtige Rolle, damit Kirche ihren Auftrag erfülltder Glaube muss von den Gläubigen selbst angeeignet und vollzogen werden. Nichtsdestoweniger liegt es an der Pfarrgemeinde, wie der Rahmen dazu gestaltet wird. Eine Andacht, bei der die Impulse nicht verstanden werden können oder die Musik falsch spielt, stellt eine Geduldsübung dar. Oder wenn Menschen im Internet nach Gottesdienstzeiten am Sonntag suchen und nach vier, fünf Klicks immer noch nicht das Gesuchte auf der Homepage der Pfarrei finden, womöglich sogar veraltete Termine, dann kann auch an diesen Rahmenbedingungen gearbeitet werden.206
Es muss also im Blick behalten werden, dass gerade im Fall der Kirche der Kunde nicht Konsument einer vorher erstellten Dienstleistung ist. In den allermeisten Fällen ist er in den Leistungserstellungsprozess mit eingebunden - mehr als das z. B. beim Friseur der Fall ist, bei dem man nur den Kopf still halten muss. Ähnlich ist es vielleicht im Schützenverein, der darauf angewiesen ist, dass die Mitglieder auch wirklich schießen, zumindest zeitweise. Vergleichbar ist eine Musikkapelle, die auf das Mitwirken der Musiker angewiesen ist. Spricht man also von Dienstleistung in einer Pfarrei, dann geht es nicht um Konsumismus.
Unter dieser Voraussetzung kann „Kunde“ für Kirche als Begriff brauchbar sein. Aber nicht im Sinne eines Menschenbildes oder einer Instrumentalisierung oder auch nur im Sinne einer reinen Konsumhaltung. Diese Reduzierung ist auch nicht das ökonomische Verständnis von „Kunde“. Kunden werden immerwieder in Produktionsprozesse eingebunden, um wirklich das Bedürfnis der Menschen zu erreichen.
Ganz allgemein gilt auch für NPOs207:
„Im Gegensatz zu Sachgütern dominiert bei NPOs der immaterielle Charakter der Verrichtung einer Leistung. (…) Dienstleistungen entziehen sich der Vorproduktion und der Lagerfähigkeit, da sie die unmittelbare Anwesenheit des Kunden bei der Inanspruchnahme erfordern. Der Beitrag des Leistungsempfängers kann situationsabhängig aus
• der Präsenz der Person oder des Objekts, an dem die Verrichtung erfolgt, und/oder
• der Integrationsfähigkeit und -Willigkeit zur Mitwirkung an der Leistungserstellung und/oder
• der Erbringung einer Eigenleistung oder der Duldung von Handlungen bestehen.“208
Damit unter diesen Voraussetzungen Qualität möglich wird, müssen von der NPO ausgehend Potentialfaktoren gestaltet werden: Personen, die zur Leistungserbringung beitragen (z. B. Kompetenz, Erfahrung, Sozialverhalten von Ehrenamtlichen); materielle Hilfsmittel und das Umfeld (z. B. Räumlichkeiten, Ästhetik, Unterlagen, Ausstattung); Prozesse,
„die ähnlich einem Drehbuch die beiden anderen Dimensionen in der Phase der Leistungserstellung sinnvoll verbinden (z. B. die Organisation, alle Abläufe und Interaktionen mit dem Patienten, die bei einem Spitalsbesuch stattfinden)“209.
Natürlich heißt eine Orientierung am Menschen nicht, dass alles gemacht wird, um den Menschen zufrieden zu stellen. Das wäre ein Missverständnis und wäre gegen den eigenen Auftrag. So ist z. B. auch das prophetische Element Teil der Kirche und beinhaltet immer wieder eine kritisch-korrigierende Kraft, was aber nicht als Abschottung gegen eine schwierige Moderne verstanden werden darf. Die kirchlichen Hilfswerke sind ein Beispiel für Sozialkritik, wenn sie immer wieder auf die Notwendigkeit veränderter Lebensweisen in den Industrieländern hinweisen und damit wahrscheinlich nicht immer auf offene Ohren stoßen.210 Zugleich ist deutlich, dass die „Kunden“ der Kirche nicht nur die sein dürfen, die Einfluss haben oder über Mittel verfügen - im Gegenteil: gerade die an den Rand Gedrängten muss Kirche in den Blick nehmen. Es gilt geeignete Wege zwischen menschlichen Wünschen bzw. Bedürfnissen und dem kirchlichen Auftrag zu finden.
Nimmt man das zusammen, dann kann mit Blick auf das Tätigkeitsfeld einer Pfarrei folgende beispielhafte Differenzierung innerhalb der Begriffe „Dienstleistung“ bzw. „Kunde“ (als „externer Faktor“) vorgenommen werden:
Abbildung 4: Anteile an der Leistungserbringung
Dieses Schaubild veranschaulicht, welches Spektrum der Begriff Dienstleistung in Abhängigkeit der Mitwirkung der einzelnen Person abdeckt. Das Beispiel „persönliches Glaubensleben“ liegt maximal in der Hand des Einzelnen. Der pfarreiliche Anteil daran ist niedrig und beschränkt sich auf einen angebotenen Rahmen. Gemeint sind hier vielmehr die Tätigkeitsbereiche einer Pfarrei, in denen es entweder eine Leistung durch die Pfarrei gibt oder die Pfarrei einen Anteil an der Leistungserbringung hat. Beim Bibelkreis hat die Pfarrei bereits einen wesentlich höheren Anteil in der Leistungserbringung. Hier wird deutlich: Mit einem landläufigen Verständnis von Dienstleistung scheint ein Bibelkreis schwer vereinbar, nicht aber mit dem hier dargestellten211. Im Bibelkreis wird ein Potential der Pfarrei (z. B. durch einen Mitarbeitenden) in die Zusammenstellung und Einrichtung eines Bibelkreises eingebracht, die Durchführung ist aber auch vom externen Faktor der Nutzer und Teilnehmenden („Kunden“ im weiten Sinne) abhängig (Prozess), und das Ziel ist, eine nutzenstiftende Wirkung für die Teilnehmenden zu generieren (Ergebnis), in diesem Fall eine spirituelle Vertiefung. Zugleich ist klar, dass die Pfarrei nicht für die innere Erfahrung der Teilnehmenden verantwortlich sein kann, sondern nur für den Rahmen, mit Hilfe dessen die spirituelle Vertiefung und die Verbindung zwischen Alltag und Schrift vorbereitet wird. Im Falle einer Trauerbegleitung hat der Begleitende neben der Bereitschaft des Trauernden, sich auf die Begleitung einzulassen, durchaus aufgrund seiner vorher ausgebildeten Kompetenz einen hohen Einfluss auf den Wert, d. h. das „Ergebnis“ der Begleitung. Hier werden entsprechende Haltungen benötigt. Agiert der Begleitende besserwisserisch, wird die Trauerbegleitung wohl eher negativ wahrgenommen. Beim Gottesdienst wirkt eine abschweifende Predigt, unverständliches Sprechen oder schlechte Musik störend. Mit dem Pfarrbrief wendet sich die Pfarrei an ihre Mitglieder. Diese Leistung liegt zum Großteil in der Hand der Mitarbeitenden der Pfarrei. Sie haben den größten Einfluss darauf, wie der Pfarrbrief nach außen wirkt. Auch ein Pfarrfest wird von Mitarbeitenden gestaltet. Ein Team bestimmt, wen es damit letztlich ansprechen will und wen nicht. Andere Beispiele könnten angeführt werden. Insgesamt zeigt sich, dass solche Leistungen für eine Qualitäts-Betrachtung relevant sind. Der Rahmen für eine spirituelle Erfahrung kann auf seine Qualität befragt werden, ebenso die Begleitung von Trauernden, die Predigt, die Sakramentenvorbereitung usw. Es liegt in der Verantwortung der pastoral Tätigen, dies nach geeigneten Kriterien zu tun.
An diesen Beispielen soll deutlich werden, dass bei richtiger Zuordnung und bei richtigem Verständnis die Perspektive Dienstleistung oder auch „Kunde“ angemessen ist. Wichtig erscheint dabei die Unterscheidung zwischen dem inneren Prozess, den niemand bewirken kann, der letztlich auch Gnadenakt bleibt und der die Disposition des Einzelnen benötigt, und dem Rahmen, für den eine Pfarrei verantwortlich ist, wenn auch je nach Dienst oder Angebot in unterschiedlicher Weise. Dieser Rahmen muss mit Blick auf die Leistungsfähigkeit (Potential), den Prozess und das Ergebnis möglichst gut gemacht werden.
Kehl betont, Kirche sei universales Heilssakrament. Er hebt damit hervor, dass Kirche durchaus auch Dienste im Sinne eines Dienstleisters zur Verfügung stelle, die nicht zwingend eine sonstige Teilhabe der Nutzer z. B. am Leben der Gemeinde benötigt. Allerdings sieht er die Gefahr, dass die religiöse Inaktivität der Christen eher ein Regelfall werden könnte. Trotzdem versteht er die kirchliche Realität als Dienstleistungsorganisation als vereinbar mit klassischer Kirchentheorie.212 Dienstleistung würde an dieser Stelle beinhalten, dass Kirche die Menschen zu religiöser Aktivität begleitet und führt.
Mit Pott, der den Begriff „Kunde“ im theologischen Kontext ausführlich betrachtet, gilt, dass die Rede vom „Kunden“ nur eine begrenzte handlungsnormierende Kraft besitzt:
„Sie beinhaltet zunächst deren formalen Charakter als Wirklichkeitserfassungsprinzipien und ist in der Theologie des Zweiten Vatikanums begründet, die dem Leben selbst, mit all seinen geschichtlichen Kontingenzen erstmals normierende Kraft für die Gestaltung kirchlichen Handelns zugesprochen hat!“213
Nach Pott ist Kundenorientierung damit ein pastorales Prinzip, das eine systematische und dauerhafte Kommunikation bzw. Kontaktaufnahme und Begegnung in gleichberechtigter Weise mit den Menschen meint und sie in ihrer vielfältigen Nähe oder Distanz zur Kirche bzw. zu den Gemeinden wahrnimmt. Dabei gibt es immer interne (Mitarbeitende) und externe Kunden, während (Dienst-)Leistungen in unterschiedlicher Weise mit den Menschen erbracht werden. Gerade im kirchlichen Kontext ist - nicht nur bei der Verwendung des Kundenbegriffs - stets das Personalitätsprinzip zu beachten, das die Menschen als Abbild Gottes wahrnimmt.214
Qualitätsmodelle können in verschiedensten gesellschaftlichen Handlungsbereichen zum Einsatz gebracht werden. Sie können auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Zugleich sind gewisse Grundmodelle enthalten (z. B. Kundenorientierung), die nicht ignoriert werden können. Die Auseinandersetzung mit den Qualitätsmodellen kann auf diese Weise zu einem produktiven und innovativen Prozess werden. Unter diesem Blickwinkel erscheint ein funktionales Verständnis des Kundenbegriffs auch auf die Gestaltung von Pastoral anwendbar. Will man kirchlich den Begriff „Kunde“ als Suchhilfe verwenden, dann steht er unter der Maßgabe, dass die ehrliche Zuwendung zu den Menschen im Vordergrund steht, er nicht als Konsument betrachtet wird und der Begriff als Instrument dient, damit Kirche den eigenen Auftrag besser verfolgen kann. Kundenorientierung ist in diesem Sinne anschlussfähig.
Gibt es „Erfolg“ in der Kirche?
Pesch nimmt aus bibeltheologischer Sicht Erfolg als eine Kategorie wahr, die das Wirken der Gemeinde bewertet. Eine Gemeinde erfüllt in diesem Sinne dann ein gewisses Anspruchsniveau, das ihr von ihrem Auftrag her vorgegeben ist und im Rahmen dessen sie die Menschen sammelt, die den „Schatz im Acker“ für sich entdeckt haben und die Welt unter dem Blickwinkel der Gottesherrschaft stellen.215
Klostermann stellt fest:
„Offenbar brauchen wir Menschen, und das sind und bleiben wir ja auch als Christen und sollen es sogar, auch so etwas wie Erfolg, was immer das auf dem pastoralen Feld auch sein mag, Bestätigung, daß unser Tun nicht völlig sinnlos ist, sondern uns befriedigt und vielleicht auch anderen hilft. Wer nur Mißerfolg erntet, wer nie und von niemandem anerkannt und bestätigt wird, wer immer nur das Gefühl hat, das, was er sagt, theologisch ausgedrückt: verkündet und pastoral tut, sei umsonst gesagt und getan, und die, die es angeht, vermögen nicht mehr zu erkennen, wozu das gut und nützlich sein soll, der verliert allmählich Mut und Kraft, der verliert seine Identität, den Boden unter den Füßen, der verzweifelt allmählich an sich selbst.“216
Ist Erfolg ist kein Name Gottes? Ist das Kreuz nicht ein Zeichen des Misserfolgs? Nach Klostermann kann das so nicht stehen bleiben, denn der Tod ist nicht der Endpunkt, sondern der Punkt einer großen Sammlung. Allerdings benennt Klostermann dazu auch ein Kriterium, um das Wachstum an Zahl zu bewerten. Demnach sind Aufbrüche der Urchristen oder der Ordensgründer eindeutig im Glauben verankert, während eine Verbreitung des Glaubens mit dem Schwert eigentlich keinen pastoralen Erfolg darstellt, da er „um jeden Preis“ erbracht wurde.217
Klostermann nimmt daneben die Diskussion um die Frage auf, ob der Erfolgsbegriff nicht letztlich ein rein soziologisches Kirchenverständnis intendiere. Seine Antwort ist, dass eine solche Betrachtungsweise eine „monophysisch-spiritualistisch verstandene Kirche“218 voraussetzt, die die weltliche Seite nicht genügend wahrnimmt und damit auch nicht Handlungsfolgen und die Verantwortung dafür ausreichend reflektiere. Kirche dürfe nicht in zwei Teile zerrissen werden: Sie ist sowohl unsichtbare und weltliche Gemeinschaft. Letztlich gelte sogar für das Wirken des Geistes, dass es sich irgendwie in der Welt niederschlagen muss. Auch Gebet und eigenes Wirken in der Welt stellen kein Gegensatzpaar dar, sondern eine Komplementarität.219
„Kirche wird hier zu einem vom Menschen gelösten und unabhängigen, abstrakten, ja divinisierten Gebilde, das keiner Reform bedürftig, ja fähig ist, das letztlich mit dem Reich Gottes identisch wird (…).“220
Der evangelische Theologe Josuttis221 reflektiert den Gebrauch des Begriffes „Erfolg“ im theologisch-kirchlichen Horizont, speziell mit Blick auf den Pfarrer. Er geht zunächst davon aus, dass in pastoralpsychologischer Perspektive Erfolg
„die Erfahrung der positiven Wirkung der eigenen Tätigkeit im Beruf, die beim Handlungssubjekt ein Gefühl der Befriedigung auslöst“222, meint.
Mit Erfolg wird dann gefasst, dass jemand etwas bewirken und Ziele erreichen kann, so z. B. dass seine Verkündigung Menschen anspricht oder dass Hilfe auch ankommt. In der sozialen Dimension bedeutet das, dass der Träger einer beruflichen Rolle wichtig ist und einen wichtigen Dienst erfüllt, sein Dienst also nicht überflüssig ist. Erfolg ist für die handelnde Person wichtig und beinhaltet Bestätigung. Das macht Josuttis z. B. für Pfarrer aus:
„Deshalb ist die Frage nach dem Erfolg eine ihm angemessene Frage und nicht einfach Ausdruck einer neurotischen oder sündhaften Ich-Sucht, sondern wesentlicher Bestandteil seines Identitätsproblems.“223
Kritische Vorbehalte sind dann anzubringen, wenn Erfolg psychologisch zur Sucht wird oder jemand sich selbst um jeden Preis durchsetzen möchte. Das gilt aber auch für die berufliche Situation gerade für Pfarrer, wenn diese Liebe und Zuwendung über die Arbeit zu erreichen suchen. Josuttis sieht es außerdem als problematisch an, dass viele Pfarrer unsicher seien, wofür sie gebraucht würden. Das könne wiederum zu einer Steigerung der Tätigkeiten in Aktivismus hinein führen. Der Heilige Geist könne an der Stelle entlasten und ermutigen: Letztlich muss Gott seine Gnade dazu schenken, und das eigene Tun macht Sinn - trotz aller Hürden.
Insgesamt bedeutet das aus Sicht Josuttis, dass die Rede von Erfolg durchaus im pastoralen Kontext Sinn hat, auch wenn man beachten muss, dass es eine theologische Relativierung gibt, da die Liebe ein Geschenk ist.
„Es gibt eine Wirkung des Handelns, die zum Handelnden gehört, ohne daß er behaupten kann, er hätte sie von sich aus hergestellt. Pastoraler Erfolg könnte darin bestehen, daß man den Segen Gottes erfährt, indem man für andere Menschen zum Segen wird.“224
Wichtig ist nach Josuttis dabei, dass Erfolg auch Begrenzung benötigt:
„Man kann nichts tun, wenn man alles tun will. Und man kann einen Realerfolg nicht wahrnehmen, wenn man sich nur den Totalerfolg wünscht. Das pastorale Leiden an der Erfolglosigkeit hängt in vielen Fällen auch mit immensen Allmachtswünschen zusammen - eigentlich müßte ich alles können, alles tun, alles sein.“225
Gabriel verweist darauf, dass die Spiritualisierung pastoralen Tuns und damit die Ablehnung von Erfolgsstandards häufig dazu führt, dass implizit Erfolgsstandards gesetzt werden, die nicht zwingend bewusst oder reflektiert sein müssen. Misserfolg wird dann u. U. uminterpretiert.226
„Ein Handeln ohne Standards des Richtigen und Erfolgreichen ist nämlich kaum denkbar. Für das Alltagshandeln ist es typisch, daß diese Standards weitgehend unbewußt bleiben und erst ins Bewußtsein treten, wenn gewohnte Handlungserfolge offensichtlich ausbleiben.“227
Mit Belok/Bischofberger ist es wichtig, dass Mitarbeitende auch Erfolgserlebnisse haben können. Für sie ist Erfolg durchaus einer der Namen Gottes, wenn man Erfolg auch nicht genauso wie in der Betriebswirtschaft messen kann. Es gilt das theologisch-kirchliche Verständnis zu klären. Erfolg ist die Frucht, die nach einer Aussaat hervorgebracht wird, auch wenn das eigentliche Wachsen der Frucht nur durch die Stärkung der Rahmenbedingungen beeinflusst werden kann.228 Mit Karrer gilt, dass Erfolg als Kategorie auch für Kirche seine Berechtigung hat:
„Kirchliches Leben und die Frage nach dem Christsein hängen mit so etwas wie Erfolg zusammen. Dabei ist an die mit der Botschaft Jesu verbundenen Verheißungen zu erinnern, an den auch ethisch verpflichtenden Aufruf zur Nachfolge Jesu, an die Perspektiven und Optionen praktischen Christen-Mutes usw. In diesem ganzen Feld ist auch die Sendung der Kirche sozusagen ‘zweckgebunden’, auf ein Ziel und auf eine Botschaft hin, die gleichsam zum ‘Erfolg’ verurteilen, nämlich zur Treue und zum Dienst an der christlichen Tiefendimension von Kirche. Nein, Kirche und Christsein sind um ihrer Sendung und Hoffnungsperspektive willen ihrem ‘Erfolg’ verpflichtet. Christsein ist keine Vertröstung auf das ‘Noch-nicht’ eines ausstehenden Jenseits, sondern schon Ernstfall im ‘Schon-Jetzt’ des Diesseits.“229
Karrer verweist deutlich darauf, dass Erfolg in diesem Zusammenhang nicht so verstanden werden darf, dass der Geist letztlich nicht mehr benötigt wird, weil der Mensch alles selbst machen könnte. Gibt es noch eine spirituelle Verankerung, die aus dem Geist Gottes atmet und frei macht, oder kommt es zu einer Art Gesetzesethik, an die man sich nur getreu halten muss, so dass man letztlich zwingend erfolgreich sein wird? Nicht Aktivismus macht erfolgreich.230
„Die Frage ist nicht, ob wir Erfolg und Wirkung erzielen dürfen oder nicht, sondern welche Erfolgsvorstellungen uns steuern und wie wir uns verhalten, wenn sich die Wirkung und die Ergebnisse unseres Bemühens und Handelns nicht im Sinne unserer Erfolgsvorstellungen einstellen und erfüllen.“231
Es kann nach Karrer also nicht darum gehen, dass Mitarbeitende nicht erfolgreich sein dürfen. Stattdessen geht es darum, dass kirchliches Handeln stets an Jesus orientiert ist. Außerdem solle Misserfolg nicht dazu führen, dass Agierende die eigene Sendung in Frage stellen oder sich lähmen oder demotivieren lassen. Vielmehr sind die Gesandten wie „Säleute“, die einen Rahmen schaffen und zugleich dem Wachstum vertrauen.232
Immer wieder wird Buber bei dieser Frage zitiert, nachdem „Erfolg keiner der Namen Gottes ist“233. Damit wird von den Zitierenden in Frage gestellt, dass Erfolg ein Begriff ist, der auf Kirche passt. Das wird z. B. auch in den Interviews deutlich, die zu dieser Studie durchgeführt wurden und auf die später ausführlich Bezug genommen wird (siehe Kapitel 3).
Dazu ist Folgendes anzumerken:
1. Offenbar wird Erfolg mit ökonomischem bzw. betriebswirtschaftlichem Erfolg assoziiert. Das kann bei Kirche nicht gemeint sein, das ist nicht deren Auftrag. Diese Assoziationen scheinen in den Interviews häufig eine Abwehr gegenüber dem Begriff „Erfolg“ hervorzurufen:
„Ich würd’s nicht immer am Erfolg messen. Das klingt auch immer so wirtschaftlich, find ich (…) so in dieserwirtschaft, dass ich da - überall hört man, Audi hat wieder, wieder das Jahresrekord über, über, überschritten (…). Und so, so können wir unsere Arbeit nicht sehen“234.
Kirche kann ggf. ihren Auftrag auch erfüllen, wenn nur einer Person wirklich geholfen wird. Auch dann ist sie möglicherweise erfolgreich. Die Beurteilung, ob es wirklich Erfolg ist, hängt an Kriterien, die man situativ anlegen muss. Das ist aber eine Frage nach geeigneten Beurteilungskriterien und stellt nicht den Begriff „Erfolg“ an sich in Frage.
In den Interviews wird der Begriff „Erfolg“ teilweise ersetzt. Es wird dann z. B. davon gesprochen, dass etwas eine „runde Sache“ ist oder dass die Leute sagen, es war schön. Oder es wird davon gesprochen, dass Pfarrei ihren Auftrag, ihren Sinn erfüllt oder auch als Kirche nachhaltig (z. B. mit Blick auf die Anzahl Ehrenamtlicher oder auf die Angebote, die Menschen wahrnehmen) wirkt.
2. Es ist sicherlich richtig, dass es in der Kirche nicht um Erfolg im Sinne von mehr Macht, mehr Besitz o. ä. gehen kann. Nichtsdestoweniger ist die Auferstehung Christi aber ein voller Erfolg. Denn er hat den Tod besiegt. Im Anschluss kam es zu einer weltweiten Bewegung. Es kann also nicht gemeint sein, dass Kirche ihr Anliegen nicht erreichen soll - im Gegenteil. So muss es Christen z. B. um die Zuwendung zu Menschen gehen, die in einer Leistungsgesellschaft eher am Rande stehen, weil sie eher erfolglos sind.
3. Erfolg kann nur mit Blick auf den Auftrag einer Organisation definiert werden. D. h., erfolgreich ist eine Institution dann, wenn sie ihren Auftrag erfüllt. Bei Kirche heißt das, dass sie ihrer Heilssendung nachkommt. Das ist das Ergebnis, das auf jeden Fall anzustreben ist, dann ist Kirche erfolgreich. Und das ist an vielen Stellen auch ein völlig anderes Verständnis von Erfolg als man es häufig gesellschaftlich versteht.
4. Möglicherweise ist häufig gar nicht gemeint, dass der Begriff „Erfolg“ für Kirche unbrauchbar ist, sondern dass Erfolg gar nicht messbar sei (s.u.).
Erfolg ist als Begriff bisher pastoral nicht verfügbar.235 Trotzdem scheint es notwendig, diese Kategorie für pastorale Mitarbeiterinnen anwendbar zu machen. In dieser Arbeit wird statt von Erfolg von Ergebnissen oder Wirkungen gesprochen, die eine Pfarrei hervorbringt und die im Gegensatz zu Erfolg zunächst neutraler Natur sind. Erfolg meint dann die Ergebnisse bzw. Wirkungen pastoraler Tätigkeit, die beschreiben, dass Kirche ihren Auftrag erfüllt. Relevante negative Wirkungen stehen somit für Misserfolg. Welche Ergebniskriterien letztlich auftragsrelevant sind, muss eine kircheninterne Diskussion entscheiden. Diese Arbeit kann lediglich das Spektrum vorhandener Kriterien herausfiltern und überprüfen.
Sind Ergebnisse in der Kirche „messbar“?
Vielfach wird unterstellt, dass die Ergebnisse, die Kirche hervorbringt, nicht messbar seien.
2009 wurden im Rahmen dieser Studie 17 Interviews mit Personen aus der pastoralen Praxis geführt. Sie wurden befragt, wie aus ihrer Sicht Pastoral sinnvoll gestaltet werden kann (ausführlich dazu Kapitel 3). Damit verbunden war die Frage, woran sich die Pastoral in den Pfarreien „messen“ lassen müsste, d. h., woran man erkennt, dass man „erfolgreich“ ist.
Erfolg und Messbarkeit wurde dort ausführlich diskutiert. Die Erkenntnisse daraus dienen zur Antwort auf die Frage, inwieweit der „Erfolg“ bzw. die Wirkung kirchlichen Handelns messbar sein kann. Dabei ist klar, dass das Wirken Gottes an sich nicht erfasst werden kann. Aber das Wirken der Kirche würde ins Leere laufen, wenn es nicht spürbar wäre.
Erkenntnisse aus Interviews
Im Rahmen der Interviews wurde von den Interviewpartnern immer wieder reflektiert, inwieweit man den Erfolg der Pastoral vor Ort überhaupt messen kann und ob Zahlen dafür ein geeignetes Instrument seien. Die Ergebnisse einer pastoralen Tätigkeit, oder auch deren „Erfolg“, schienen für manche/n Interviewpartnerin nicht überprüfbar bzw. messbar.
Zu dieser Einstellung führen verschiedene Gründe, oder es ist die Kritik an der Verwendung von Kirchgängerzahlen. Außer in einem Fall hat kein Interviewpartner wirklich ausgeschlossen, dass die Entwicklung z. B. von Teilnehmerzahlen ein Indikator für die Wirkung pfarreilicher Pastoral ist. Viel häufiger wurde dagegen überlegt, welcher Indikator für Kirche eine brauchbare Aussagequalität hat (ob z. B. Kirchgängerzahlen ein wichtiges Kriterium sein können).
Da gibt es zunächst den Typ, der nur noch negative Zahlen erwartet und sich daher das Wahrnehmen der Zahlen abgewöhnt hat:
„Die habe ich…ich habe überhaupt keine Erwartungen. So wie es ist, ja…Ich sage, ich gebe von meiner Seite das dazu und wenn es nicht angenommen ist, dass ist denen ihre Sache. (…) weil da ärgere ich mich bloß.“236
Mit der gleichen Begründung wird auch der Blick auf die Kirchgängerzahlen zurückgewiesen, obwohl es
„viel schöner ist … äh … mit der vollen Kirche den Gottesdienst zu feiern, als wie mit so vielen Lücken da drin.“
Genau der gleiche Typus erläutert aber in einem anderen Zusammenhang, wann er eine Veranstaltung als gut bewerten würde. Die gute Resonanz einer Veranstaltung hängt dann doch mit der Anzahl der Personen zusammen, oder ein Bibelabend wird abgesagt, weil es zu wenige Teilnehmer sind. Oder man bewertet es als Erfolg, dass vier Familien beim nächsten Mal wiederkommen. Auch die Klicks auf der Pfarrei-Homepage, oder dass etwas Geld hängen bleibt sind, ein Verweis auf den „Erfolg“ einer Gemeinde.
Als weiterer Grund für die Ablehnung, Zahlen in den Blick zu nehmen, wurde geäußert, dass häufig immer noch von volkskirchlichen Voraussetzungen ausgegangen wird, die so nicht mehr anzutreffen seien. Statt darauf zu schauen, wie viele kommen, sei es wichtiger, darauf zu achten, dass diejenigen in der Gemeinde etwas finden, die auf der Suche sind. Damit wurde auch abgelehnt, auf die Kirchgänger-Zahlen am Sonntag zu achten. Es könne demnach nicht darum gehen, diese Zahlen zu steigern.
„Interviewpartner: Ähm, das ist einfach, ähm, wir gehen von volkskirchlichen Voraussetzungen immer noch aus, die längst nicht mehr gegeben sind. (…) Also dass, dass Glaube durch Eltern und Familien auch, ja, weiter gelebt und getragen wird. Und, also von daher ist eigentlich die Taufe schon, ja, äh, hat kein Fundament mehr. Und, und alles Andere sind eigentlich nur Folgeerscheinungen, ja, dass wir uns bei der Erstkommunionvorbereitung so abmühen und dass dann der Abbruch ist, dass wir uns um die Firmlinge bemühen und dann ein Abbruch ist. Also … Ich denke, wir gehen von, von Voraussetzungen aus, die längst schon nicht mehr gegeben sind, also und da ist wahrscheinlich auch ganz ein großes Umdenken notwendig, also. (…) Von da her sind Zahlen jetzt nicht das Kriterium.
lnterviewer:Ja. Können Sie das Kriterium noch einmal sagen?
Interviewpartner: Ähm. Was habe ich gesagt? Dass die, die … ja, die mehr suchen, ähm, das finden in der Gemeinde.“
Allerdings äußert die gleiche Person im Interview an späterer Stelle, dass der Sonntagsgottesdienst durchaus ein Indiz dafür ist, dass sich jemand mit seinem Glauben auf den Weg gemacht hat. Dann würde der Kontakt zur Gemeinde eine Rolle spielen.
An anderer Stelle wurde Zweifel daran geäußert, dass der Glaube des Einzelnen tatsächlich mit einer Zahl erfassbar sei. Ob der Glaube wirklich vertieft wird, könne letztlich nicht erfasst werden.
„aber quantifizieren, also glaube ich, kann man das so nicht, wie stark der Glaube des Einzelnen ist und ich sage jetzt einmal, wie weit das also eine Prestigesache ist dort mitzumachen, wie weit das is… ein echtes Anliegen, weil da gibt es ja die verschiedenen menschlichen Ströme, denen wir natürlich auch unterworfen sind, das ist überhaupt keine Frage.“
Auch das eigene Tun habe keinen Zusammenhang z. B. mit Kirchgängerzahlen. Letztlich müsse man abwarten, was der „Herrgott daraus macht“. In die Menschen kann man nicht hineinschauen, es bleibt somit in der Beziehung des Einzelnen mit Gott. Als Trost für das eigene Engagement, wenn sich kein unmittelbarer Erfolg zeigt, wird auf Jesus verwiesen, dessen „Erfolg“ zunächst nicht sichtbar war:
„Er ist im Prinzip…ja wenn man es jetzt aus menschlicher Sicht betrachten würde, müsste man sagen: er ist am Kreuz gescheitert. Ist natürlich nicht der Fall, ja…“
Ein Diakon macht wiederum deutlich, warum er es vermeidet, auf Zahlen zu schauen.
„wo ich mir sicher bin, es sind vielleicht zehn dabei von denen fünfunddreißig, die, die man danach sehen wird (lacht) in der Pfarrei wieder ähm, aber es hat sich trotzdem gelohnt, diesen fünfunddreißig, sie zu begleiten (…) auf dem Weg.“
Er wehrt sich gegen die Betrachtung von Zahlen, weil er damit nicht den Blick auf die Einzelperson verlieren möchte. Es seien manchmal nur zehn Personen, die nach einer Firmvorbereitung präsent bleiben. Aber es sei wichtig, sich nicht von der geringen Zahl ablenken zu lassen, sondern trotzdem voll und ganz für sie da zu sein. Es müsse um jeden einzelnen Menschen gehen. Es gehe nicht darum, dass die Zahlen stimmen und man deswegen die Leute in die Gemeinde bringt. Die Zahl sei am Ende nicht wichtig. Zahlen werden immer wieder benötigt, aber es gebe Dinge, die wiegen mehr. So habe z. B. der Rückgang der Schülerzahl im Religionsunterricht demographische Gründe. Der Rückgang der Firmzahlen sei nicht darin begründet, dass vor Ort schlechte Arbeit gemacht wird. Es meldeten sich einfach nur noch die Hälfte an. Jammern über schlechte Zahlen sei nicht hilfreich, sondern man müsse sich über die Anwesenden freuen. Manchmal müsse etwas zurückgehen, damit Neues wachsen könne. Trotzdem bleibe die Perspektive, dass sich Leute wieder interessieren könnten, wenn die Lebendigkeit einer Gemeinde nach außen strahlt oder Menschen ein positives Erlebnis machen. Man dürfe nicht mit Druck herangehen.
„Was haben wir denn da falsch gemacht, was müssen wir da ändern? Da (…) sind wir auch nicht so, wo wir sagen ähm, da muss man jetzt mit aller Gewalt was ändern, dass die da, da länger da bleiben. (…) Das geht nicht. Ich kann keine, ich kann die Gläubigen, also zumindest diese Firmlinge nicht ähm mit Gewalt reinziehen in die Kirche. Das, das geht nicht.“
Auch diese Person arbeitete im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Zahlen, als sie erwähnte, wie viele Gruppen im Bereich Familienarbeit seit Beginn der Tätigkeit des Diakons hinzugekommen sind.
Ein Gemeindeberater verweist darauf, dass Teilnehmerzahlen ein sinnvolles Kriterium darstellen, sie aber kein ausschließliches Kriterium sein dürften. So könne es sein, dass auch ein geringer Zuspruch für eine Pfarrei wertvoll sein kann. Ergänzend müsste also gefragt werden, ob ein Angebot für eine bestimmte Gruppe hilfreich ist. Ähnliches gelte für die Anzahl der Gruppen oder Aktivitäten, die eine Gemeinde durchführt. Eine Aktion an sich sei noch kein Erfolgskriterium:
„Sondern äh geht noch einmal in die Richtung von vorhin, also eine Gemeinde, die jetzt viele Gruppen, viele Aktivitäten hat, ist meiner Meinung nach, nicht nu.., wird nicht automatisch die bessere oder die …die äh erfolgreichere, sondern äh da wäre für mich auch noch einmal entscheidend äh wie reflektiert denn zum Beispiel diese Aktionen äh auch durchgeführt werden, also die Aktion an sich ist noch kein Erfolgskriterium.“
Auch ein Priester verwies darauf, dass Statistiken durchaus wichtige Aussagen bereit halten, es aber trotzdem weiterhin wichtig sei, direkt in Kontakt mit den Menschen zu sein und so zu erfassen, wie es den Menschen geht. Der Kirchenbesuch enthalte also viele Hinweise, das allein genüge aber nicht. Kirchgängerzahlen hätten mit der Qualität der Pfarreiarbeit unmittelbar wenig zu tun. Aus seiner Sicht sind diese z. B. von der Lage der Kirche in einer Stadt abhängig und damit von der Distanz zum eigenen Wohnort. Auch andere Interviewpartner äußerten Kritik, denn gute Pfarreiarbeit spiegle sich nicht zwingend in Kirchgängerzahlen.
„Erfolgreich ist, wenn sich einfach trotz weniger Kirchenbesuchern was bewegt, wenn trotzdem Leute Interesse am Bibelabend haben.“
Eine Ehrenamtliche betont, dass es vielmehr darum geht, wie jemand im Gottesdienst anwesend ist - ob er nur aus Gewohnheit kommt oder ob er eine innere Freude verspürt, ob der Gottesdienst beflügelt. Ein besseres Signal für die Wirkung einer Pfarrei sei, dass Menschen nach einem Gottesdienst noch zusammenstehen.
Die Frage nach den Kirchgängern wird allerdings nicht einheitlich gesehen. Ein weiterer Priester möchte vom Ziel, das das Sonntagsgebot vorgibt, nicht abweichen.
„Also ich glaube schon, dass ein Indiz der Sonntagsgottesdienst ist … Ganz stark. Also, also ich glaube schon also, wenn, wenn jemand, hm, da sich auf den Weg macht, dass, dass der Sonntagsgottesdienst schon ein wichtiger Punkt ist. Also, ob das jetzt jeden Sonntag ist, oder in einem regelmäßigen Abstand, das ist eine andere Frage. Ja? … Also der Kontakt zur Gemeinde am, am Sonntag, denke ich mir, ist, ist schon, schon was Wichtiges.“
Auch Ehren- und Hauptamtliche verweisen auf die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, wenn über erfolgreiche Pfarreiarbeit gesprochen wird. Damit ist ein hoher Gottesdienstbesuch am Sonntag ein Ergebniskriterium. Weichen manche auf andere Gottesdienstorte aus, oder sind nur noch die zu finden, die nicht ausweichen können („Abstimmung mit den Füßen“), würde etwas schief laufen. Es gibt durchaus Kirchen am Sonntag, die bis auf den letzten Platz besetzt sind (z. B. bei einem Familiengottesdienst), während andere einen sehr übersichtlichen Kirchenbesuch haben.
Ehrenamtliche verweisen darauf, dass es keinerlei Zwang gäbe, z. B. am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Daraus folgerten einige, dass demnach die anwesenden Gläubigen aus Überzeugung anwesend sein müssten. Die Teilnahme am Gottesdienst wird so ein relevantes Ergebniskriterium. Dies werde insbesondere dann spürbar, wenn Menschen in einem Gottesdienst sitzen und sie sich dort nicht mehr als Gemeinde erleben, weil die Kirchgänger vereinzelt im Kirchenraum sitzen.
Am Beispiel der Kirchgängerzahlen wird bereits deutlich: Es gibt Grenzen der Verwendbarkeit dieses Kriteriums, gerade was die Interpretation angeht, aber es zeigt sich, dass es so etwas wie eine Messbarkeit gibt. Die Frage ist, welche Kriterien sich eignen. Nehmen wir noch etwas die Überlegungen der Interviewpartner wahr, dann zeigt sich erneut deutlich, dass die Messbarkeit kaum in Frage steht. In der Diskussion werden v. a. solche Ergebniskriterien in den Blick genommen, die mit Mengen arbeiten, was, wie das folgende Kapitel zeigt, nicht zwingend ist, da es auch andere Formen von Indikatoren gibt.
Ein Pfarrer erzählte das Beispiel von einem Pfarrfest und erläuterte damit, woran er festmachen würde, warum das Pfarrfest gut läuft:
„ist das größte Pfarrfest hier in der Stadt, weit und breit, ähm, wir haben also bestimmt so, ja ich denk schon so 1000 Besucher, ist also im Verhältnis jetzt auch zur, zur Pfarrgemeinde also schon sehr, sehr groß, ist auch hervorragend durchgearbeitet und wir haben über 100 ehrenamtliche Helfer dabei, die halt in verschiedenen Gruppen, (…) ähm da zuständig sind, (…) also äh das ist eine, ja, wirklich eine gigantische Sache. Ich war da selber recht beeindruckt eigentlich, geh.“
Der Pfarrer benennt, was dieses Gefühl ausmacht, dass er das Pfarrfest so gigantisch findet. Dazu gehöre natürlich die professionelle Art der Organisation, aber eben auch die massive Resonanz, die dieses Pfarrfest bei Mitwirkenden aber auch bei Besuchern auslöst, was dazu führe, dass das Pfarrfest eigentlich schon mehr ein Stadtteilfest ist. Derselbe Pfarrer nennt auch bezüglich eines Familienwochenendes die Teilnehmerzahl als einen Hinweis darauf, dass die Veranstaltung offenbar gelingt. Demnach könne auch die Teilnehmerzahl an Angeboten der Pfarrei ein Wirkungsindikator sein, auch wenn er möglicherweise nicht fürjede Veranstaltung gleich nützlich zu sein scheint. So sei ein Pfarrfest ganz anders zu bewerten als die Teilnahme an einem Bibelkreis.
Auch andere Interviewpartner nehmen Teilnehmerzahlen als einen Hinweis auf die Wirkung und die Relevanz der Veranstaltung:
„Also, ich habe schon Bibelabende gemacht, und da waren dann auch einmal fünf Leute oder so. (…) Und, das war … nicht weniger intensiv, die Veranstaltung (…) nicht weniger interessant. Ich habe auch schon Bibelabende mit 30 Leuten gehabt und natürlich verändert die Zahl grundsätzlich was an der Veranstaltung. Es wird schon anders. Und man ist schon oft auch dazu geneigt, wenn man eine Veranstaltung macht, dass man sich freut, wenn viele Leute kommen. Das beste Beispiel ist unser Zeltlager, wenn da 100 Kinder kommen jedes Jahr, ist das einfach super. Von da her spielt die Zahl schon irgendwie, irgendwie eine Rolle. … Also, ich glaube, (lacht) also ich glaube, dass man da schon irgendwie einen Ehrgeiz auch hat, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich mich engagiere, dass ich dann einen Ehrgeiz habe, dass ich da möglichst ah mehr Leute für eine Veranstaltung begeistern kann. Aber ich mache jetzt die Veranstaltung genauso gern auch mit nur fünf Leuten, sage ich einmal.“
„Ja, aber ich finde…äh…eine größere Gemeinschaft trägt irgendwer. Sonst heißt es eben auch bei KAB, bei ner Veranstaltung, ‘Mein Gott, es sind ja bloß’, was weiß ich, ‘6 oder 10 Leute’, hat man auch schon erlebt bei Vorträgen. Dann geht das große Gejammer an, warum die oder die nicht da sind und dass wir bloß so wenig sind. Also wenn es da gelingt, dass ein paar mehr da sind, irgendwo, ist das schon positiv.“
Kommen nur sechs Leute zu einer Veranstaltung, obwohl z. B. ein Verband wie eine KAB 80 Mitglieder hat, löst das Diskussionen beim Veranstalter aus, oder der Organisator ist enttäuscht.
Deutlich wird dabei, dass die Teilnehmerzahl eine Rolle spielt, auch wenn andere Bedingungen im Vordergrund stehen, wie z. B. die Qualität der Begegnung, die von den Teilnehmenden auf einem Pfarrfest als wertvoll erachtet wird. Der Zulauf ist somit ein Indiz für das positive Wirken einer Pfarrei.
Gute Erfahrungen führen letztlich dazu, dass Menschen wiederkommen oder davon erzählen, und es werden andere dafür interessiert. Die Regelmäßigkeit der Teilnahme und der Bevölkerungsquerschnitt der Teilnehmer werden damit zu relevanten Wirk-Indikatoren.
Auch die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich einbringen, wurde als Erfolgskriterium verstanden. Es sei ein Signal positiver Wirkung, wenn sich viel tut und sich viele Einzelne oder Gruppen einbringen und damit zeigen, dass sie auch zur Pfarrei gehören.
„Es waren einfach (…) unheimlich viele da, und haben gezeigt, wir gehören da auch dazu, sind auch hinterher dageblieben und es haben sich ganz viele einfach eingebracht, in diesem Jahr in der Vorbereitung, sei es im Organisieren von einem Kirchenkonzert gewesen, sei es im Organisieren von dem ganz besonderen Pfarrfest dann(…).“
Zwar könne es z. B. sowohl in einer gut wie auch in einer negativ wirkenden Pfarrei einen Kirchenchor geben. Aber er dürfte in einer schlecht wirkenden Pfarrei kaum so leicht zu bilden sein.
Es spiele eine Rolle, dass sich möglichst viele aktiv gestaltend einbringen, damit eine Pfarrei bunt wird. Die Zahl Ehrenamtlicher, noch dazu mit Blick auf den Querschnitt möglicher Zielgruppen, wird so zum Wirkungs-Indikator.
„Weil umso mehr Leute sich engagieren, umso, ja, umso bunter wird das Ganze, denk ich. Also, … mei wenn, wenn sich keinejugendlichen engagieren in der Pfarrei, dann gibt es keine Jugendarbeit. Und dann fehlt etwas, denke ich. Und genauso ist es bei anderen Gruppen, denke ich. Wenn es keine Senioren gibt, die sich engagieren, gibt es keine Seniorenarbeit. … Also, ich denke schon, dass es … dass es gut ist, eine gute Sache ist, wenn sich möglichst viele engagieren in so einer Gemeinde.“
Ein weiterer Interviewpartner nahm zur Frage nach Wirkungsindikatoren die Häufigkeit der Zeitungsberichterstattung über eine Pfarrei in den Blick. Diese sei für ihn kein hilfreicher Hinweis, ob Gemeindearbeit gut oder schlecht läuft.
„Nicht, also die einen sagen, äh, eine Pfarrei ist dann erfolgreich, oder eine Gemeinde, wenn sie möglichst oft in die Zeitung kommt. (…) Das finde ich nicht. Aber das ist nur ein Aspekt. Dann haben sie eine gute Öffentlichkeitsarbeit. (…) Und wenn man nämlich seine Arbeit gut macht, ist man eher nicht im Gespräch.“
Aus ehrenamtlicher Sicht wurden noch einige andere messbare Anhaltspunkte gegeben. Die Zahl der Personen, die in eine andere Kirche ausweichen, oder die Zahl derer, die an Weihnachten in die Kirche gehen. Auch die Zahl derer, die sonntags den Gottesdienst vor dem Fernseher verfolgen, wurde in den Blick genommen.
Mit all diesen Beispielen, auch wenn diese sehr auf mengenorientierte Indikatoren fokussierten, wird deutlich, dass es zwar Grenzen gibt, was messbar ist (dabei wird die Frage nach dem Verständnis von Gemeinde und Pastoral an dieser Stelle ausgeblendet). Darauf verweist auch Klostermann, wenn er deutlich macht, dass christlicher Glaube im Innersten der Menschen nicht direkt messbar sei und manches Engagement zunächst in kleinen Schritten verbleibt.237 Zugleich wird aber weniger grundsätzlich ausgeschlossen, dass die Wirkung pastoralen Handelns in irgendeiner Form spürbar sein muss. Hier hat offenbar jede Person eine eigene Vorstellung. Vielmehr scheint es eine Frage zu sein, welche Indikatoren denn eigentlich geeignet sind. Das zeigt die Diskussion um die Kirchgängerzahlen sehr deutlich - hier gehen die Meinungen durchaus auseinander. Es werden auch Indikatoren genannt, die in der Breite kaum verwendet werden.
Demnach muss es darum gehen, die Eignung von Wirkungs- bzw. Ergebniskriterien herauszufinden. Die Beurteilung, welche Ergebniskriterien geeignet sind und welche weniger, kann an dieser Stelle noch nicht geleistet werden. Darauf wird an späterer Stelle eingegangen. Diese Studie kann dazu erste Hinweise geben.
Gabriel verweist darauf, dass Messbarkeit formal Ziele benötigt, die operationalisiert wurden, d. h., in pastorale Programme übersetzt und mit geeigneten Indikatoren überprüfbar gemacht wurden. Erfolg kann demnach nicht direkt gemessen werden. Erfolg benötigt Indikatoren, die stellvertretend für den Sachverhalt stehen.238
„Die Qualität der Erfolgsmessung ist entscheidend davon abhängig, wie gut die Indikatoren ihre Stellvertretungsfunktion erfüllen.“239
Damit muss die Messung von Erfolg in Zeiten ständigen Wandels stets auch die eigenen Maßstäbe überprüfen, damit das Handeln von Kirche ihrem Auftrag entlang erfolgt.240
Arten von Ergebniskriterien
Um das Problem des Messens aber noch besser in den Griff zu bekommen, muss an dieser Stelle die Frage reflektiert werden, welche Arten von Indikatoren existieren. Denn zumeist wird eingleisig an das Zählen irgendeiner Menge an Einheiten gedacht, so z. B. eben an Kirchgängerzahlen oder auch Einnahmen, Teilnehmerzahlen usw.
Aber das ist nicht ausreichend. Nicht nur die International Croup of Controlling nimmt vier Wirkungsdimensionen in den Blick, die je nach Auftrag oder Organisation unterschiedlich bedeutsam sind.241 Das ist gerade für die Situation von Non-Profit-Organisationen geeignet.
1. „Output“: Dabei handelt es sich einfach nur um die Menge von Veranstaltungen, Produkten, Dienstleistungen oder anderer zählbarer Leistungen, die in einer Organisation hervorgebracht werden.
„Der Output zeigt, wie viele Inszenierungen die Oper (mit gegebenen Inputfaktoren) in einer Saison schafft, er zeigt aber nicht, ob die Oper im nationalen Ranking einen Spitzenrang innehat. Der Output des Naturschutzbundes zeigt die Fläche der angekauften Landschaftsgebiete, nicht aber, ob sich dort wieder Seeadler angesiedelt haben.“242
2. „Outcome“: Der gesellschaftliche Nutzen, der durch die Leistungen einer Organisation entfaltet wird. Es entstehen also Wirkungen bei Dritten oder mit Blick auf das Gemeinwohl.
„Die Oper produziert als Outcome urbane Lebensqualität, nicht Applaus des Publikums. Und der Outcome des Naturschutzgebietes lässt sich über die Artenvielfalt bestimmen, nicht über Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft.“243
3. „Effect“: Es handelt sich um Wirkungen, die objektiv vorhanden und auch nachweisbar sind.
„Abgebildet werden hier zielgruppenspezifische, intendierte, von der Wahrnehmung und Deutung der Zielgruppen unabhängig bestehende Wirkungen. (…)
Der Effect eines Opernspielplanes könnte in der zielgruppenspezifischen Zahl der Abonnenten gemessen werden, und ein Effect des Naturschutzgebietes ließe sich in den Übernachtungszahlen der Wanderhütten ablesen, und nicht in der Zufriedenheit des Hotel- und Gaststättenverbandes.“244
4. „Impact“: Darunter fallen die Wirkungen, die ein Leistungsempfänger subjektiv empfunden hat, und die eine Reaktion auf eine Leistung darstellen.
„Impacts als subjektive Reaktionen sind Einstellungen, Urteile, Zufriedenheitsäußerungen, aber auch die Änderung bzw. Stabilisierung von Verhaltensweisen. (…)
Der Stolz der interessierten Bevölkerung auf die Leistungsqualität der städtischen Oper stellt einen Impact dar, nicht die Anzahl der Fernsehaufzeichnungen neuer Inszenierungen. Die subjektive Wirkungsseite des Naturschutzgebietes liegt in der Akzeptanz, die Wanderwege nicht zu verlassen, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, dadurch objektiv die Begegnung mit einem Braunbären vermeiden zu können.“245
Diese vier Wirkungsdimensionen können noch weiter differenziert betrachtet werden, wenn noch die Perspektive der involvierten Personengruppen mit einbezogen wird. Dann kann jede Wirkungsdimension theoretisch, aber auch nicht zwingend, je nach Personengruppe beantwortet werden. Die relevanten Personengruppen sind demnach die direkten Wirkungsempfänger, die weiteren Stakeholder (wie z. B. Gesellschaft oder Umwelt), die Finanziers und die Mitglieder (oder auch die internen Stakeholder).246
Auch wenn es Grenzen der Messbarkeit gibt und daher an vielen Stellen mit Indikatoren gearbeitet werden muss, die einen betrachteten Gegenstand nicht direkt, sondern nur seine Auswirkungen erfassen: Es kann vieles fassbar gemacht werden, auch wenn manchmal mehr Umstände notwendig sind. Ein anderes Phänomen, das offenbar grundsätzlich für Organisationen aus dem Nonprofit-Bereich gilt, ist, dass es häufig nicht möglich ist, die Performance von NPOs zu erfassen oder zu überprüfen. Das liegt aber weniger an der tatsächlichen Möglichkeit des Gegenstands als vielmehr an unprofessionellem Agieren oder (un-)bewussten Machtverhältnissen oder auch an anderen Zielen, die implizit gerade verfolgt werden. So kann es z. B. sein, dass man nicht genau hinschauen möchte, um nicht die Überzeugung bisheriger Finanziers zu gefährden, dass die eigene Arbeit sinn- und wirkungsvoll ist. Daraus ist nicht zu folgern, dass besser keine Messgrößen eingeführt werden, sondern vielmehr, dass möglichst verschiedene Sichtweisen in die Betrachtung einer Organisation zu deren Qualitäts-Beurteilung einfließen sollten, so wie es oben Halfar und die International Group of Controlling mit der Be- trachtung der Messgrößen unterteilt nach Wirkungsempfängern, Stakeholders Finanziers und internen Stakeholdern vorschlägt.247
Das bedeutet, dass Messgrößen in keinster Weise bei leicht wahrnehmbaren Output-Dimensionen einer Organisation stehen bleiben müssen. Im Gegenteil, es gibt viele Varianten von Indikatoren, die wichtige Hinweise bereit halten. Das ist zugleich eine wichtige Grenze. Es handelt sich bei den nicht direkt messbaren Phänomenen um Indikatoren, weil der eigentliche Gegenstand nicht eins zu eins aufzunehmen ist. Das ist bei der Interpretation zu beachten.
Management, Markt und Kirche
Mit Dienberg/Warode gesprochen hält faktisch das funktionale und damit Mana-gement-orientierte Denken auch im Bereich der Seelsorgeeinheiten Einzug. Die Personen müssen sich darauf einstellen, sind aber u. U. nicht wirklich dazu ausgebildet.
„Ein leitender Mitarbeiter in Kirche ist heute ebenso mit Termindruck, Ressourcenknappheit, ständigen Veränderungsdruck und der strategischen Entwicklung der gesamten Organisation beschäftigt wie ein Manager in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen.“248
Auch in der Kirche wird gemanagt, wenn auch der Begriff häufig nicht verwendet wird. Trotzdem stößt Management immer wieder auf Ablehnung.249 Es wird mitunter der Vorwurf geäußert, dass die Anwendung von Management-Instrumenten in der Kirche zu einer völlig anderen Grundorientierung führt - weg von der eigentlichen Botschaft. Diese Diskussion wird in anderen NPOs ähnlich geführt.250 Das scheint aber ein Missverständnis zu sein, wenn die Schuld den in der Ökonomie entwickelten Instrumenten zugerechnet wird. Ökonomische Betrachtung fragt nach sinnvollem Handeln unter Knappheitsbedingungen und führt zu effizientem Sachmitteleinsatz.251 Management-Instrumente dienen der Institution, damit diese im Rahmen vorhandener Restriktionen trotzdem ihren Auftrag erfüllen kann. Die Effizienz wird in Profit-Organisationen natürlich an wirtschaftlichen Maßstäben gemessen, sie bezieht sich aber auf Ressourcen im Allgemeinen, wie z. B. auch Zeit. Außerdem muss nochmals deutlich festgehalten werden, dass Management immer dem Organisationszweck zu dienen hat und nicht umgekehrt. Es geht also vielmehr darum, dass eine Organisation professionell aufgestellt und geführt wird, selbstverständlich gemäß ihres Auftrags und mit ihren ganz spezifischen Themen.252 Dies erscheint gerade aufgrund der vielfachen Anforderungen in unserer Gesellschaft notwendig, die eine mehr und mehr aufkommende Marktsituation auch für die Kirche und damit aufkommende Konkurrenz beinhaltet und die nach einem verantwortlichen Umgang mit Ressourcen fragt.253
„Eine oder die wesentliche Aufgabe des Managements besteht darin, das langfristige Wohl und den Erfolg der Organisationen zu gewährleisten.“254
Das gilt auch für das Thema Marketing. Marketing dient wie die grundsätzlichere Perspektive des Managements der Organisation und damit ihrem Auftrag:
„Es ist ein eklatantes Mißverständnis zu meinen, daß Kirchenmarketing die Vision von Kirche verändern will. Vielmehr hat es sich an der Vision von Kirche zu orientieren, wie sie durch das Alte und das Neue Testament vorgegeben ist.“255
Marketing wie auch Management kann nicht unabhängig vom Auftrag gedacht werden, sondern es dient diesem. Die Botschaft bleibt, die Frage ist nur, ob die Qualität der Verkündigung nicht durch den Blick auf das Marketing vielfach positive Impulse erhalten kann. Bereits jetzt greift Kirche Marketingansätze auf, die aber zu wenig in ein Gesamtkonzept eingebettet und zu wenig professionell sind, da sie oft nur als Werbung verstanden werden. Marketing nimmt aktiv die Bedürfnisse der Menschen wahr, beachtet diese in der pastoralen Planung und gestaltet aktiv die Kontakte zu den Menschen.256
„Kirchenmarketing kann Menschen an Glauben und Kirche heranführen, vor allem auch umgekehrt: Glauben und Kirche näher an die Menschen heranbringen, Kirchennähe zu schaffen versuchen, die Formen kirchlicher Aktivitäten zugänglicher machen. Ob diese Aktivitäten letztlich erfolgreich sind, steht nicht in Menschenhand. Insofern bietet auch Kirchenmarketing keine Erfolgsgarantie, wohl aber die Vergrößerung von Erfolgschancen.“257
„Recht verstanden bedeutet Kirchenmarketing dann nicht den Ausverkauf des Evangeliums, sondern die prinzipielle Orientierung an den Menschen und daran, dass das Evangelium bei Ihnen ankommt. Die Orientierung am Marketing hilft, alles um sich selbst Kreisen der Kirche zu durchbrechen und stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum der kirchlichen Arbeit. Eine Kirche, die bei den Menschen nicht ankommt, steht auch dem Evangelium im Weg. Es ist ein Grundproblem unserer theologischen Ausbildung, dass dieses Ankommen des Evangeliums bei den Menschen nicht in den Blick kommt. Eine Grundvoraussetzung dazu wäre die Einübung in zielorientiertes Arbeiten.“258
Die Frage nach der Vereinbarkeit von Management und Theologie stellt sich in besonderem Maße in den Einrichtungen der Caritas. Ohne Management und unternehmerisches Handeln sind diese Einrichtungen nicht zu führen. Management und Theologie schließen sich auch hier nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, das dortige Tun an den theologischen und ethischen Grundlagen des Evangeliums zu normieren, nicht nur als Leitidee, sondern auch im operativen Alltag.259
Mit Karrer gilt, dass nicht das Management zu verurteilen ist und nicht dessen Gebrauch in der Kirche. Vielmehr steht der Auftrag im Zentrum und dem dient das Instrument.260 Nicht das Instrument ist das Problem, sondern die Art der Anwendung - der Anwender muss damit umgehen und dessen Nutzen einschätzen können.261 Dazu gehört auch, die normativen Grundlagen kirchlichen Handelns als Voraussetzung für die Anwendung des Instruments aktiv zu beachten.262 Ökonomie hat eine Dienstfunktion für den Auftrag von Kirche.263 Fehlende Wahrnehmung der Rolle und Relevanz wirtschaftlichen Tuns könnte stattdessen dazu führen, dass Fehlentwicklungen nicht genügend in den Blick kommen. So eine Fehlentwicklung könnte darin bestehen, dass implizit Verwaltungsgremien pastorale Entscheidungen definieren und damit nicht mehr im Dienst der Pastoral stehen, sondern unabhängig vom kirchlichen Auftrag rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten agieren. Der Fehler liegt dann aber im fehlenden Management, d. h. in derfehlenden Ziel-Klarheit und Steuerung solcher Verwaltungsgremien.264
Für Projekte der evangelischen Kirche formuliert Menne sehr deutlich:
„Ungenügende Leitungskompetenz, Professionalität, Nachhaltigkeit, Intensität und mangelnde Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko infolge von Angst und fehlender Visionen und zugleich dem absoluten Postulat theologischer Deutungshoheit - ohne Führungskonsequenz oder aber Kraft zum pragmatischen Konsens: Das waren, sind und bleiben die Untiefen, in denen die meisten evangelischen Kampagnen über kurz oder lang auf Grund liefen.“265
Eine generelle Diskreditierung von Management kann demnach nicht der richtige Ansatz sein. Kosch nimmt die Kritik wahr als Hinweis, dass das kirchliche Tun nicht unter das Diktakt wirtschaftlicher und finanzieller Maßstäbe kommen darf („Gefahr der Ökonomisierung“). Zugleich darf auch nicht das Gegenteil passieren („Gefahr der Spiritualisierung“).266 Die Kritik von Menne macht deutlich, dass pastorales Handeln, gerade in einer Pfarrei, durchaus gemanagt werden muss. Die vielfach vorhandenen Ratgeber zur Pfarreiarbeit machen dies deutlich und nehmen deswegen die Führung, die pastorale Planung, Entscheidungsprozesse usw. in den Blick, um das Handeln auf einen qualitativ hochwertigen Standard zu heben. Letztlich sind das alles Management-Aufgaben, die die Leitung handhaben muss.
Es steht also nicht in Frage, dass auch eine Pfarrei gemanagt werden muss.
„In der Gemeinde besteht ein Großteil der Tätigkeiten von Pfarrerinnen und Pfarrern offensichtlich aus Management. Wenn sie das schon machen müssen, sollten sie dafür auch ausgebildet sein. Damit sie sich dann aber nicht in vielerlei verlieren, bedarf es der Mühe um eine geistliche Identität. Geschieht hier nicht eine Verortung des Engagements, werden Pfarrerinnen und Pfarrer den großen Spielraum ihrer Tätigkeit zufällig und beliebig füllen.“267
Es geht zum einen um die Frage, wie gut das gemacht wird. Dafür kann man sich viele Anregungen aus den Erfahrungen und Instrumenten des Managements holen, natürlich der Pfarreisituation angepasst, um das eigene Handeln in diesem Feld möglichst professionell angehen zu können. Zum anderen dient solches Management der Aufgabe der Pfarrei, und hier liegt die Aufgabe der Theologie, das Management sorgfältig einzusortieren, d. h., die Theologie gibt normative Handlungsleitlinien und, im Falle einer Pfarrei, auch Handlungsfelder (auch wenn im Konkreten manches mehr und manches weniger vorhanden sein muss) vor. Die Theologie gibt also dem Management einen Rahmen vor, innerhalb dessen es sich bewegen darf. Das gilt so auch für Unternehmen der Caritas, nur mit den Unterschieden, dass die Aufgaben einer Pfarrei noch in viel stärkeren Maß theologisch veranlasst sind und eine Pfarrei nicht in dieser Weise ein Unternehmen darstellt.268
Kirche ist keine Organisation wie jede andere. Kirche ist eine komplexe Organisation, sie geht also über den sichtbaren Teil wesentlich hinaus. Gerade in letzter Zeit wird immer wieder deutlich, wie wichtig es insbesondere im Bereich der Ressourcen ist, Verantwortung gezielt nach den Evangelium-gemäßen Vorstellungen zu managen, damit Kirche glaubwürdig bleibt und z. B. nicht der Vorwurf von Verschwendung von Steuergeldern formuliert werden kann. Dazu braucht es professionelle Strukturen und Instrumente. Diese Verantwortung für Kirche und damit eine zielgerichtete, auftragsgemäße und effiziente Organisation ist hilfreich. Dabei geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern um Erfüllung des Auftrags und die Frage, wie das heutzutage am besten geht - ohne damit Menschen zu instrumentalisieren, sondern, so Nitsche/Hilberath, vorhandene Mittel wie Paulus nicht beliebig vielmehr wirkungsvoll einzusetzen. Paulus ging in die Hafenstädte, d. h. in wichtige Zentren, um wichtige Knotenpunkte zu haben, von denen aus die Botschaft verbreitet werden konnte.269 Auch die Gleichnisse vom anvertrauten Geld (Mt 25,14-30) und den klugen Jungfrauen (Mt 25,1-13) fordern dazu auf, die eigenen Möglichkeiten gezielt zu nutzen. Der ängstliche Diener, der das Talent vergraben hat, wird dafür nicht belohnt. Die klugen Jungfrauen, die genügend Öl mitgenommen haben, können an der Hochzeitsfeier teilnehmen.270
Natürlich müssen trotzdem die grundsätzlichen Grenzen von Management und Marketing im NPO-Bereich beachtet werden:271
1. Unter starken Marktbedingungen, z. B. in Krankenhäusern, muss darauf geachtet werden, dass nicht nur leicht messbare Größen zur Steuerung herangezogen werden. Leicht messbar sind neben wirtschaftlichen Größen auch Werte wie Zimmergrößen oder Betreuungsschlüssel. Die individuelle Zuwendung ist viel schwieriger zu bewerten, ist aber gerade in einem kirchlichen Krankenhaus bedeutsam. Es liegt also in der Verantwortung der Führung, ein Spektrum an Beobachtungsgrößen zu haben und den einseitigen Blick auf leicht beobachtbare zu vermeiden bzw. Steuerung stets sinnvoll mit den Bedürfnissen der Betroffenen rückzukoppeln. An dieser Stelle kann eine zu hohe Gewichtung von „Effizienz“ gemessen an den falschen Maßstäben ein Problem werden. Die Ursache ist in den fehlenden alternativen Kriterien zu suchen, die für eine Organisation wie Kirche zentral wären und die ebenfalls etabliert werden müssen. Die Komplexität und der Auftrag einer Institution müssen sich hier abbilden.
2. NPOs wie auch die Kirche leben stark aus der intrinsischen Motivation ihrer Mitglieder. Ehrenamtliche engagieren sich gern im Rahmen ihrer Motive. Werden nun finanzielle Anreize für diese Personengruppe geschaffen, die an messbare Leistungen geknüpft sind, dann ist zu befürchten, dass dies Schaden anrichten könnte. Zwar mag es an einigen Stellen wünschenswert sein, dass die Mitarbeit Ehrenamtlicher sich stärker im Rahmen gemeinsamer Ziele bewegt, aber dazu sind wahrscheinlich Gespräche über Ziele oder direkte Vereinbarungen oder auch Berichtssysteme besser geeignet. Das muss Management im Raum der Kirche beachten. Evtl. sind diese Überlegungen auch bezüglich Hauptberuflicher zu bedenken. Die Möglichkeit der Einführung finanzieller Steuerungsmechanismen müsste demnach insgesamt einer näheren Betrachtung unterzogen werden, um negative Wirkungen zu vermeiden. Das gilt besonders für die Kirche, die auf die intrinsische Motivation der Mitglieder angewiesen ist.
Mit Garhammer ist darauf hinzuweisen, dass Management-Ansätze nicht dazu führen dürfen, den Blick auf die Organisation und deren Verwaltung zu konzentrieren. Trotzdem ist die Chance zu sehen, dass deren systematischer Blick hilfreich sein kann, unklare Abläufe oder Organisationsstrukturen wieder im Sinne des kirchlichen Auftrags effizient zu gestalten. Gerade für eine Neuorientierung mit Zielen und operativer Umsetzung sind Management-Ansätze sehr gut geeignet und können für ein systematisches Vorgehen sorgen. Das ist in Zeiten der Weiterentwicklung hilfreich.272
Kein Automatismus!
Ein Missverständnis wäre es, TQM und speziell EFQM als eine Technik wahrzunehmen, die man nur wie eine Maschine einsetzen müsste, damit am Ende das gewünschte Ergebnis produziert wird. Das ist Qualitätsmanagement nicht.
Schwarz verweist auf die Gefahren eines technokratischen aber auch (im anderen Extrem) spiritualistischen Denkmusters.273 Das System Kirche besteht v. a. aus Menschen. In einer solchen Organisation gelten keine Naturgesetze. EFQM ist kein Automat.
Stattdessen ist EFQM zunächst so etwas wie ein Kompass oder eine Sehhilfe. Die Anwender lernen erst einmal systematisch das Hinschauen und machen das zu einer Daueraufgabe in einer Organisation. Die Kriterien geben der Organisation Blickwinkel vor, mit Hilfe derer sie nacheinander alle Handlungsbereiche wahrnehmen kann und nichts vergessen wird. Ob man mit etwas zufrieden ist oder nicht, kann anhand der Ergebniskriterien beurteilt werden. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich ein verbessertes Handeln auch auswirkt. Das setzt aber langfristiges Denken voraus, außerdem muss die Qualität im System ein bestimmtes Maß erreicht haben. Zugleich gilt: Die Gesellschaft und die Menschen entwickeln sich stets fort, so dass sich auch Teilansätze im Qualitätsmanagement mit der Zeit fortentwickeln müssen. Es wird zwar auf begründete Zusammenhänge zwischen Befähiger- und Ergebnisfaktoren aufgebaut, aber es handelt sich dabei nicht um ein garantiertes Eintreten wie man es bei einer Maschine erwarten würde. Es handelt sich eher, mit Schwarz gesprochen, um ein „biotisches“ Entwicklungsmuster, bei dem man viel tun kann, um ein gutes Wachstum zu fördern, aber das das unmittelbare Wachsen an sich nicht beeinflussen kann.274
1.2.4 Anwendung
Damit sind kritische Punkte benannt und wichtige Abgrenzungen bzw. Begriffsverständnisse geklärt. Es erscheint möglich, mit den erwähnten Grenzlinien TQM als Hilfsmittel zur Gestaltung pfarreilicher Pastoral anzuwenden. Allerdings ist damit noch herauszuarbeiten, welche Kriterien (wie es EFQM für Unternehmen angibt) in den Pfarrgemeinden anwendbar sind. Was gute Qualität bedeutet, ist demnach noch offen. Es wird die Aufgabe der nachfolgenden Kapitel sein, dazu ein Fundament zu legen. Sicherlich wird das weitere Diskussionsprozesse in der Folge benötigen. Denn letztlich braucht es eine gemeinsame Auseinandersetzung, um zu klären, welche Kriterien sinnvolle Ankerpunkte darstellen.275
Im Folgenden wird TQM und speziell das Modell EFQM zunächst als methodischer Rahmen genutzt, um das Feld des pastoralen Handelns in Pfarreien und die Wirkungen, die von Autoren oder pastoralen Experten für Pfarreien und damit Kirche als betrachtenswert erscheinen, systematisch zu sortieren und nach Zusammenhängen zu fragen. Dabei wird die Idee des EFQM aufgegriffen, dass eine Organisation Wirkungen produziert, die wiederum auf Handlungen beruhen. Es gibt also befähigende Handlungsweisen und damit zusammenhängende Wirkungen, die bei anderem Tun anders ausfallen würden.
Damit soll nicht einfach ein ökonomisches Modell mit ein paar begrifflichen Übersetzungen übernommen werden. Im Gegenteil: Ausgangspunkt ist der bereits dargestellte Auftrag von Kirche und das ekklesiologische Fundament. Das ist der theologische Ausgangspunkt. Darauf aufbauend werden im Folgenden wichtige theologische Dokumente, pastoraltheologische Modelle und Diskussionen und angrenzende Abhandlungen in den Blick genommen, die in verschiedener Form Handlungsempfehlungen für die Pfarreien oder auch Wirkungskriterien beinhalten. Eine besondere Quelle stellen dabei Interviews mit hauptberuflichen und ehrenamtlichen Experten dar. Diese Sammlung und Sortierung von expliziten in Kirche und Literatur vorhandenen sowie impliziten, individuellen Handlungsorientierungen aus der Praxis schlägt eine ordnende und den Überblick ermöglichende Schneise durch die Vielzahl an Betrachtungen und Blickwinkeln, die auf die pastorale Praxis in den Pfarreien gerichtet wird. Dadurch wird manche Betrachtung sehr kurz ausfallen, die intensiviert werden könnte oder sollte, was aber für den Querblick zur Betrachtung der Beschaffenheit (Qualität) der Pfarreien ausreichend sein muss, um dem eigentlichen Thema der Entdeckung wichtiger Qualitätskriterien als Orientierungsmuster für pastoral Handelnde treu bleiben zu können. Nachfolgende Forschungen müssten Teilkriterien ggf. verfeinern.
Die Kriterien aus dem EFQM sollen als Sortierrahmen dienen, die aber folgende Verständnisse mit Blick auf Pfarreien erfahren:
• Unter Führung kommt die Pfarreileitung und ihr Vorgehen in den Blick.
• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen sich sowohl auf hauptberufliche als auch auf ehrenamtliche Mitarbeiter.
• Statt Strategie soll von „Pastoraler Planung“ gesprochen werden, um deutlich zu machen, dass es darum geht, die Sendung der Kirche umzusetzen und dafür in der Praxis praktikable Vorgehensweisen zu finden.
• Partnerschaften und Ressourcen meinen die Kooperations- und Netzwerkpartner für die Pastoral vor Ort und die Möglichkeiten, die das Handeln erst gewährleisten.
• Prozesse, Produkte und Dienstleistungen werden mit „Pastorale Prozesse und Dienste“ umschrieben, um begrifflich näher am Auftrag der Heilssendung zu sein, für den Kirche einen Dienst leistet.
• Die Ergebniskriterien werden lediglich nach Mitarbeiter-, Gesellschafts- und Mitgliederbezogenen Ergebnissen unterteilt. Statt Schlüsselergebnissen wird von Institutionellen Ergebnissen gesprochen. Damit wird deutlich gemacht, dass die Institutionellen Ergebnisse keine Kern- oder Schlüsselergebnisse sind. Es muss einerseits durchaus darum gehen, missionarisch nach außen zu wirken und insofern zu wachsen. Aber zugleich ist der Kern die Botschaft, die bei den Menschen ankommen soll. Nur über die Menschen kann der Auftrag verwirklicht werden.
Abbildung 5: Pastorales Qualitätsmodell
Die Grundkonzepte des EFQM erscheinen grundsätzlich als unproblematisch. Vorausgesetzt wird hier das Verständnis wie es oben bzgl. Kunde, Dienstleistung, Management oder Marketing verdeutlicht wurde. Trotzdem wird auf Begriffe wie Kunde, Management oder Marketing im weiteren Verlauf eher verzichtet, um gewisse Konnotationen und damit Missverständnisse zu vermeiden, auch wenn sie begrifflich so nicht intendiert sind.276 Mit Schmälzle darf aber ein Qualitätsentwicklungsinstrument im pastoralen Kontext nicht nur humanwissenschaftlichen Kriterien genügen, sondern muss insbesondere der Kriteriologie des Evangeliums entsprechen. Das muss sich in den Qualitätskriterien niederschlagen und damit im pastoralen Handeln zeigen.277 Zusätzlich werden an dieser Stelle die Grundansätze, auf denen die Kriterien aufbauen, mit Blick auf Kirche um den Aspekt der theologischen Vergewisserung ergänzt. Damit soll gewährleistet werden, dass das Handeln stets auf die theologische Grundlage rückgekoppelt bleiben muss. So ergeben sich neun Grundansätze:
1. Das Handeln am Evangelium ausrichten.
2. Nutzen für den Wirkungsempfänger (Kunden) schaffen.278
3. „Die Zukunft nachhaltig gestalten“.
4. „Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln“.
5. „Kreativität und Innovation fördern“.
6. „Mit Vision, Inspiration und Integrität führen“.
7. „Veränderungen aktiv managen“.
8. „Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein“.
9. „Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen“.279
Im nächsten Schritt wird nun zusammengetragen, welche Befähiger- bzw. Ergebniskriterien als relevant betrachtet werden können.
14 Kehl (2009), S. 391-392
15 Vgl. auch Kraus (2012), S. 195
16 Vgl. Kasper (2008), S. 68, 267
17 Müller (2001), S. 23-24
18 Vgl. Senn (2009), S. 228-244; Rahner (1976), S. 385-386
19 Vgl. Kraus (2012), S. 191, 193, 195-196
20 Fries (1982), S. 167
21 Vgl. Kehl (2009), S. 82-84; auch Rahner (1976), S. 376-377
22 Kehl (2009), S. 84
23 Kasper (2008), S. 269
24 Rahner (I960), S. 13
25 Vgl. Kasper (2008), S.315
26 Vgl. Kasper (2008), S.313
27 Kasper (2008), S.315
28 Vgl. Kasper (2008), S.315
29 Vgl. Kehl (2009), S. 394-395
30 Vgl. Kehl (2009), S. 394-397; vgl. zu „Kirche als Sakrament“ auch Döring (1986), S.100-117
31 Müller (2001), S. 30
32 Rahner (1989), S. 77
33 Vgl. Kasper (2008), S. 348, 355; EN 39; Kehl (2009), S. 35; vgl. auch CS 1 und 42
34 Kasper (2008), S. 357
35 Müller (2001), S. 137
36 Vgl. Kehl (2009), S. 85-88
37 Kehl (2009), S. 91-92
38 Vgl. Kehl (2009), S. 92
39 Vgl.Neuner(1993),S.70-71
40 Kasper (2008), S.313
41 Kasper (2008), S. 332
42 Vgl.Neuner(1993),S.70-71
43 Kasper (2008), S. 332
44 Kasper (2008), S. 333
45 Zulehner (1991 a), S. 54; vgl. auch Rahner (1960), S. 17
46 Vgl. Zulehner (1991 a), S. 55-56; Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2004), S. 47
47 Vgl. GS 42; Zulehner (1991a), S. 65–67, 70–76, 81, 83–94,; Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2004), S. 44–45, 65–66, 104–106, 144, 350-352; Beschluss Unsere Hoffnung, Teil 1.1
48 Vgl. Kehl (2009), S. 70; Kasper (2008), S. 71–74, Müller (1998), S. 613
49 Kasper (2008), S. 74
50 Vgl. Fries (1982), S. 169-174
51 An dieser Stelle wird darauf kann die Diskussion zu Volk Gottes und Communio nur in Grundlinien angedeutet werden.
52 Klinger (1992), S.312
53 Vgl. Miggelbrink (2003), S. 26; Kasper (2008), S. 268-272; ähnlich Kehl (2009), S. 29-33
54 Vgl. Kasper (2008), S. 59-61; Kehl (2009), S. 93; vgl. insgesamt LG 9-17
55 Vgl. Klinger (1992), S. 310-311
56 Vgl. Bucher (2006), S. 850
57 Vgl. Kasper (2008), S. 409;Werbick (1994),S. 317
58 Kasper (2008), S.412
59 Vgl. LG 9-13, 30-32, 34-36; CL14;Miggelbrink (2003),S.26
60 Vgl. Klinger (1992), S.315
61 Vgl. Kasper (2008), S. 81-82; Kehl (2009), S. 93
62 Vgl. Kasper (2008), S. 421), Kehl (2009), S. 92-93,
63 Müller (1998), S. 579
64 Vgl. Kasper (2008), S. 73; Miggelbrink (2003), S. 26
65 Vgl. Kasper (2008), S. 274, 415-420; LG 23
66 Kehl (2009), S. 125
67 Vgl. Siebenrock (2012), S 56; vgl. für das folgende auch Siebenrock (2012), S. 56-61
68 Senn (2009), S. 285; Wiedenhofer (1992), S. 241
69 Vgl. Senn (2009), S. 285
70 Vgl.Miggelbrink(2003),S.82
71 Simonis (2005), S. 56
72 Vgl. Simonis (2005), S. 56
73 Miggelbrink(2003),S.82
74 Vgl. Simonis (2005), S. 60
75 Vgl. Kehl (2009), S. 126; vgl. auch Rahner (1976), 337-339
76 Kehl (2009), S. 126
77 Vgl. Kehl (2009), S. 398-401, Senn (2009), S. 286-287; Ratzinger spricht davon, dass die Eucharistie Menschen mit Christus zusammenbringt und sie so Kirche konstituiert - als „Eucharistiegemeinschaft“ (Ratzinger (1987), S. 17)
78 Vgl. Kehl (2009), S. 126; Senn (2009), S. 289
79 Kehl (2009), S. 126
80 Kehl (2009), S. 127
81 Kehl (2009), S. 127
82 Vgl. Kehl (2009), S. 127-128, Miggelbrink (2003), S 101-102
83 Vgl. Kehl (2009), S. 128-129, Miggelbrink (2003), S.112
84 Vgl. Miggelbrink (2003), S. 112-114; LG 9; UR 6
85 Kehl (2009), S. 405
86 Vgl. Kehl (2009), S. 405-407; Senn (2009), S. 289-291
87 Vgl. Siebenrock (2012), S. 60
88 Kehl (2009), S. 130
89 Miggelbrink (2003), S.117 (Hervorhebung im Original); vgl. auch Senn (2009), S. 291
90 Vgl. Kehl (2009), S. 415-422; Senn (2009), S. 291
91 Senn (2009), S. 251-252
92 Vgl. Senn (2009), S. 245-246
93 Vgl. Kehl (2009), S. 130-131
94 Vgl. Miggelbrink (2003), S. 117-121
95 Senn (2009),S.295
96 Vgl. Senn (2009), S. 295
97 Haslinger (2006), S. 80-81
98 Haslinger (2006), S. 80
99 Vgl. Haslinger (2006), S. 79-81; Laumer (2015), S. 201-206; Haslinger verweist auf einige Unklarheiten bzgl. des Grundvollzüge-Modells: z. B. Haslinger (2009), S. 169-171; vgl. auch Laumer (2015), S. 189-201
100 Vgl. Wiederkehr (2006), S. 1072
101 Vgl. Kuhnke (2006), S. 172
102 Vgl. Müller (2006), S. 680-681; Zerfaß (2006), S. 683-684
103 Vgl. Häussling (2006), S. 969-970; Floristán (2006), S. 970-971
104 Vgl. Mette (2006), S. 185; zum Verhältnis der drei Grundvollzüge: vgl. Laumer (2015), S. 206-212
105 Vgl. Senn (2009), S. 296-300; Miggelbrink (2003), S. 122-124, 136-140; Zulehner (1991b), S. 86-90, 92-97, 118-127; Wiedenhofer (1992), S. 232-234; Wollbold stellt den Nutzen des Grundvollzüge-Modells in Frage, das z. B. Fragen der Organisation oder auch Finanzierung gar nicht in den Blick bekommen würde (vgl. Wollbold (2013), S. 57).
106 Vgl. Siebenrock (2012), S. 48; vgl. auch Döring (1986), S. 118-123
107 Kasper (2008), S. 297
108 Siebenrock (2012), S. 48
109 Vgl. Kasper (2008), S. 292-300; CS 10
110 Kasper (2008), S. 294
111 Wiedenhofer (1992), S. 296
112 Vgl. Wiedenhofer (1992), S. 297
113 Zitat aus Wiedenhofer (1992), S. 301; vgl. auch Wiedenhofer (1992), S. 299-301
114 Wiedenhofer (1992), S. 303-308; vgl. auch Carhammer (1996), S. 76-77
115 Kasper (2008), S. 468
116 Vgl. Kasper (2008), S. 469-472, Kasper (2009), S. 167-169
117 Kehl (2009), S. 369
118 Kehl (2009), S. 370
119 Vgl. Kehl (2009), S. 371
120 Vgl. Siebenrock (2012), S. 56-58
121 Vgl. auch Weber/Fuchs (2007), S. 50
122 Vgl. Stockmeier (1986), S. 124-125
123 Vgl. Kraus (2012), S. 292-296; Mette (2005), S. 109-113; Beschluss Dienste und Ämter, 2.3.1-2.3.2
124 Kraus (2012), S. 297
125 Vgl.auch AA 6,CD31
126 Vgl. Kraus (2012), S. 297-298; vgl. auch LG31; AA 2; Beschluss Räte und Verbände, 1.2-1.5
127 Vgl. Kasper (2009), S. 77
128 Beschluss: Dienste und Ämter, 2.3.2
129 Vgl. Kasper (2009), S. 77-78
130 Kasper (2009), S. 77
131 Die Zitate stammen aus Kasper (2009), S. 77
132 Kasper (2009), S. 77
133 Vgl. Kasper (2009), S. 77-78
134 Vgl. Kasper (2009), S. 77-78; Carhammer (1996), S. 76-78
135 Vgl. Lehmann (1982), S. 8-9
136 Lehmann (1982), S. 18
137 Vgl. Lehmann (1982), S. 13-21, 24-25
138 Vgl. Lehmann (1982), S. 37-41
139 Vgl. Haslinger (2015), S. 152, 197-204; Haslinger(2005),S. 213-216
140 Vgl. LG 18, 20-21
141 Vgl. Kehl (2009), S. 104-105; 110-116; Miggelbrink (2003); S. 147-149, 152-153, 162-163, 168-169; Senn (2009), S. 305-308; Mörsdorf (1972), S. 287-289; Semmelroth (1972), S. 87-88; Kasper (2009), S. 165-167
142 Vgl. LG 9-13, 30-32, 34-36
143 Vgl. Kehl (2009), S. 106-108; Kasper (2009), S.21, 160; Zulehner (1991b), S.128
144 Kasper (2009), S.23
145 Vgl. Kasper (2009), S. 24, 28, 31, 164-165
146 Kehl (2009), S. 114-115
147 Kehl (2009), S.113 (Hervorhebung im Original)
148 Vgl. Kasper (2009), S. 52-54, 161-163
149 Vgl. Kasper (2009), S. 54-55, 163-164; Kehl (2009), S. 104-115; Kraus (2012), S. 129-137, 254-261, 277-291, Kasper (2009), S. 36
150 Kasper (2009), S. 47
151 Vgl. Kasper (2009), S. 47-49
152 Vgl. Kasper (2009), S. 64-67
153 Vgl. Senn (2009), S. 221-225
154 Vgl. Schnauber (2012a), S. 43-50; Nuland/Broux/Crets/Cleyn/Legrand/Majoor/Vleminckx (2003), S. 17
155 Vgl. Deutscher Caritasverband e.V. (2003), Vorwort; Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V./Deutscher Caritasverband e.V. (2011), 1-6; Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg (2013), S. 9-13
156 Vgl. Kamiske/Brauer (2008), S. 61; Zollondz (2002), S. 141-142
157 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2005), S. 18
158 Vgl. Bruhn (2013a), S. 30-31; Buhrmeister/Lehnerer (1996), S. 17; Langnickel (2001), S. 9; Zink (2004), S. 48, 55; Benkenstein (1993), S. 1099; Zollondz (2002), 143-145
159 Vgl. Bruhn (2013a), S. 32-34, 41
160 Vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2005), S. 21; vgl. auch, mit Bezug auf DIN EN ISO 9000:2000, Buhrmeister/Lehnerer (1996), S. 20; Zink (1995), S. 5-6
161 Vgl. Matul/Scharitzer (2007), S. 549-550; Langnickel nennt auch die Unterscheidung von David A. Garvin, der Qualität künden-, produkt-, herstellungs- und wertorientiert betrachtet (vgl. Langnickel (2001), S. 9-10).
162 Matul/Scharitzer (2007), S. 550
163 Vgl. Zink (2004), S. 19-42, 54-65
164 Zink (2004),S.42
165 Vgl. Matul/Scharitzer (2007), S. 534-535; Bruhn (2013a), S. 55-65; Zink (1995), S. 4, 16-17; Zollondz (2002), S. 193; Kamiske/Brauer (2008), S. 98-99
166 Vgl. Zink (2004), S. 58-59
167 Vgl. Schnauber (2012b), S. 1 1 8,123, 125-127
168 Malorny (1999),S.XL
169 Vgl. Zink (2004), S. 54
170 Zink (2004),S.55
171 Zink (2004),S.55
172 Vgl. Malorny (1999), S. 81; Schnauber (2012b), S. 117-118, 125; Zollondz (2002), S. 353355; zur Gegenüberstellung der Grundansätze: vgl. Vomberg (2010), S. 49-52
173 Malorny (1999), S. 139
174 Vomberg (2010), S. 52-53
175 Vgl. Vomberg (2010), S. 53
176 Nuland/Broux/Crets/Cleyn/Legrand/Majoor/ Vleminckx (2003), S. 20
177 Vgl. EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 2–3 - die folgende Darstellung bezieht sich auf das EFQM-Modell von 2013. Vgl. auch EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2003), S. 4
178 Vgl. EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 4–8; Fischer (2013), S. 330–331 - Fischer benennt fünf Grundanliegen: Kunden-, Mitarbeiter-, Prozess-, Entwicklungsund Managementorientierung. Vgl. auch Nuland/Broux/Crets/Cleyn/Legrand/Majoor/ Vleminckx (2003), S. 24-26; Zink (2004), S. 70-73; ein Vorgängermodell: EFQM (2000), S. 67, 20; EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2003), S. 7-11
179 Entnommen aus EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 9; vgl. auch EFQM (2000), S. 20
180 Vgl. EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 9-23; vgl. zur Fortentwicklung z.B. die Formulierungen unter EFQM (2000), S. 21 oder auch EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2003), S. 12-24
181 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 10
182 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 12
183 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 14
184 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 16
185 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 18
186 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 10-18
187 EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 20-23
188 Vgl. EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 25-28; vgl. auch EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2003), S. 27-31
189 Matul/Scharitzer (2007), S. 534
190 Vgl. Nuland/Broux/Crets/Cleyn/Legrand/Majoor/Vleminckx (2003), S. 30; Matul/Scharitzer (2007), S. 534-535; weitere Instrumente; vgl. Bruhn (2013b), S. 50; Zink/Seibert (2011), S.
191 Vgl. Singhal/Hendricks (2000), S. 13-14
192 Singhal/Hendricks(2000),S.13
193 Vgl. Langnickel (1997a), S. 70-72; Deutscher Caritasverband e.V. (2003), Vorwort, Nr. 3-6; Deutscher Caritasverband e.V. (2007), S. 9; Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V./Deutscher Caritasverband e.V. (2011), 1-6, 8-9; Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg (2013), S. 4-7, 9-13; vgl. auch Zimmer (2012), S. 51
194 Vgl. Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) - Bundesverband e.V. (2001), S. 42-43
195 Fischer (2013), S. 335
196 Vgl. Nitsche/Hilberath (2002), S. 16-17
197 Stauss (2012), S. 198
198 Vgl. Stauss (2012), S. 198-204
199 Vgl. Anfrage aus: Initiativkreis „Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft“ (2001), S. 26
200 Vgl. Kapitel 1.1.2
201 Fischer (2013), S. 335
202 Stauss (2012), S. 196-197
203 Pott (2001), S. 89
204 Vgl. Stauss (2012), S. 197; Meyer/Blümelhuber/Pfeiffer (2000), S. 52-68
205 Vgl. Bruhn (2013b), S. 18-20
206 Vgl. Stauss (2012), S. 197-207; Latzel (2010), S. 102-110
207 Vgl. Matul/Scharitzer, S. 538-540; für das Beispiel Öffentlicher Dienst: Nuland/Broux/Crets/Cleyn/Legrand/Majoor/ Vleminckx (2003), S. 387-390
208 Matul/Scharitzer, S. 538-539 (Hervorhebungen im Original)
209 Matul/Scharitzer, S. 539 - vgl. auch für gesamten Absatz
210 Vgl. Fischer(2013),S. 338; fürdas Beispiel vgl. Millennium-Konsumziele: Misereor (2010), S. 18
211 Vgl. Bruhn (2013a), S. 24; Hermelink (1999), S. 96-99
212 Vgl. Kehl (2000), S. 390, 393-399
213 Pott (2001), S. 224
214 Vgl. Pott (2001), S. 224
215 Vgl. Pesch (1981), S. 11,20-22
216 Klostermann(1981),S.51
217 Vgl. Klostermann (1981), S. 51-54
218 Klostermann (1981), S. 55
219 Vgl. Klostermann (1981), S. 54-58
220 Klostermann (1981), S. 55
221 Vgl.Josuttis (1988), S. 80-93
222 Josuttis (1988), S. 81
223 Josuttis (1988), S. 85
224 Josuttis (1988), S. 90
225 Josuttis(1988),S.90
226 Vgl. Gabriel (1981), S. 84-85
227 Gabriel (1981), S. 85
228 Vgl. Belok/Bischofberger (2008), S. 28-29; Die deutschen Bischöfe (2000), S. 33
229 Karrer (1998), S. 70
230 Vgl. Karrer (1998), S. 70-76
231 Karrer (1998), S. 75
232 Vgl. Karrer (1998), S. 77-81
233 http://www.zitate.eu/de/zitat/46752/martin-buber gefunden am 14.8.2015; Belok/Bischofberger (2008), S. 27
234 Interview-Aussage (vgl. Kapitel 3)
235 Vgl. Tetzlaff (2005), S. 123; Hermelink (2010), S. 78-81
236 Interview-Aussage (vgl. Kapitel 3) - auch die folgenden Zitate sind Interview-Aussagen
237 Vgl. Klostermann (1981), S. 67-71
238 Vgl. Gabriel (1981), S. 88-94
239 Gabriel (1981), S. 91
240 Vgl. Horstmann (1981b), S.112
241 Vgl. Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 31; Bono (2006); S. 163
242 Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 31
243 Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 31
244 Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 31
245 Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 31
246 Vgl. Halfar/International Croup of Controlling (2008), S. 32-35
247 Vgl. Moss Kanter/Summers (1987), S. 163-164
248 Dienberg/Warode (2012),S.280
249 Vgl. Pfrang (2012), S. 272; Hennersperger (2012), S. 266; Nethöfel (1998), S. 59-63
250 Vgl. z.B. Meyns (2012), S. 237; Fetzer/Grabenstein/Müller (1999), S. 200-202, 206-216; Initiativkreis „Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft“ (2001), S. 7-31
251 Vgl. Homann/Suchanek (2000), S. 3-5
252 Vgl. Raffée (1999), S. 9-20; Pfister (2000), S. 141-144; Horak/Heimerl (2007), S. 167-170, 175-176; Dietzfelbinger (2002), S. 97-100; Buchstädt (2002), S. 109-131; Bischofberger (2005), S. 37-43
253 Vgl. Kapitel 2.1.1; Grözinger/Plüss/Portmann/Schenker (2000), S. 26-29; Nitsche/Hilberath (2002), S. 16; Giesen (2011), S. 122-126; Schwarz (1996) (S. 92-95) unterscheidet zwischen technokratischen und spiritualistischen Denkmustern, wovon das erste im nächsten Punkt behandelt wird.
254 Dienberg/Warode (2012),S.282
255 Raffeé(1999),S.7
256 Vgl. Raffée (1995), S. 162-174
257 Raffeé(1999),S.7
258 Abromeit(2001),S.15
259 Vgl. z. B. Lohmann (1997), S. 165-206, 263-314
260 Vgl. Karrer (2008), S. 63, 66-67
261 Vgl. Lames (2012b), S. 240
262 Was z. B. im St. Caller Managementkonzept explizit deutlich gemacht wird - vgl. Klostermann (1997), S. 63-65; Bischofberger (2005), S. 103
263 Vgl. Belok/Bischofberger (2008), S. 18, 24
264 Vgl. Pock (2011), S. 207
265 Menne (2004), S. 354
266 Vgl. Kosch (2007), S. 192-193; Kosch (2003), S. 840-842; Bischofberger (2005), S. 103; Nethöfel bezeichnet den Vorwurf als einen „sakralen Fehlschluss“; „Der sakrale Fehlschluß tabuisiert die Art und Weise, wie ich arbeite, weil ich in der Kirche arbeite.“ (Nethöfel (1997), S. 19; Nethöfel (1998), S. 60-61).
267 Abromeit(2001),S.11
268 Vgl. Fischer (2007), S. 58
269 Vgl. Nitsche/Hilberath (2002), S. 18; Lames (2012a), S. 226-229
270 Vgl. Gnilka (1988), S. 353-354, 363
271 Vgl. Speckbacher (2007), S. 338-339
272 Vgl. Carhammer (1998), S. 56
273 Vgl. Schwarz (1996), S. 92-95
274 Vgl. Schwarz (1996), S. 12
275 So ähnlich auch Störmer-Schuppner (2009), S. 502
276 Orientiert an Raffeé (1999), S. 8
277 Vgl. Schmälzle (2001), S. 224, 248
278 Angelehnt an: EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 4
279 Die Zitate sind aus EFQM/Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) (2012), S. 5-8