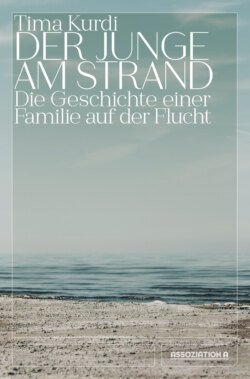Читать книгу Der Junge am Strand - Tima Kurdi - Страница 11
Kapitel 1 Stadt des Jasmin
ОглавлениеÜberall in Damaskus wächst wilder Jasmin, in jeder Nische, in jeder Ecke. Die Luft ist erfüllt vom süßen Duft der herrlichen Blume. Sie findet sich so häufig in Damaskus, dass wir die Stadt Yasmin al-Sham getauft haben: die Stadt des Jasmin.
Mehr als einmal versuchte ich, Jasmin auch in meinem Garten in Vancouver in Kanada zu pflanzen, allerdings mit mäßigem Erfolg. Die Pflanze wuchs, doch ihr Duft erreichte nicht annähernd die Intensität, die ich aus Damaskus kannte. Mein Vater schickte mir eine Blumenzwiebel aus Sham, wie die Damaszener ihre Stadt liebevoll nennen. Im Frühling setzte ich sie aus, im Sommer blühte sie, doch man musste die Nase schon sehr tief in die Blütenblätter stecken, um einen leichten Hauch ihres sonst so starken Aromas zu erhaschen. Einen Winter überlebte das Pflänzchen in weiter Ferne von der ihr vertrauten Erde. Einen kurzen Winter, mehr nicht.
Seit 1992 war ich in Kanada, in Sicherheit. Eine halbe Welt entfernt, in Syrien, begann 2011 der Krieg, der meine Familie aus ihrer Heimat vertrieb. Wie die Blumenzwiebel mussten sie in fremdem Land neue Wurzeln schlagen. Wenn du verstehen willst, wohin du gehst, musst du zuerst verstehen, wo du zuvor warst, heißt es. Bevor ich vom bewegten Leben meiner Geschwister seit ihrer Flucht aus Syrien berichte, möchte ich daher erzählen, woher wir kamen und wie wir früher lebten.
Mein Vater, Ghalib, wurde 1942 geboren, kurz vor Beginn einer neuen Ära in unserem Teil der Welt. Auch in Syrien begann, nach jahrtausendelanger Unterdrückung, eine neue Zeit. Mein Vater war Kurde. Er kam in Hama zur Welt. Wie die meisten Syrer sind viele Kurden Sunniten. Zugleich ist ihr Volk für die größte religiöse Vielfalt der Welt bekannt: Die Kurden praktizieren einen Mix aus religiösen Glaubenssystemen, und ihre Region umspannt die ganz unterschiedlichen Kulturen Syriens, der Türkei, des Irak und des Iran. Ghalibs Vater, mein Großvater, war – wie viele in Hama – Bauer. Meine Großeltern waren arm. Als mein Baba geboren wurde, hatte die Familie bereits zwei Töchter und zwei Söhne. Meine Großmutter starb, als mein Vater drei Jahre alt war. In Syrien sagen wir: »Geht die Mutter, fällt die Familie auseinander.« Mein Großvater arbeitete viele Stunden am Tag auf dem Feld. Er kümmerte sich so gut er konnte um seine Kinder. Dennoch waren die Jungen oft hungrig und schmutzig, ihre Kleidung war verschlissen. Immer wieder nahmen sich die Nachbarinnen ihrer an, versorgten sie mit Essen, Schuhen und Anziehsachen, und gelegentlich ließen sie sie duschen.
Als mein Vater sechs Jahre alt war, zog die Familie nach Kobane. In dieser fruchtbaren Zone in der Nähe der türkischen Grenze, östlich des Nahr al-Furat, des mächtigen Euphrat, besaßen sie ein Stück Land. Auf seiner Parzelle baute mein Großvater Bulgur an. Er wohnte mit seinen Kindern in einer Einzimmerhütte aus Stroh und Lehm. Sie führten ein typisch bäuerliches Leben, doch es fehlte die Mutter, die sich um sie hätte kümmern können.
Baba und seine Geschwister waren von der Großzügigkeit der Verwandten und Nachbarn abhängig, die genug anbauten, damit alle auch über die Wintermonate etwas zu essen hatten. Mein Vater begleitete seinen älteren Bruder Khalid mit den Schafen auf die Weide und sammelte Wildkräuter, Gräser und Pflanzen. Er lernte schnell und recht bald wusste er, welche Gewächse giftig sind und welche einen Kranken heilen können.
Seine langen Wanderungen auf der Suche nach etwas Essbarem hat Baba nie vergessen. Oft lief er den ganzen Tag bergauf und bergab und kehrte doch mit knurrendem Magen ins Dorf zurück. Einmal lagen Schalen von Wassermelonen am Straßenrand. Er hob sie auf und aß sie. »Kinder überlegen nicht, was sie essen. Sie stecken einfach etwas in den Mund, wenn sie hungrig sind«, waren seine Worte, als er davon erzählte. Eine Nachbarin, die gerade ihren Gemüsegarten wässerte, rief ihm zu: »Warte! Iss das nicht!« Sie pflückte eine reife Tomate vom Strauch und gab sie ihm. »Nimm lieber dies hier«, sagte sie. Die Tomate wog schwer in der Hand meines Vaters. Sie war noch warm von der Sommersonne. Er biss in die Frucht, die so reif war, dass sie in seinem Mund geradezu explodierte und ihr Saft ihm am Kinn hinunterlief. Noch heute schwärmt er von diesem wunderbaren Moment. Er schließt die Augen und erinnert sich an die kräftige Farbe, die Wärme, den Geschmack. Seitdem hat mein Vater Tausende von Tomaten gegessen, doch keine schmeckte so gut wie jene, die die Nachbarin ihm geschenkt hatte, denn sie war erfüllt vom Aroma der menschlichen Güte. Diesen freundlichen Akt behielt er im Sinn und im Herzen, und was er damals lernte, gab er an seine Kinder weiter: »Du musst nicht reich sein, du brauchst kein Geld, um anderen zu helfen«, lehrte er mich. »Du musst nur ein Herz haben.«
Als junger Mann verließ mein Vater Kobane und kehrte nach Hama zurück, wo er arbeiten wollte. Dann leistete er seinen zweijährigen Wehrdienst bei der syrischen Armee. Kurz bevor er entlassen werden sollte, erkrankte er an Malaria. Man brachte ihn in ein Krankenhaus in Damaskus, wo er meine Mutter, Radiya, kennenlernte. Sie betrat sein Krankenzimmer und er behauptet noch heute, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Das glaube ich ihm gern. Nach seiner Genesung zog er bei Radiyas Verwandten ein, und dort begann die Romanze meiner Eltern. Baba erholte sich und bald waren die beiden verheiratet.
Nach der Hochzeit lebten sie zunächst bei den Schwiegereltern. Sie sparten, um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Ihr erster Sohn, mein Bruder Mohammad, kam 1968 auf die Welt. Ein männlicher erster Nachkomme gilt in vielen Gesellschaften und insbesondere in arabischen Kulturen als großes Glück. Der Erstgeborene genießt als künftiger Erbe die größten Privilegien, und alle in der Familie, auch der Vater, werden mit dem Namen des ersten Sohnes angesprochen. Mein Vater war jetzt Abu Mohammad, »der Vater Mohammads«, und meine Mutter Oum Mohammad, »Mohammads Mutter«. Der Name des Erstgeborenen bezeichnet auch die Adresse, die man angibt, wenn jemand nach dem Weg fragt. Wenn ein Besucher zu uns wollte, beschrieb ich ihm also, wie er »das Haus des Vaters von Mohammad Kurdi« findet. Der älteste Sohn hat die wichtigsten Pflichten in der Familie: Er sorgt dafür, dass die Eltern geachtet werden, er kümmert sich um sie – vor allem, wenn sie alt sind – und um seine Geschwister, insbesondere um seine Schwestern, ob denen das gefällt oder nicht.
Bald nach Mohammads Geburt starben die Eltern meiner Mutter. Ihre beiden großen Schwestern waren bereits verheiratet, doch fünf ihrer sechs Brüder, im Alter von vier Jahren bis zum Teenager, waren nun minderjährige Waisen. Meine Eltern nahmen sie bei sich auf und behandelten sie, als wären es ihre Kinder. Mein Vater legte sein Geld mit dem Verdienst der Brüder meiner Mutter zusammen. 1969 kauften meine Eltern ein Haus in Rukn al-Din. Es war nicht irgendein Haus. Es war das höchste Gebäude auf dem Berg Qasiyun. Oft neckten sie sich deshalb. Mein Vater sagte dann: »Ich habe dir ein Spitzenhaus gekauft«, und meine Mutter antwortete: »Irgendwann bekomme ich vom steilen Weg nach Hause einen Herzinfarkt.« Abgesehen von der prominenten Lage war es ein typisch syrischer Flachbau mit Betondach, einstöckig, mit drei Schlafzimmern, einer kleinen Küche und einem Bad, davor ein offener Hof, ein kleiner Garten dahinter.
Ich wurde 1970 geboren. Meine Eltern tauften mich Fatima, was man auf Arabisch »Fatmeh« ausspricht. Als älteste Tochter genoss ich, ebenso wie der erstgeborene Sohn, Privilegien: Zwar war ich verantwortlich für den Haushalt, konnte die Hausarbeit aber an meine jüngeren Schwestern delegieren.
Auf Unterstützung bei meinen Pflichten musste ich auch nicht lange warten. 1973 kam meine Schwester Maha auf die Welt. Maha war still und schüchtern, eine fleißige Schülerin, ganz anders als ich. Sie lernte gern, während ich mich lieber draußen aufhielt, mit Murmeln spielte, Springseil mit den Kindern aus der Nachbarschaft sprang oder mit meinen Freundinnen Jasmin pflückte, den ich zu Halsketten flocht. Wurde ich ins Haus gerufen, um Schularbeiten zu machen, setzte ich mich an den Tisch – und dann starrte ich aus dem Fenster: Der fantastische Blick auf Sham war weitaus reizvoller als der Lernstoff. Was in meinen Schulbüchern stand, interessierte mich wenig, aber ich presste meine Jasminblüten zwischen ihren Seiten, damit sie herrlich dufteten.
Schon in frühem Alter wollte ich Friseurin werden. Meinen ersten Haarschnitt verpasste ich einer großen, lebensechten Puppe mit blauen Augen und langen blonden Haaren, die Maha und mir gemeinsam gehörte. Syrische Mädchen trugen die Haare sehr lang. Das war modern. Meine eigene Mähne war mir allerdings lästig, und vielleicht erfüllte ich mir selbst einen Wunsch, als ich der Puppe die Haare abschnitt. Ganz kurze Haare! Ich fand das ausgesprochen schick. Maha war anderer Ansicht. Sie heulte wie ein Schlosshund, als sie sah, was ich angerichtet hatte.
Meine Beziehung zu Mohammad war völlig anders geartet. Wir waren beide Erstgeborene. Vielleicht stritten wir deshalb so oft. Unsere Eltern nannten uns immer Tom und Jerry, nach den Cartoonfiguren aus dem Fernsehen.
»Hol mir ein Glas Wasser«, befahl Mohammad zum Beispiel genau in dem Moment, in dem ich mich zu ihm vor den Fernseher setzen und meine Lieblingssendung sehen wollte.
»Hast du keine Beine? Kannst du nicht selbst laufen?«, herrschte ich ihn an. »Ich bin doch nicht deine Dienerin. Geh und hol es dir selber.«
»Ich will nichts von der Sendung verpassen«, gab er zurück, und dann übte er seine Karateschläge an mir. Das tat weh und ich schrie. Darauf stürzte Baba ins Zimmer und brüllte: »Ihr zwei seid wie Katz und Hund.« Ohne weiteren Kommentar machte er den Fernseher aus und schickte uns ins Bett.
Damals schliefen wir drei Kinder zusammen auf einer Matratze auf dem Boden. Kaum hatte mein Vater das Zimmer verlassen, begann Mohammad, mich zu treten. Meine arme Schwester Maha fand keinen Schlaf.
1976 wurde Abdullah geboren. Ich war begeistert von meinem kleinen Bruder, obwohl ich fürchtete, dass er wie viele andere Babys sein würde, die dauernd schreien und Rabatz machen. Meine Angst war unbegründet. Abdullah war ein süßes, zufriedenes Kind, wach immer lächelnd oder wie ein Engel schlafend. Von Anfang an hatte er eine enge Bindung zu meiner Mutter. Er konnte kaum laufen, da zeigte er schon auf sie und sagte: »Setz dich, Mama.« Er versuchte, für sie den Boden zu wischen, oder holte sich einen Hocker, damit er ihr helfen konnte, den Abwasch zu machen. Abdullah war der zuverlässige Junge, den sie jederzeit zu Besorgungen losschicken konnte. »Schatz, ich brauche eine Zwiebel und etwas Zucker«, sagte sie zum Beispiel, und Abdullah rannte die Straße hinunter, um bei einer Nachbarin zu klopfen, oder eilte hinter den Gemüsehändlern her, die mit ihren Karren vorbeizogen. Wo immer er vorbeikam, wurde er angesprochen und man hatte eine Kleinigkeit für ihn: »Hier, mein Süßer, nimm einen Kaugummi«, oder »Schau mal, eine neue Murmel für deine Sammlung«. Alle liebten Abdullah, alle verwöhnten ihn. Er stand ständig im Mittelpunkt und blieb dennoch, trotz aller Zuwendung, fröhlich und freundlich. Auch bei den üblichen Zankereien auf dem Spielplatz oder geschwisterlichen Rivalitäten hielt er die andere Wange hin. Nie war er jemandem böse.
1979 kam meine Schwester Shireen auf die Welt, und 1981 unsere Jüngste, Hivron. Shireen war ruhig und zurückhaltend. Hivron allerdings war ein echtes Trotzköpfchen. Ihren Schnuller gab sie noch lange, nachdem sie aus dem Nuckelalter raus war, nicht her. Hivron war blond, eine absolut begehrte Haarfarbe in Syrien. Alle in der Nachbarschaft waren fasziniert von Hivrons langen blonden Zöpfen. Doch jedes lebhafte kleine Mädchen weiß, wie lästig lange Haare sind. Eines Morgens griff meine kleinste Schwester sich eine Schere, kletterte auf den Waschtisch und schnitt einen ihrer langen Zöpfe kurzerhand ab.
»Was hast du getan?«, schrie meine Mutter entsetzt, als sie die Bescherung sah. »Sieh dir das an!«, sagte sie zu meinem Vater.
Baba schüttelte nur den Kopf. »Wir müssen Onkel Mahmoud rufen«, sagte er. Mahmoud war der Bruder meiner Mutter. Er hatte einen Friseurladen in Rukn al-Din. Mahmoud bemühte sich redlich, Hivrons Haare wieder in Fasson zu bringen. Aber sie waren dann doch sehr kurz.
Vielleicht war ich an Hivrons Aufbegehren nicht ganz unschuldig. Mit zwölf oder dreizehn hatte auch ich mir die Haare kurz geschnitten. Eine Art Shag, so, wie Prinzessin Diana ihn bei ihrer Hochzeit getragen hatte.
»Du siehst aus wie ein Junge«, hatte mein Vater gesagt.
Ich fand es klasse. Seit jenem Tag habe ich meine Haare nie mehr länger als schulterlang getragen.
Die Familie, in die ich hineinwuchs, war eine ganz normale Mittelschichtsfamilie. Wir lebten wie viele andere. Wir waren nicht reich, doch wir litten keinen Hunger. Wenn sich die Familie vergrößerte, bauten meine Eltern um, bis für alle Platz war. Aus dem Fenster unseres gemeinsamen Zimmers sahen Maha und ich auf die Dächer der Häuser nebenan. Manche Nachbarn hielten Palmtauben, eine in Sham beliebte Vogelart mit einem zarten, fluffigen Gefieder, das an Rosé-Sekt erinnert. Wenn sie die Käfige öffneten, flogen die Tauben hoch in den Himmel. Man hätte meinen können, sie tanzen. Hörten sie den Pfiff, kehrten sie brav in ihre Käfige zurück. Ich denke gern an die Palmtauben. Ich wünschte, wir alle könnten in der Gewissheit leben, dass es, gleichgültig wohin wir fliegen, immer ein Zuhause geben wird.
Mein Vater, der Experte für Heilpflanzen und Kräuter, ließ sich als Apotheker im Al-Buzuriyah-Souk im Zentrum von Damaskus nieder. Mama war eine begabte Schneiderin mit einem untrüglichen Gespür für aktuelle Trends. Mit ihrer großen, schweren Singer nähte sie für uns hübsche Kleider, oft mehrere Sets miteinander harmonierender Teile. Meine Eltern reisten in andere Länder und brachten elegante Mode aus der Türkei, Italien und sogar Deutschland mit.
In unserem Haus auf dem Berg lebten wir fast wie im Hotel: Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Zu unseren vielen Gästen zählten die Verwandten aus Kobane, Hama, Aleppo und Amude, Freunde der Familie aus dem Ausland, und gelegentlich auch Flüchtlinge, in den 1980er-Jahren zum Beispiel einige während des Libanonkriegs mit Israel vertriebene Libanesen. Mein Vater pflegte die Gastfreundschaft, die er selbst als Kind in Armut von den Nachbarinnen in Hama und Kobane erfahren hatte. Nun hatte er ein eigenes Zuhause, und er öffnete die Türen weit für alle, die eine anständige Mahlzeit und einen Platz zum Schlafen brauchten.
»Aber Baba«, jammerten Maha und ich gern, wenn Freunde und Familie eingeladen wurden, »wir haben keine Lust mehr, hinter den Leuten herzuräumen und zu putzen.« Unser Vater aber ließ unsere Klagen nicht gelten: »Schließt niemals eure Herzen oder eure Tür vor Menschen in Not. Ladet sie zu euch ein, lasst sie an eurem Tisch Platz nehmen.«
Die Menschen, die uns besuchten, kamen aus ganz Syrien, aus Homs, Daraa, Afrin und Bosra. Sie waren Alawiten, Schiiten, Christen, Palästinenser, Libanesen, Tscherkessen, und manchmal reisten sie auch aus dem Westen an. Wir lernten, jeden zu respektieren, unabhängig von seiner Kultur und Religion. Wir lernten, dass wir unabhängig von unserer Herkunft eins sind. Jeder in der Nachbarschaft war Teil der Familie. Alle sorgten füreinander. Eine unserer Nachbarinnen und beste Freundin meiner Mutter, Emira, war eine libanesische Hebamme. Sie begleitete Hivrons und viele andere Geburten in unserem Viertel. Selbst bei der Arbeit hing eine Zigarette in ihrem Mundwinkel. Emira liebte uns über alles, und vor allem unsere Jüngste hatte sie ins Herz geschlossen. Selbst konnte sie keine Kinder haben. Eines Tages, auf dem Weg zur Arbeit im Krankenhaus, hörte sie ein Baby weinen. Ein winziges Mädchen lag am Mülleimer neben dem Klinikeingang. Sie nahm die Kleine mit hinein, und als niemand kam, um sie abzuholen, adoptierte Emira sie. Sie gab ihr den Namen Samar. Wie Emira, ihre migrantische Mama, passte auch Samar perfekt in unser nachbarschaftliches Patchwork aus guten Menschen.
Tatsächlich waren in unserem Viertel alle großzügig und freundlich. Wenn Mama und ich ins Stadtzentrum zum Einkaufen gingen oder Bekannte in einem anderen Stadtteil besuchen wollten und unterwegs durstig wurden, klopften wir einfach bei irgendjemandem an die Tür. Die Leute öffneten und luden uns ein, ins Haus zu kommen und etwas zu trinken. Wenn Maha und ich an einem heißen Junitag von der Schule heimliefen und bei einem Nachbarn vorbeikamen, der gerade seine Türschwelle wässerte, sagten wir manchmal: »Onkel, wir haben Durst.« Dann reichte er uns den Wasserschlauch, damit wir uns erfrischen und so gestärkt den restlichen Fußmarsch den Berg hinauf fortsetzen konnten.
In dieser multikulturellen Gesellschaft begingen wir auch die Feiertage, kurdische Feste ebenso wie christliche. Eine ganz wichtige Rolle in Syrien spielen die gemeinsamen Mahlzeiten. Insbesondere im Fastenmonat Ramadan, wenn man tagsüber nicht essen darf. Während des Ramadan trafen wir unsere Verwandten noch häufiger als sonst. Jeden Abend lud ein anderer Gastgeber zum Iftar, dem täglichen Fastenbrechen. Wir deckten den großen Tisch, servierten das Essen, und Baba sagte: »Alhamdulillah, wir danken Gott für dieses Mahl. Möge der Herr nie jemanden in der Welt hungern lassen.«
»Amen«, antworteten wir im Chor.
Im Fastenmonat begann jeder Morgen im wahrsten Sinn des Wortes mit einem Paukenschlag. Noch vor Sonnenaufgang weckte uns die vom Mesaharati geschlagene Trommel. »Wacht auf zum Suhûr!«, rief er. Es war der Weckruf für die Morgenspeise, die man vor dem täglichen Fasten zu sich nahm. Wir Kinder liebten den Mesaharati. Wenn wir ihn hörten, sprangen wir aus den Betten, rannten aufs Dach und starrten in die Dunkelheit, um ihn als Erste zu entdecken, sobald er in unsere Straße kam.
In die Zeit des Ramadan fallen auch die Vorbereitungen für das dreitägige Eid al-Fitr, das Zuckerfest, das auf die Fastenzeit folgt. Eid al-Fitr wird ähnlich gefeiert wie Weihnachten. Man spendet für Menschen in Not, verschenkt Geld und teilt jede Menge köstliche Speisen mit Nachbarn, Freunden und Familie. Für den ersten Festtag kauft man in der Regel auch etwas Neues zum Anziehen. Mama ging mit uns aus diesem Anlass immer in den Al-Hamidiyah-Souk, wo es Kleidung gab, und anschließend in den Al-Buzuriyah-Souk, wo wir feine Gewürze, Nüsse und selbstgemachte Bonbons erstanden. Unterwegs verweilte Mama in der Großen Moschee, um zu beten, während Abdullah und ich im riesigen Innenhof blieben, die bunten Palmtauben fütterten und uns die wunderbaren Süßigkeiten ausmalten, die wir bald essen würden.
Vor Beginn des Eid spenden Muslime für Hilfsbedürftige, ein Ritual, das man als Zakat al-Fitr bezeichnet. Auch Baba gab Geld für die Armen und half notleidenden Nachbarn. Am ersten Morgen des Zuckerfestes selbst trafen dann unsere Verwandten ein. Sie brachten Geldgeschenke für alle. Der Großzügigste war immer Onkel Mahmoud. Er hatte 500 Lira für jeden von uns. Das sind etwa zehn Dollar, eine ganze Menge Geld für ein Kind. Später präsentierten wir uns dann in unseren neuen Sachen und besuchten Feierlichkeiten, die jedes Viertel speziell für die Kinder veranstaltete.
Weihnachten begeisterte uns nicht weniger. Am Weihnachtsabend zogen wir unsere Hausanzüge an, Onkel Mahmoud packte uns in sein Auto und fuhr mit uns ins trubelige Weihnachtsviertel Bab Tuma, wo wir den Lichterglanz bestaunten. Irgendwo entdeckten wir auch immer einen Weihnachtsmann oder Baba Noel, der in seinem roten Mantel an einer Ecke stand. »Stopp!«, riefen wir dann. »Wir wollen Baba Noel begrüßen.« Wir stiegen aus und stellten uns mitten auf der Straße im Kreis um Sankt Nikolaus. Nachdenklich starrte die kleine Hivron auf seinen langen, weißen Bart. Dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen, um ihn anzufassen. Auf dem Rückweg versuchte ich mit allen Mitteln, wach zu bleiben. Meine Augen dürsteten immer nach den funkelnden Lichtern. Meist aber gelang es mir nicht, und am Ende schlief ich fast immer ein.
Ich war zehn, als meine Eltern ihr erstes Auto kauften. Jetzt reisten wir häufiger als früher. Wir besuchten Hama, den Geburtsort meines Vaters, den wir nach dreistündiger Fahrt auf der Autobahn Damaskus–Aleppo erreichten. Die Sommerferien verbrachten wir regelmäßig bei Verwandten im idyllischen Kobane. Wir zogen durch die Felder mit den Schafen von Onkel Khalid, fütterten die Hühner, melkten die Ziegen, produzierten Feta – den wir noch warm aßen – und pflückten köstliche reife Oliven in den Olivenhainen der Region. Nie werde ich den Geschmack des Wassers aus dem altmodischen Brunnen in Kobane vergessen. Es schmeckte süßer und frischer als alles, was ich bis dahin und seitdem gekostet habe.
Der mächtige Euphrat war unser Lieblingsschwimmbad. In Kobane war der Fluss relativ ruhig. Mohammad und Abdullah lernten im Euphrat schwimmen. Ich war zu feige; ich hatte immer schon Angst vor Wasser. Mein Vater lachte, schüttelte den Kopf und sagte zu mir: »Dein Sternzeichen sind die Fische. Du bist ein Kind des Wassers, genau wie dein Bruder Abdullah. Und trotzdem bist du wasserscheu.«
Ich saß lieber am Flussufer und sah meinen Brüdern beim Schwimmen zu, während sich die Familie über ihr Picknick hermachte. In der Ferne sahen wir die Türkei.
»Irgendwann besuche ich Istanbul«, sagte ich zu meinen Geschwistern.
»Mir gefällt es hier«, antwortete Abdullah. Er liebte das Leben auf dem Land. Von Beginn an hatte Kobane einen festen Platz in seinem Herzen.
Die Ferien meiner Jugend verbrachten wir in den fantastischen Badeorten Latakia, Baniyas und Tartus an der syrischen Mittelmeerküste. Immer wieder nahm ich meinen Mut zusammen, um im Meer zu schwimmen. Doch kaum berührte das Wasser meine Knie, hatte ich das Gefühl zu ertrinken. Natürlich war es wenig hilfreich, dass Abdullah die ganze Zeit herumalberte, mich an den Beinen runterzog oder mich ins Wasser schubste.
Was all diese Jahre auszeichnet, waren die Menschen, die Musik und das Lachen, die ständig unser Haus erfüllten. Der Grund für ihre Anwesenheit war nicht nur die Politik der Offenen Tür meines Vaters, sondern auch die Küche meiner Mutter. Ihre Küche war quasi das Nachbarschaftszentrum. Nachbarinnen schauten auf einen Kaffee oder einfach so kurz vorbei, um dann zum Markt zu gehen und einzukaufen.
Der traditionelle arabische qahwah wird zubereitet, indem man den gemahlenen Kaffee auf dem Herd in Wasser aufkocht. Meine Eltern liebten Kardamom. Wenn wir beim Markthändler Kaffee kauften, baten wir immer: »Könnten Sie eine Extraportion Kardamom dazulegen, bitte?« Der Verkäufer antwortete: »Natürlich.« Und er fügte hinzu: »Es ist mir ein Vergnügen.«
Die Frauen versammelten sich in der Küche meiner Mutter und warteten darauf, dass der Kaffee gebrüht würde. Sie plauderten über aktuelle Ereignisse und über ihre Träume. Das ist typisch für Syrien und weite Teile des Nahen Ostens: Träume haben eine große Bedeutung und man glaubt, dass sie verraten, was geschehen wird – das Wetter, das politische Klima und Persönliches, von neuen Jobs bis zu anstehenden Hochzeiten, Geburten und Todesfällen. In Syrien liest man gern aus dem Kaffeesatz, ähnlich wie man im Westen Horoskope studiert.
Gleichgültig aus welchem Anlass, sei es die Zusammenkunft der Frauen in der Küche meiner Mutter, ein religiöser Feiertag oder ein Familienfest: Bei uns zu Hause wurde immer geredet, gesungen, getanzt. Wir hörten Musik und – ganz wichtig – wir lachten. Alle Mitglieder meiner Familie hatten Humor, und auch ich lernte lachen, vor allem über mich selbst. Wann und wo auch immer Syrerinnen und Syrer zusammenkommen, werden Witze erzählt. Vielleicht werden sie in anderen Kulturen nicht immer verstanden, doch Lachen ist eine universelle Sprache, eine Brücke zwischen den Kulturen, und wenn die Absicht eine gute ist, geht in der Übersetzung auch nichts verloren.
Der Freitag ist für Muslime, was der Sonntag für die westlichen Kulturen ist. Das muslimische Wochenende beginnt am Donnerstagabend. Wir feierten das bei uns zu Hause immer mit Partys, die begannen, kaum dass wir aus der Schule gekommen waren. Unsere weiblichen Verwandten und Freundinnen besuchten uns mit ihren Kindern, und wir spielten die traditionelle Musik des Orients, der Kurden und der Beduinen. Es dauerte nie lange, bis wir uns erhoben und tanzten. Syrische Frauen wissen, wie man feiert. Sie mischen traditionelle arabische Tanzstile, wie Bauchtanz, Dabke und Volkstänze, die man im Kreis oder in einer Reihe, sich mit dem kleinen Finger unterhakend, tanzt, mit modernen, westlichen Bewegungen.
Abdullah war der Star jeder Party. Er konnte jeden in unserer Familie imitieren und schlüpfte mit Begeisterung in ganz verschiedene Rollen. So wurde er zum Beispiel zum mürrischen, alten, buckligen Schäfer, der auf seinen Stock gestützt in unseren Tanzkreis stolperte. Dann wieder wurde er zu einem jungen Akrobaten, der sich zu einer Volksweise bewegte, oder er tanzte wie ein Russe. Abdullah brachte uns zum Lachen, bis wir nicht mehr konnten.
Abdullah widerfuhren überdies dauernd Missgeschicke. Als kleiner Junge stopfte er sich einmal Bohnen in die Nase und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo man sie wieder rausholte. Später, wenn er Erledigungen für andere machte, rannte er oft schneller, als ihn die Füße trugen. Einmal stürzte er die steile Treppe vor unserem Haus hinab und schlug mit dem Kopf auf dem Betonboden auf. Wieder musste er ins Hospital, wo er genäht wurde. Bei einem Besuch in Kobane stolperte er rückwärts gegen eine Kerosinlampe, die unter seinem Gewicht zerschellte. Dieses Mal brauchte er zwölf Stiche. Wann auch immer er sich verletzte, sagte meine Mutter: »Dauernd passiert ihm etwas, aber er überlebt immer. Dieser Junge genießt mala’ekah, den Schutz der Engel.« Meine Mutter mit ihrer Gabe schien da bereits etwas zu sehen, was wir nicht sehen konnten.