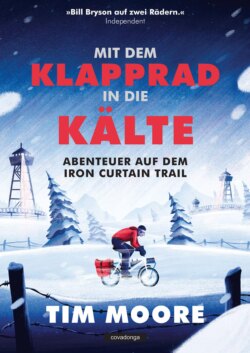Читать книгу Mit dem Klapprad in die Kälte - Tim Moore - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. DER WINTERKRIEG
»Bitte, irgendwas. Brot? Ich sitze auf einem Fahrrad. Es gibt keine Geschäfte. Bitte.«
Zwei Tage unterwegs und ich bettelte schon um mein Leben. Die Vermieterin der Ferienhütte am See erwies sich am Telefon als widerwillige Samariterin; ich hatte soeben ihre Erklärung unterbrochen, dass der Preis von 85 Euro pro Nacht ihre Gäste keineswegs berechtigte, einen Anspruch auf Bettwäsche, Handtücher oder Nahrung jeglicher Art zu erheben. Bis zur Hütte waren es noch mehr als 20 Kilometer, das Tageslicht war eisig, fahl und brüchig, und der nächste Ort, wo ich etwas zu essen kaufen könnte, war die Stadt, von der aus sie mit mir sprach, weitere 60 Kilometer entfernt. Der einzige Trost war, dass Finnlands tiefe Verbundenheit mit Mobiltelefonie mir selbst hier, am einsamen, eisigen Arsch der Welt, eine Signalstärke von drei Balken bescherte.
Ein leidgeprüfter Seufzer knisterte aus dem Lautsprecher, schließlich gefolgt von Worten: »Ein paar andere Leute sind auch noch da. Ich rede mit ihnen und vielleicht sie geben Ihnen was zu essen.«
Für einen Radfahrer ist Schnee wie Sand. Falls Sie mal am Strand Rad gefahren sind, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich das auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit des Vorankommens auswirkt. Jeder Kilometer war eine Quälerei aus Keuchen und Schlittern, ein weiterer Kampf im aussichtslosen Unterfangen, eine feindliche Umgebung zu bezwingen. Ich blickte durch meinen vliesgerahmten Schlitz auf vereiste Seen und Wälder, mein gedämpftes Schnauben war der einzige Laut in einem tiefgekühlten Reich weißer Stille. Ich sah meine ersten Rentiere, eine schwermütige, graubraune Kolonne, die mit hängenden Geweihen auf ihrer einsamen Wanderschaft in den Schmortopf eines Bauern durch den Schnee stapfte. Vielleicht ein Mal in der Stunde knatterte ein Auto vorbei, gesteuert von einem Stoiker, der mit ausdrucksloser Miene und einer Kippe zwischen den Lippen unter einer Seemannsmütze hinweglugte. Um mein Band mit der Menschheit nicht abreißen zu lassen, grüßte ich jeden einzelnen von ihnen, wobei ich mit meinen mehreren Schichten an Handschuhen, die wiederum in Lenkerstulpen steckten (so der Name dieser am Lenker befestigten Ofenhandschuhe), nicht mehr zustande brachte als ein Zwinkern. Bis dann die Temperaturen auf minus 13 Grad sanken und meine Lider anfingen festzufrieren.
Bevor ich aufgebrochen war, hatte ich mich über die Risiken und Vorzüge von Radtouren bei extrem kalter Witterung informiert, die online von einer tapferen Bruderschaft von »Eisrad«-Enthusiasten erläutert wurden. Die Vorzüge erschienen mir vage und gering an der Zahl und beschränkten sich auf eine Handvoll rhetorischer Fragen, die nach harschen Entgegnungen schrien: »Suchst du einen Ort, um zu reflektieren und runterzukommen?« »Willst du deine eigenen Grenzen austesten?« »Reizt es dich, dir deinen ganz persönlichen Weg durch die arktische Wildnis zu bahnen?« Eigentlich nicht. Nö. Ganz und gar nicht.
Die Nachteile hingegen lasen sich wie eine endlose Litanei der Gefahren und der Not. In den brutalen Tagen, die vor mir lagen, wurde ich regelmäßig mit den entsetzlichsten unter ihnen konfrontiert. Die meisten drehten sich um die selbstmörderisch launenhaften Reaktionen von Körper und Geist auf extreme Kälte. Man denke nur Captain Oates aus Robert Scotts Expeditions-Team: Als er auf dem traurigen Rückmarsch der Unterlegenen im Wettlauf zum Südpol Erfrierungen erlitt, schlief er fortan mit den Füßen außerhalb des Zelts, weil er die Schmerzen, wenn seine Mauken drinnen auftauten, einfach nicht ertragen konnte. Hut ab – da hatten Durchblutung und Nervensystem wahrlich ein meisterliches Zusammenspiel demonstriert. (Schon tragisch, wenn man bedenkt, dass Oates, hätte er bloß ein paar Plastiktüten unter den Socken getragen, nur 13 Tage später zusammen mit allen anderen hätte verhungern können.)
Dann ist da noch jene todesbegrüßende Bewusstseinstrübung namens Hypothermie. Als Reaktion auf intensive, aber an sich noch nicht letale Kälte gerät das Gehirn ebenso rasch wie extrem in eine Art Rauschzustand und beginnt, anderen leichtgläubigen Körperteilen lustige Streiche zu spielen.
Die Hände, eben noch durchgefroren, fühlen sich plötzlich herrlich warm an. Die Augen beschließen, dass die Karte verkehrtherum mehr Sinn ergibt, und die Ohren teilen einem mit, dass hinter der nächsten Anhöhe soeben ein Rettungshubschrauber gelandet ist. Ehe man sich versieht, tragen einen die Beine von den ausgetretenen Pfaden herunter und schnurstracks hinein in den dichten, verschneiten Wald, wo sie auch ohne die lästigen Stiefel prima zurechtkommen.
Um dieses heimtückische Gebrechen abzuwehren, musste man, so hatte ich gelernt, zunächst einmal den inneren Feind bezwingen: Schweiß. Wenn sich die Ausdünstungen unter mehreren Schichten Textil sammeln und nicht (würg) abtransportiert werden, können sie bei sehr kalter Witterung anfrieren. Dies geht zu Lasten der ungemein wichtigen Körperkerntemperatur, und wenn das passiert, steht man bereits mit einem nackten Fuß im Grab. Seit dem Zwischenfall mit den gefrorenen Anorak-Ärmeln war ich in ständiger Alarmbereitschaft im Hinblick auf Schweiß und seine Ursachen, ein paranoider Zustand, der bereits früh am Morgen einsetzte, noch bevor ich mich überhaupt auf den Weg machte. In sämtliche Kleidungsschichten eingepackt würde ich binnen zwei Minuten anfangen, wie eine gesalzene Schnecke zu schäumen. Die Lösung war, in Thermoweste und langen Unterhosen zu frühstücken – es tut mir so leid, liebe Hauswirtinnen –, bevor ich die restliche Kleidung in einer Art kontrollierter Raserei anlegte und dann wie eine aufgequollene Sexpuppe raschelnd in die Arktis hinauswatschelte.
Das war der leichte Teil der Übung. Sobald der Körper unterwegs normale Betriebstemperatur erreichte, trieb mir schon die geringste Anstrengung den Schweiß aus allen Poren. Ich war am Vormittag mit dem Schrecken davongekommen, als mir an einem kleinen Anstieg kurzzeitig der Ellenbogen gefror, aber sofern ich vor Einbruch der Nacht meine Unterkunft erreichen wollte, stand mir nun ein unvermeidlicher Kraftakt bevor, der einer Einladung für heftigste Transpiration gleichkam. Und dabei war das teuflische Dilemma, das mir einer der vielen launenhaften Fallstricke der Psycho-Physiologie bescherte, noch nicht einmal berücksichtigt: Wenn es etwas gibt, was einen garantiert wie ein Schwein schwitzen lässt, dann das Wissen darum, dass genau das dich umbringen könnte.
Inzwischen war es weit nach 18 Uhr und der lange Abschied der Sonne vergoldete die alabasterne Wildnis auf eine Weise, die durch eine beheizte Windschutzscheibe betrachtet sicherlich wundervoll aussah. Ich senkte meinen glasigen Blick auf den Bildschirm des Garmin und sah zu, wie die Temperaturanzeige auf minus 14,2 Grad sank. Ein jämmerliches Schniefen ließ knisternd meine Nasenhaare gefrieren. Irgendwo unter den sechs Schichten aus Gummi, Merinowolle und Plastik erstarben meine Zehen mit einem gepeinigten Klagen, das im erstarrten Gehölz um mich herum verklang. Viel bedenklicher aber waren die Meldungen, die ich von innerhalb meiner Lenkerstulpen vernahm: Die dreifach behandschuhten Finger, die den ganzen Nachmittag den Lenker umklammert hatten, schienen nun förmlich zu glühen und sehnten sich danach, aus ihrem vierwändigen thermischen Gefängnis befreit zu werden. Eisheilige Scheiße! Da waren sie, die rauschhaften Wahnvorstellungen der Unterkühlung, die mich zu einem friedvollen, sinnlosen Tod verleiten wollten. Allein der Gedanke presste meine Schweißdrüsen wie reife Zitronen aus; beide Achselhöhlen kribbelten und ein Rinnsal rann meinen Nacken hinunter. O Gott, nein! Ich wölbte meinen Rücken, um diese schändlichen Vorboten mit sanftem Druck gegen saugfähiges Textil zu tilgen, und machte dabei eine Entdeckung, die einen dampfenden Schrei des Entsetzens in die arktische Ödnis schickte: Mein Anorak, das ganze Teil mitsamt Ärmeln, Rumpf, Kragen et cetera, war von innen festgefroren, ein Exoskelett aus geeistem Schweiß, das ich ablegen und neben mir in den Schnee hätte stellen können. Um mich dann mit ihm zu verbrüdern und Arm in Arm in Richtung des Rettungshubschraubers zu stapfen, der jenseits der verschneiten Anhöhe wartete.
Entzug, Verwirrung, Schläfrigkeit, Irrationalität – im Geiste ging ich verzweifelt die verschiedenen Phasen hypothermischer Bewusstseinstrübungen durch, die einer Infografik aus dem Internet zufolge dem Scheintod vorausgingen. Insbesondere versuchte ich mich derjenigen zu entsinnen, die mit der gefürchteten Fußnote »in dieser Phase sind Sie möglicherweise schon viel zu hinüber, um das Problem zu erfassen« versehen war. Es half wenig, dass schläfrige, irrationale Verwirrung seit 48 Stunden mein Grundzustand war. Anschließend kam mir der Verdacht, dass der bloße Akt, einen solchen inneren Monolog zu führen, bereits belegte, dass ich schon viel zu hinüber war, um das Problem zu erfassen. Wie weit noch? Mit einem ersterbenden Stöhnen schaute ich auf das Garmin und sah nichts weiter als einen leeren Bildschirm – der Akku war leer. In meinem Inneren wallte Hysterie auf. Waren es noch fünf Kilometer? Oder zehn? Der Himmel blendete von Dämmerung zu Dunkelheit ab und ich hatte seit mindestens zwei Stunden kein Auto mehr gesehen. Als sich die Straße nun auch noch aufwärts zu winden begann, ergab ich mich nackter Panik und trat so fest in die Pedale, dass mein genopptes Hinterrad wüst durch den Schnee und das darunterliegende blanke Eis schlenkerte. Der Schweiß rann längst in Strömen, enteiste meine Lider und brannte in den geröteten Augäpfeln dahinter. Mit übermenschlicher Anstrengung beruhigte ich meinen Atem, schlitterte zum Stillstand und stieg ab, um zu schieben. Schon besser. Eile mit Weile, immer mit der Ruhe, der Scheintod kann warten. Bisschen rutschig in diesen Stiefeln, gewiss, aber … swiiiesch … nur einen Fuß vor … swiiiiiiesch … den anderen und bald bin ich … swiiiiiiiiiesch-zwosch-FLOMP.
Ich saß da und sah das gebeutelte MIFA sachte den Hügel zurückrutschen, während ich durch einen verkrusteten Fleeceschlitz Reste von Körperwärme ausatmete. »Die erste Regel des Arctic Bike Club lautet: Tritt nicht dem Arctic Bike Club bei.« Mein Nachruf verklang zu einem Röcheln. »Ende der Regeln.« Dann wandte ich den Kopf und da, durch die Bäume und das vereiste Halbdunkel blinzelnd, sah ich eine Ansammlung von Lichtern.
So liefen die längsten, härtesten Tage meines ganzen Lebens ab. Ein jeder Morgen fing an mit übernächtigten, ängstlichen Blicken hinaus durch mehrfachverglaste Schlafzimmerfenster zum düsteren Himmel, auf das Thermometer, das außen an den Fensterrahmen genagelt war, und auf die unsteten Slalomspuren darunter, die meine Reifen am Abend zuvor in den Schnee gezeichnet hatten. Zwölf Stunden später strauchelte ich an eine Hotelrezeption oder in eine Blockhütte oder auf eine Rentierfarm oder in eine stillgelegte Bank und stand schlotternd und schmelzend da, während mein eisgekühltes, unterernährtes Hirn sich mühte, Gedanken in Sprache umzuwandeln.
Der Winter kämpfte pflichtgemäß bis zum letzten Mann, und obwohl ich immer weiter Richtung Süden kroch, hielt die kleine rote Quecksilbersäule standhaft die Stellung in den entsetzlichen Tiefen des Thermometers. Gegen Mitte des Vormittags waren meine Füße einer widernatürlichen Marter ausgesetzt, die deren Sohlen wie mit einem glühend heißen Eispickel versengte. Der Preis für einen einzigen Nachmittag, an dem ich mich zum Tauen in der gleißenden, arktischen Sonne nur ein wenig entblößte, war ein verbranntes, von Blasen übersätes Gesicht – im Hauruckverfahren hatte ich mich in ein perfektes Ebenbild des entstellten Ralph Fiennes verwandelt, eine Art englischer Patient des Nordens. Es würde Wochen dauern, bis ich Gras, Asphalt oder Wasser zu sehen bekäme, das nicht aus dem Hahn kam.
Am Morgen nach meinem Flirt mit dem Kältetod sanken die Temperaturen auf erfrischende minus 22 Grad Celsius. Es war so kalt, dass ein eisiger Dunstschleier in der Luft lag und jeder Atemzug meine Kehle wie die Faust eines Todessers traf. »Aber unsere Kälte hier ist eine Art trockene Kälte«, klärte mich einer der Schneemobil fahrenden Burschen im Wollpulli auf, vor deren Wochenendhütte ich beinahe gestorben wäre.
Netter Versuch, dachte ich, während ich einen Löffel Rentiersuppe zwischen die klappernden Zähne fummelte. Eure Kälte hier ist eine Art bekackte Kälte. Erdrückende Kälte war das, was Nordfinnland am besten konnte, und häufig verlebte ich Nachmittage ganz für mich alleine, an denen ich der grenzenlosen, urwüchsigen Szenerie dabei zusah, wie sie sich kein bisschen veränderte, und ich mich fragte, ob die örtlichen Behörden den menschlichen Winterschlaf eingeführt hatten.
Selbst die große Nationalstraße, die ich zwei Tage entlangschlich, war eine Geisterstraße. Die Ortschaften lagen so weit auseinander, dass meine Augen feucht wurden, wann immer ich mich einem der schwarzgelben Schilder näherte, die ein bevorstehendes Wiedersehen mit einem dieser wundervollen Orte versprach, an die ich mich dunkel erinnerte, wo Menschen lebten und Dinge taten. Ah, eine Tankstelle, eine bemützte Familie, die drinnen im Café Würzsoßen über einer Schuhschachtel Pommes frites verteilt, ein Mann, der sein Schneemobil mit Super bleifrei betankt. Der Klang der Stille endlich durchbrochen von Kettensägen und Gebell; eine ganze Palette an Gerüchen jenseits von Kiefernharz. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass diese Orte nicht sonderlich reizvoll waren, ihre vereisten Straßen breit, aber leer, eintönig gesäumt von niedrigen Verwaltungsgebäuden und anderen von Schneematsch eingefassten Studien in Nachkriegsbeton. Aber selbst als ich es bemerkte, war es mir egal.
Zwischen diesen seltenen urbanen Oasen erstreckten sich gähnend leere Weiten verschneiter Wälder und gefrorenen Wassers. Ich blickte auf die endlosen Horizonte fichtenumstandener weißer Seen und dachte, sagte und grölte: FINNLAND, LAND DER KONTRASTE. Die Wälder fingen an, mir Angst zu machen, so dunkel und urwüchsig waren sie, die furchteinflößende Kulisse einer Million unheimlicher Geschichten seit Anbeginn der Zeiten. »Ihresgleichen suchen die Wälder Finnlands, von denen 4,4 Hektar auf jeden Finnen entfallen!« Selbstkomponierte Werbe-Jingles zu trällern, schien eine gute Idee, um mich bei zu Laune zu halten. Stattdessen klangen sie wie berühmte letzte Worte in einem Slasher-Film.
Während ich weiterkroch, erlag ich einem ungewöhnlichen Trio der Leiden: Erschöpfung, Schrecken und Langeweile. Anfangs hatte die verschneite Ödnis die schroffe und schreckliche Majestät einer Verwünschung aus dem Märchen verströmt, aber ihre strenge Schönheit verblasste allmählich. Und so fiel mein Blick unweigerlich auf den Garmin-Bildschirm mit seinem entmutigenden Protokoll eisigen Stillstands.
Polares Klappradfahren ist eine unbarmherzige Geliebte mit einem Hang zu langwierigem tantrischen Sadismus. Jeder Tag schien eine Woche zu dauern, eine sisyphosartige Tortur von schlitternder Trägheit. Ich rang darum, meine althergebrachten Vorstellungen von akzeptablem Vorankommen neu zu definieren. In der Ebene bedeuteten 14 km/h ein halsbrecherisches Höllentempo; der kleinste Anstieg zog mich hinunter in den einstelligen Bereich und ließ mich das Schicksal von Captain Scotts Männern nachempfinden, die ihre Schlitten selbst das Schelfeis hinaufschleppen mussten, nachdem ihre Ponys erfroren waren. Das Garmin addierte die Zehntelkilometer mit so kläglichem Widerwillen, dass ich mehrmals glaubte, das Gerät habe den Dienst quittiert. Manche dieser 100-Meter-Epsioden zogen sich endlos in die Länge, aber ich hielt ihrem Blick bis zum bitteren Ende stand, wie Gollum vor dem Videotext. Ich kann mich noch gut an 267,3 erinnern. Oder 324,9 – auch nicht zu verachten. Wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein. Seien Sie heilfroh, dass Sie es nicht waren.
Und der Schnee fiel immer weiter, mal peitschte er mir schmerzhaft in die Augen, mal häufte er sich auf den Lenkerstulpen und dem Gepäckträger, mal bedeckte er die ganze weite Welt. Und er würde noch ein Weilchen bleiben. Um mich zu vergewissern, dass es der März war, in dem Finnland unter der tiefsten Schneedecke lag, brauchte ich mich nur einen Schritt von der Straße zu entfernen und schon stand ich hüfthoch in den weißen Massen. Ich war somit ein Gefangener der Straße, gezwungen, sämtliche sattelfremden Bedürfnisse an einsamen Bushaltestellen zu verrichten, die alle paar Kilometer die Straße säumten. Wärme wurde schmerzhaft in die Füße gestampft, Supermarkt-Burger vom Handschuh in den Mund gefummelt, verfärbte Löcher dampfend zurückgelassen.
Zwei oder drei Mal am Tag kündigte sich unter entsetzlichem Getöse das Nahen einer »Arctic Machine« an – ein infernalischer, unerbittlicher Schneepflug, mit eben diesem Schriftzug auf der angsteinflößenden Schaufel. Ich lernte auf die harte Tour, dass dies das Signal war, das Rad in die Schneewehen am Straßenrand zu schmeißen und mich hinter die Gepäckträger zu ducken, das Gesicht gen Wald gerichtet und die Arme schützend um den Kopf gelegt. Sobald das grelle Dröhnen seinen Höhepunkt erreichte, brach eine Bugwelle aus Schnee und verdichteten Eisbrocken über mich herein, gefolgt von dem grobkörnigen Tornado, den hier oben jedes größere Fahrzeug hinter sich herzog. Ehrlich gesagt, genoss ich diese schmerzhaften und furchterregenden Kanonaden sogar, einfach weil sie mir etwas anderes zu tun gaben, als sehr langsam in einen Schneesturm zu fahren oder mir an einer Bushaltestelle auf die Handschuhe zu pinkeln.
Die Eingeborenen, die mir in diesen schwierigen Tagen begegneten, machten sich sämtliche nationalen Stereotypen zu eigen, sprich: alle beide. Es ist ein Land, dessen selbstreferentieller komödiantischer Wortschatz sich ganz dem schwermütigen Alkoholismus verschrieben hat. Ein ganzes Witzgenre ist den haarsträubenden Abenteuern zweier Männer gewidmet, die mit einer Kiste Wodka in einer einsamen Hütte festsitzen. Einer meiner Favoriten ist der, in dem Kimi den Geräteschuppen durchwühlt, nachdem die letzte Flasche geleert worden ist, und mit einem Kanister Frostschutzmittel zurückkommt.
»Wir könnten das hier trinken«, teilt er seinem Freund mit, »aber wir würden wahrscheinlich erblinden.«
Mika sieht sich bedächtig in der Hütte um und schaut aus dem Fenster, dann sagt er: »Ich glaube, wir haben genug gesehen.«
Jeder Dorfladen, den ich betrat, beherbergte einen unrasierten, nach Alkohol riechenden Mika vom Schlage des Burschen, der mir Rentier-Eintopf kredenzt hatte, der verstohlen durch den Gang mit Apfelwein schlich (alles über fünf Prozent erforderte den Besuch in einem dieser Triumphe des Wohlfühl-Brandings, dem staatlichen »Alko«-Laden). So war auch jener Schneemobilfahrer im Wollpullover just in einen Nahkampf mit einem Drei-Liter-Kanister Wein verwickelt, als er mich über Lapplands »trockene Kälte« aufklärte. (Als ebenso vielsagendes wie beschämendes Zeugnis meines geschmälerten Zustands dauerte es eine Woche, ehe ich mich der Halbliterflasche norwegischen Wodkas aus dem Duty-free-Shop erinnerte, die in den Tiefen meiner Gepäcktaschen vergraben lag. Und eine weitere Woche, bis ich den Dirty Rudolf perfektioniert hatte: zwei Teile Wodka, ein Teil High5-Energydrink mit Citrus-Geschmack.)
So wie der Winter, der ihre Heimat prägt, können auch die Finnen schroff und unterkühlt rüberkommen. Ich hörte nie jemanden laut werden oder jubeln oder schallend lachen. Um es mit Dorothy Parker zu sagen: Sie durchliefen das Spektrum der Emotionen von A bis B. Es wäre aber verfehlt, diesen reservierten Mangel an Leidenschaft als Herzlosigkeit oder Verachtung zu interpretieren.
Ich machte diesen Fehler wieder und wieder. Ich machte ihn, als mich die Schneemobilfahrer, als ich halbtot an ihrer Schwelle erschien, mit der Bitte begrüßten, die Stiefel auszuziehen, da sie eben gefegt hätten. Ich machte ihn, als ich, just einem Schneesturm entronnen, den UPS-Fahrer nach dem Weg fragte und er antwortete: »In den Alpen ist gerade ein Flugzeug abgestürzt. Alle sind tot. Alle.« Und ich machte ihn, als eine betagte Hotelwirtin mir den Weg zum Restaurant erklärte, indem sie zunächst auf den kleinen Tankstellenshop gegenüber und dann auf eine Mikrowelle im Flur wies.
Das letzte Mal machte ich ihn kurz nach meinem ersten Platten, den ich rätselhafterweise auf einer dicken Schneedecke mitten im ganz gewöhnlichen Nirgendwo erlitt. Als ich mit bloßen und kreischenden Fingern den hinteren Reifen von der Felge fummelte, rumpelte am bleichen Horizont ein uralter Audi heran und hielt geräuschvoll neben mir an. Das Fenster senkte sich quietschend und das schwermütige Wehklagen einer Blues-Gitarre jammerte heraus, gefolgt von einem rotbärtigen Gesicht. »Ich schätze, du bist nicht von hier«, sagte dessen Träger im üblichen tonlosen Singsang und ich bestätigte, dass er das ganz richtig erfasst habe. Er knipste die Stereoanlage aus und nahm teilnahmslos meine missliche Lage in Augenschein. »Ein Fahrrad ist keine gute Idee. Dieses Fahrrad ist erst recht keine gute Idee.« Dann nickte er, drehte Blind Kimi wieder voll auf und rief zum Abschied: »Wenn du Hilfe brauchst, wirst du fragen.«
Die Erkenntnis dämmerte mir, während ich den Audi davoneiern und -schlittern sah. In seinen Worten lag keine Böswilligkeit oder Geringschätzung, sondern nichts als die reine Wahrheit, schonungslos vorgetragen. Die Finnen sind ein Menschenschlag weniger Worte, Meister des Understatements und der Unverblümtheit. Von einem Finnen würde man niemals verscheißert werden. Unerschrockene, hartgesottene Reisen waren hier oben Teil des winterlichen Alltags, meine kleine Unternehmung würde also niemanden beeindrucken. Und es war ja nicht so, als hätte man mich gezwungen, mir das hier anzutun, ganz gewiss nicht zu dieser Jahreszeit und mit dieser Art Fahrrad. Wenn ich beschlossen hatte, mir die Sache so schwer wie möglich zu machen, war das ganz allein meine Schuld. Rotbart hatte einfach gesagt, wie es ist. Sein Land war ein Land rigoroser Aufrichtigkeit, wo das Kind beim Namen und ein blödes kleines Rad ein blödes kleines Rad genannt wird. Wo man Hilfe bekam, wenn man danach fragte, aber ansonsten eben nicht. Wohin schlechte Ideen sich aufmachten, um zu sterben.
Mein Vorankommen wurde laufend von Erinnerungen an die vielgestaltige Schlechtheit meiner Idee unterbrochen. Da waren diverse höhnische Memento angenehmerer Jahreszeiten, sei es ein umgedrehtes Kajak am Ufer eines zugefrorenen Sees oder eine Wiese voller im Schnee versunkener Wohnwagen. Ein Skilangläufer, der mühelos an mir vorbeizog. Eine alte Dame, die ihre wöchentlichen Einkäufe auf einem Schlitten heimwärts schleppte. Mein Eintreffen, nachdem ich schon tagelang südwärts geackert war, am immer noch nördlichsten Touristenziel der gesamten Europäischen Union, dem hervorragend erschlossenen Skiresort Saariselkä (wo ich natürlich im Santa’s Hotel abstieg und selbstverständlich – schaut jetzt nicht hin, Kinder – eine Rentierpizza aß). Am Abend danach rief ich zu Hause an und erfuhr von meinem Sohn, dass ich mich noch immer sieben Breitengrade nördlich von Anchorage in Alaska befand.
Jeder Morgen bedeutete den Beginn einer neuen Expedition, hinein in die unbewohnte Leere mit nichts als blinder Zuversicht und drei Schüsseln Pensions-Porridge, um mir Kraft bis zum nächsten Etappenziel zu geben. Mehr als ein Mal schleppte ich mich röchelnd in die erste und einzige Ansiedlung, auf die ich an diesem Tag stoßen würde, nur um den einzigen Laden oder das einzige Café geschlossen vorzufinden. Bei einer dieser Gelegenheiten, als ich im Örtchen Tanhua meine verzweifelte Visage gegen eine verschlossene Glastür presste, entdeckte ich im Inneren ein winziges altes Weib, das Regale einräumte. Vom Hunger in einen Zustand jenseits jeglichen Anstands getrieben, gelang es mir mit ungebührlichem Geschrei und Gehämmer ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Nur um sie durch meine anschließende Pantomime, eine primitive Karikatur gieriger Nahrungsaufnahme, gleich wieder einzubüßen. Ihre Augen weiteten sich, sie schüttelte langsam den Kopf und zog sich zu meinem Entsetzen ängstlich in einen dunklen Gang zurück.
Während sie den Rückzug antrat, erblickte ich mein Spiegelbild im Glas. Der Mann, den ich vor mir sah, war kein naheliegendes Objekt des Mitgefühls. Ein beständiger Gegenwind hatte die Spitze meines Kapuzenschals zu einer Klans-Mütze zurechtgeblasen. Vom regelmäßigen Beschuss mit vereistem Splitt gerötet, glühten meine Augen aus dem darunterliegenden Schlitz hervor. Ergänzt um die schlabberige Warnweste, ging meine Aufmachung ohne weiteres als die eines Terroristenführers durch. Arme alte Frau. Aber es waren noch 43 Kilometer bis Mrs. Santa’s Cabin in Savukoski, und nur mit einem tiefgekühlten Snickers, das sich irgendwo in den Tiefen meines Anoraks verbarg, würde ich das nicht schaffen.
»Hey. HEY!«
Das Glas bog sich und sang wie eine Säge unter den wütenden Schlägen meiner Fäustlinge, was neben meinem unmäßigen Geschrei erklären mag, warum ich nicht bemerkte, dass ein Wagen der Polizei eingetroffen war, bis mir einer der Insassen auf die Schulter tippte. Als ich mich umwandte und in das Gesicht einer jungen Beamtin blickte, tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass ich, egal wie das hier ausginge, zumindest nicht verhungern würde.
»Gibt es hier ein Problem, ja, nein?«
Ich schilderte meine Notlage und mit einem knappen Nicken schritt sie wortlos zur Ladentür, die geöffnet wurde, noch bevor sie klopfen konnte. Als sie wieder herauskam, hatte ich bereits angefangen, die Vorzüge einer mit Freiheitsentzug einhergehenden Lösung zu erwägen, die mir im Zuge einer Verurteilung wegen Störung der öffentlichen Ordnung eine Woche warme Unterkunft bei freier Verpflegung bescheren würde. Doch es sollte nicht sein. »Sie werden ihr Essen kaufen, ihre Küche benutzen und ihren Kaffee trinken.« Ich dankte der Beamtin recht unbeholfen, dann blickte ich an ihrer unergründlichen Miene vorbei auf die sehr ergründliche Miene der Inhaberin, die sich hinter der geöffneten Tür zu einem matten Versuch des Willkommens verzog. Wenn du Hilfe brauchst, dachte ich, wirst du fragen. Und dann dachte ich: Was auch immer du sonst anstellst, versuche so was niemals ins Russland.
Über lange Tage hatte ich mich auf meiner Route immer weiter von der Grenze entfernt, der ich hatte folgen wollen – keine arktische Einöde ist so öde wie der Nordosten von Lappland und keine Bewohner bedeutet auch keine Straßen. Doch nun, nachdem er mit Nachdruck ostwärts beigedreht hatte, nahm der EV13 direkt Kurs auf Russland: Ich hatte endlich die Fährte des Bären aufgenommen und mit ihm auch eine schwache Witterung des Eisernen Vorhangs. Die Souvenirshops in Saariselkä waren voller kyrillischer Schlüsselanhänger gewesen und als ich am Abend danach in meiner Fischgeschäft-Café-Hütte (ja, echt) den Fernseher anmachte, wurde ich von einem ausdruckslosen Nachrichtensprecher begrüßt, der genehmigte Informationen von einem Ticker voller spiegelverkehrter Rs las. Der Café-Betreiber erzählte mir, als er mir das Abendessen servierte, dass wohlhabende russische Besucher den Tourismus hier oben in den letzten Jahren ziemlich umgekrempelt hätten. Der ernüchternde hauptsächliche Köder: nicht-gefälschte Luxuswaren. »Sie sagen, in Russland könnte alles gefälscht sein, sogar Schuhe und Whisky.« Aber dann hatte sich der Rubel ausgerollt und fast über Nacht war der Devisenfluss verebbt. »Das kostet mich jeden Monat 10.000 Euro.« Er seufzte und räumte den leicht mit Rentier-Eintopf-Resten verschmierten Teller ab. Es würde noch zwei Tage dauern, bis ich meinen ersten Russen begegnete, einem Paar in einem nagelneuen Range Rover. Ihre Gesichter verrieten sie, noch bevor es das Nummernschild tat: Mienen fassungslosen Unglaubens, die nichts gemein hatten mit den dezidiert ausdruckslosen Reaktionen heimischer Autofahrer auf meine Gegenwart. Was zur Höllski?
Wie mir später erläutert wurde, war der verschwiegene und reservierte Nationalcharakter der Finnen ein Vermächtnis der traumatischen kriegerischen Interaktionen mit dem Bären jenseits der Grenze. Da der Erläuternde mir zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach das Leben gerettet hatte, werde ich ihm gerne beipflichten. Der tausend Kilometer lange Rest meiner Reise durch Finnland führte mich über das ausgedehnte Schlachtfeld des Winterkriegs von 1939/40, dem kältesten aller kalten Kriege. Mehrfach am Tag stand ich an einer einsamen weißen Straße beklommen vor einem schlichten Gedenkstein oder einem herangerollten Geschütz und stellte mir den Schnee zu meinen Füßen blutrot gefärbt und die friedlichen Wälder widerhallend von gewaltsamem Tod vor. Wenn die größte Militärmacht der Welt es mit einer der kleinsten aufnahm, konnte es nur einen Ausgang geben. Doch bevor es so weit war, brachten die furchteinflößend wehrhaften Finnen ihrem Gegner einige der verheerendsten Niederlagen der Militärgeschichte bei, in deren blutigem Verlauf 250.000 russische Soldaten umkamen.
Die Finnen sind definitiv ein besonderer Menschenschlag. Ihre außergewöhnliche Sprache hat nichts gemein mit den übrigen, ansonsten eng verwandten nordischen Sprachen; ihre Sprecher sollen aus dem Nordwesten Sibiriens gekommen sein, bevor sie sich im unwirtlichsten Teil von Skandinavien niederließen. Hier oben zu überleben, war seit jeher ein hartes und grenzwertiges Unterfangen. Ein Drittel der finnischen Bevölkerung kam in einer Hungersnot ums Leben, die erbarmungsloser war und auch jüngeren Datums als jene, die von der Kartoffelpest in Irland verursacht wurde. Noch heute werden 90 Prozent der Landesfläche als rurale Wildnis eingestuft.
Während die Nachbarn sich entwickelten und erblühten, verharrte Finnland in bäuerlicher Armut. Es ist erstaunlich, sich vor Augen zu führen, dass diese archetypische Industrienation bis vor wenigen Generationen im Grunde mittelalterlich war. Die Lebenserwartung von Männern stagnierte bis weit in das letzte Jahrhundert in den niedrigen Vierzigern. In den 1920er Jahren waren die Zeiten so hart, dass die ersten Wachtposten, die entlang der Grenze zur jungen Sowjetunion errichtet wurden, in erster Linie dazu dienten, Landsleute auf der Suche nach einem besseren Leben an der Flucht nach Russland zu hindern. Eine ländliche Tradition heidnischer Hexenkulte, die sich bis weit in die 1930er Jahre hielt, ging erfreulicherweise in der Schöpfung der Mumins auf. In den 1950er Jahren arbeitete die Hälfte aller Finnen in der Land- oder Forstwirtschaft und bis in die Sechziger nutzten einheimische Holzarbeiter Pferde, um Baumstämme zu transportieren, und schliefen in primitiven Unterkünften im Wald, deren Kojen mit Trennwänden ausgestattet waren, um das Einatmen des tuberkulösen Auswurfs des Bettnachbarn zu verhüten. Sie waren Holzfäller, aber es ging ihnen nicht gut.
Man kann sich über diese entbehrungsreiche Armut in Reiseführern informieren oder aber, sofern man einen geheizten Supermarkt auftreibt, bevor man erfriert, auf mehrsprachigen Produktetiketten. Wie ich entdeckte, haben die Finnen nur für ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse einheimische Begriffe: für Dinge wie Wasser, Milch, Nüsse, Getreide. Alles andere, von Essig und Zucker bis hin zu Schinken und Pornografie, ist dem Schwedischen entliehen. (Ob es im Supermarkt Pornografie gab, kann ich freilich nicht beurteilen.)
Doch so unwirtlich diese bitterarme Wildnis in vielerlei Hinsicht sein mochte, war Finnland aufgrund seiner strategischen Bedeutung als Hintertürchen von Europa nach Russland eine wertvolle und vielgetauschte Schachfigur in den imperialen Kämpfen der Ostsee-Anrainer. Über Jahrhunderte war es nicht mehr als ein Außenposten schwedischer, dänischer und russischer Reiche; der Name »Finnland« fand erstmals im 18. Jahrhundert Verwendung und die finnische Sprache wurde erst 1893 anerkannt. 1917 wurde schließlich die Unabhängigkeit erlangt, aber die Nation konnte sich nur 22 Jahre daran erfreuen, ehe die Russen kamen. Sein frappierend zynischer Nichtangriffspakt mit Hitler ermöglichte Stalin, den Finnen mit dem Vorschlaghammer der Roten Armee direkt an die Eier zu gehen und sich das Land mit der Absicht einzuverleiben, eine großzügige Pufferzone gegen die Invasion der Nazis zu schaffen, von der jeder wusste, dass sie früher oder später bevorstehen würde: Leningrad beziehungsweise Sankt Petersburg lag nicht mehr als einen Granatenwurf von der finnischen Grenze entfernt.
Von Generälen, die es beurteilen konnten, erhielt Stalin die Zusicherung, dass die Finnen nicht mehr als zwei Wochen standhalten könnten. Vor 1917 war Finnland mehr als hundert Jahre lang ein russischer Satellit gewesen und ein Großteil seines militärischen Geräts stammte noch aus dieser Zeit: Das Gros der ohnehin bescheidenen Artillerie des Landes war zuletzt im russisch-japanischen Krieg von 1905 zum Einsatz gekommen. Die russische Führung wusste, dass sie jeden Tag mehr Granaten abfeuern könnte, als die Finnen insgesamt besaßen. Sie wussten, dass die Finnen nur über ein Dutzend Kampfflugzeuge verfügten, die es mit ihren tödlichen Bombern aufnehmen könnten. Als die russischen Truppen an der Grenze zusammengezogen wurden, wussten sie, dass sie ihren Gegnern zahlenmäßig im Verhältnis 42:1 überlegen waren. Für mich faszinierend, für sie aber wohl weniger, war die finnische Armee gezwungen, ihren einzigen einsatzfähigen Panzer um einige »Fahrrad-Bataillone« zu ergänzen, die mobilisiert wurden, um den größten bewaffneten Angriff abzuwehren, den die Welt je gesehen hatte. Das war nicht David gegen Goliath, sondern Goliath gegen Davids Oma.
Der Winterkrieg begann am 30. November 1939 mit einem Luftangriff auf Helsinki, bei dem 200 Bewohner umkamen. In den Tagen darauf überquerten 425.000 russische Soldaten die finnische Grenze an zehn Punkten entlang fast ihrer gesamten Länge – eine Invasionsmacht, die beinahe drei Mal so groß war die diejenige, die am D-Day den Ärmelkanal überquerte. Doch viele Soldaten der Roten Armee schafften es nicht einmal aus dem Mutterland heraus. Der Winter 1939/40 entwickelte sich zum härtesten seit hundert Jahren und ein Zehntel der russischen Truppen fiel Erfrierungen zum Opfer, noch bevor sie die Grenze überschritten hatten.
Liest man Schilderungen des Winterkriegs, verbringt man viel Zeit damit, ungläubig den Kopf zu schütteln. Schleicht man auf einem Klapprad durch Tiefschnee an den blutigsten Schauplätzen dieses Krieges entlang, wird das Kopfschütteln noch um eine Dreingabe schwerer, dunstiger Seufzer ergänzt. Wie furchtbar war es, sich die Verbände der Roten Armee vorzustellen, die in Filzstiefeln ohne Sohlen und in Wollumhängen benommen durch diese Wälder stapften. Wie leicht war es, ihnen nachzusehen, die selbstmörderisch verräterischen Feuer zu entzünden, um die sie sich nachts kauerten, große Stöße lodernder Stämme, die finnische Scharfschützen von Ferne herbeilockten. Und wie unfassbar grausam war es, sich auszumalen, wie die Russen bibbernd einen aufgegebenen Befehlsstand einnahmen und entdeckten, dass jeder Finne selbst an der Front auf eine Sauna und eine warme Mahlzeit hoffen durfte. Als ein durchgefrorenes und hungriges Bataillon eine finnische Feldküche überrannte, konnten sie den Kesseln mit Wursteintopf, die noch vor sich hin blubberten, nicht widerstehen; als sie sich an den warmen Öfen die Bäuche vollschlugen, formierten sich die Köche neu, kehrten zurück und massakrierten 400 Mann.
Wie Stalingrad später zeigen sollte, war die große Stärke der Roten Armee der eiserne Wille, Mütterchen Russland zu verteidigen. Einen harmlosen Nachbarn zu überfallen, stellte ihre Motivation hingegen auf eine harte Probe. Viele russische Soldaten kannten nicht einmal den Namen des Landes, in das sie einmarschierten, zu schweigen von den Beweggründen, dies zu tun. Ein ganz besonders bedauernswerter Kriegsgefangener berichtete seinen Fängern davon, in Murmansk von einem Offizier von der Straße geholt worden zu sein, als er gerade Schuhe für seine Frau kaufte, bevor man ihn nach einstündiger Ausbildung direkt an die Front schickte. Als die Finnen seinen Rucksack leerten, fanden sie dort die noch immer ordentlich verpackten Schuhe vor.
Dank Stalins grenzenloser Paranoia endeten drei Viertel der Offiziere der Roten Armee im Gulag oder vor dem Erschießungskommando und bescherten seiner Invasionsstreitmacht eine Führung, der es eklatant an Erfahrung mangelte und die sich außerdem scheute, die Initiative zu ergreifen und selbst haarsträubend katastrophale Befehle in Frage zu stellen. Und davon gab es eine ganze Menge. Typische Vorstöße der Russen sahen so aus, dass Hunderte, manchmal Tausende Soldaten in enger Formation am helllichten Tag über die gähnend leere Eisfläche eines zugefrorenen Sees marschierten. Die finnischen Maschinengewehrschützen am anderen Ufer konnten ihr Glück angesichts dieses Scheibenschießens kaum fassen. Schon bald waren sie von dem Abschlachten so verstört, dass viele von ihnen mit posttraumatischen Belastungsstörungen abgezogen wurden. Jeder Angriff war wie eine Schlacht an der Somme im Kleinformat, an deren Ende das Eis mit Leichen übersät war. Bei einem repräsentativen Gefecht scheiterte ein Verband von 4.000 russischen Soldaten daran, eine von 32 Finnen verteidigte Stellung einzunehmen, und hatte selbst 400 Todesopfer zu beklagen.
Die Finnen hatten schlechte Karten, spielten sie aber brillant aus. Ihre zahlenmäßige Unterlegenheit und miserable Ausstattung machten sie mit Pragmatismus, Einfallsreichtum, Winterhärte und der Entschlossenheit wett, ihre Nation und die hart erkämpfte Unabhängigkeit zu verteidigen. Kluge Offiziere, darunter Freiwillige wie Abgeordnete, Anwälte und sogar der Präsident der staatlichen Alkoholbehörde, erdachten und entwickelten die gewieften Guerilla-Taktiken, die noch heute als ausgezeichnete Strategien im Kampf gegen eine weit überlegene Macht angesehen werden. Weiße Mützen und Skier ermöglichten den Finnen, sich ungesehen und ungehört an den Feind heranzuschleichen. Der Molotow-Cocktail war eine Erfindung des Finnischen Winterkriegs, scherzhaft benannt nach dem sowjetischen Außenminister, der den Pakt mit Hitler ausgehandelt hatte. Mehr als eine halbe Million wurden von Alko hergestellt, jede Flasche ausgestattet mit zwei Sturmstreichhölzern. Die spöttische Hommage an Molotow war eine Mischung aus Benzin, Kerosin, Teer und Kaliumchlorid, die beim Aufprall durch eine am Flaschenhals befestigte Ampulle mit Schwefelsäure entzündet wurde. Mit diesem gläsernen Wurfgeschoss konnte man sogar einen Panzer unschädlich machen; der Haken dabei war, nahe genug heranzukommen. Die noch heiklere Alternative war eine »Tornisterbombe«, die direkt unter einen nahenden T-34 geworfen wurde, im Idealfall, nachdem ein kräftiger Kollege ihn mit einem gezielten Holzklotz zwischen die Räder gebremst hatte. Solche Taktiken erklären, warum die Sterblichkeitsrate in Anti-Panzer-Einheiten bei rund 70 Prozent lag.
Die Verteidigung der Finnen war geprägt von etlichen Taten unbeugsamer Tapferkeit. Da war der Unteroffizier, der ein Arbeitspferd beschlagnahmte und ohne Sattel die russische Frontlinie entlangritt, mit einer Kanone im Schlepptau, die er dann losmachte, um damit aus nächster Nähe auf Panzer zu schießen. Der Leutnant, der es nur mit einer Pistole bewaffnet mit zwei T-43 aufnahm und die Besatzungen so verunsicherte, dass sie kehrtmachten und sich zurückzogen. Die alte Frau, die über Nacht ihre Hütte tünchte und schrubbte, nachdem ein finnischer Offizier ihr mitgeteilt hatte, dass er am Morgen leider zurückkehren müsse, um ihr Heim im Rahmen des Rückzugs niederzubrennen. »Wenn man seinem Land ein Geschenk macht«, erklärte sie in einer Nachricht, die sie auf dem Küchentisch hinterließ, »möchte man, dass es schön aussieht.« Auf dem Boden standen ein Kanister Benzin und ein sauberer Stapel Anzündholz. (Die rigorose Effizienz, mit der die Finnen die Taktik der verbrannten Erde umsetzten und alles in Schutt und Asche legten, was den Russen als Unterschlupf hätte dienen können, erklärt die trostlose Betonarchitektur der Nachkriegszeit, die jede Ansiedlung in diesen Breiten prägte.)
Stalins geplanter Vierzehn-Tage-Krieg ging schon bald in den dritten Monat, wobei auf jeden gefallenen Finnen zehn Rotarmisten kamen. In der Nähe von Suomussalmi kreisten Skijäger eine ganze sowjetische Division ein, die sich die Straße hinaufschleppte: Die anschließende Belagerung zwang die Russen dazu, ihre Pferde zu essen. Während auf finnischer Seite 1.000 Männer starben, waren es auf russischer 40.000. Das Quecksilber fiel unter minus 40 Grad Celsius und ergänzte den ohnehin stattlichen Katalog der Inkompetenz um weitere Kapitel eisiger Kümmernisse. Russische Gewehre froren in der Kälte fest; die Finnen tauten ihre mit Alkohol und Glyzerin auf. Russische Medikamente gefroren; die Finnen klebten sich Morphium-Ampullen unter die Achselhöhlen. Eine Zugladung Skier traf nachträglich ein, aber die Russen wussten nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollten; ein Trupp Freiwilliger machte sich zum Üben in die Wälder auf und kehrte nie zurück. Verängstigt und durcheinander gebracht von unsichtbaren Scharfschützen und lautlosen Hinterhalten, lieferten sich benachbarte russische Verbände Gefechte untereinander und beschossen sich bisweilen über Stunden. Als die Rote Armee sich darauf verlegte, hinter gepanzerten Schilden über das Eis zu kriechen, schlichen sich die Finnen einfach an ihre Flanken und schossen sie in den Hintern. Mittlerweile war es so kalt, dass die Gefallenen binnen einer Stunde zu Eisblöcken gefroren und nützliche, aber demoralisierende Deckung boten.
Dennoch: Allem Heldenmut und mörderischen Einfallsreichtum zum Trotz waren sich beide Seiten im Grunde darüber im Klaren, dass die tapferen Finnen das Unvermeidliche lediglich hinauszögerten. Nach drei Monaten war nur noch eine Heimwehr aus Reservisten übrig, die mit erbeuteten Waffen kämpfte. Stalin ordnete eine Neuformierung an, die natürlich damit eingeleitet wurde, etliche Generäle an die Wand zu stellen (einer wurde dafür hingerichtet, »zugelassen zu haben, dass 55 Feldküchen in Feindeshand fielen«). Entsprechend motiviert brach die Rote Armee den finnischen Widerstand schließlich mit einer massiven Offensive von beispielloser Heftigkeit und fiel unter dem schwersten Artilleriebeschuss seit Verdun und dem ersten Flächenbombardement der Geschichte mit 600.000 Mann in die südlichen Grenzgebiete ein. »Möge die Hand verdorren, die gezwungen ist, dieses Dokument zu unterzeichnen«, sagte Finnlands Präsident Kyösti Kallio, bevor er die Feder auf den Friedensvertrag setzte. Nur drei Monate später ging sein Wunsch nach einem Herzinfarkt in Erfüllung.
Die Demütigungen, die sie im Winterkrieg erlitten hatten, kamen den Russen 15 Monate später gut zupass. Als die deutschen Panzer anrollten, hatte die Rote Armee bereits jede erdenkliche bittere Lektion gelernt. Ihre klägliche Vorstellung gegen einen wilden Haufen bemützter Skifahrer verleitete Hitler außerdem dazu, sich in der Annahme, die Nazi-Kriegsmaschinerie werde mit der Roten Armee kurzen Prozess machen, zu übernehmen. Es wäre demnach nicht ganz abwegig zu behaupten, dass die Finnen indirekt die Nazis besiegt hatten – insbesondere wenn man die etwas unangenehme Endphase außer Acht lässt, in der die Finnen ab 1944 Seite an Seite mit Hitlers Wehrmacht kämpften.
Aber die grimmige Quintessenz des russischen Finnlandfeldzugs und aller anschließenden verlustreichen Siege der Roten Armee lautete: Töte mich, töte ihn, töte jeden Soldaten, den du töten kannst, und töte weiter, aber sieh ein, dass du uns niemals alle töten wirst. Die russische Invasion in Finnland zeugte nicht von individuellen Heldentaten, sondern war auf verstörende Weise geprägt von stumpfen, fast apathischen Massenopfern, der pflichtschuldigen Hinnahme von Verlusten in entsetzlichen Ausmaßen. Dies war sowjetischer Kollektivismus reduziert auf seine grausige Essenz: Die schiere Masse entbehrlichen Menschenmaterials war die hässliche, stumpfe Waffe, die den Finnen schlussendlich den Rest gab und auch den Nazis in Stalingrad. Der Oberbefehlshaber der finnischen Armee, General Mannerheim, sprach von einem »Fatalismus, der Europäern unbegreiflich ist«.
Vielleicht war dem General die Episode bekannt, die als eines der entsetzlichsten Spektakel in der Geschichte menschlicher Konflikte gelten muss und die von William R. Trotter in seinem Standardwerk über den Winterkrieg folgendermaßen beschrieben wird: »In einem Abschnitt des Schlachtfelds von Summa wurden wiederholt Angriffe direkt über ein finnisches Minenfeld hinweg von Männern geführt, die ihre eigenen Körper benutzten, um die Minen zu räumen: Sie gingen Arm in Arm, bildeten enge Reihen und marschierten stoisch in die Minen, dabei Parteilieder singend und im gleichen steten, selbstmörderischen Rhythmus vorrückend, selbst als die Minen zu explodieren begannen, Löcher in ihre Reihen rissen und die Marschierenden mit Füßen, Beinen und Eingeweiden überschütteten.«
Ich hatte Trotters Buch mit auf die Reise genommen, war aber seit Tagen zu kaputt gewesen, um es aufzuschlagen. Nun, da Russland so nah war, wünschte ich, es nie geöffnet zu haben. Sie klangen echt nicht wie Leute, mit denen man als Radfahrer eine vielbefahrene Straße teilen möchte.