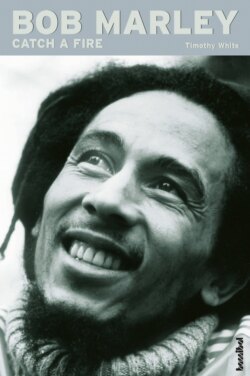Читать книгу Bob Marley - Catch a Fire - Timothy White - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAm 23. Juli 1892 wurde in Ejarsa Gora ein Kind geboren und gesäugt in der fruchtbaren Gegend der Provinz Harage, ungefähr achtzehn Meilen entfernt von der Stadt Harar. An jenem Tag hielt ein Edelmann mit strenger Miene Wacht vor einem runden Haus aus getrockneter Erde und Asche und einem kegelförmigen Strohdach und horchte auf die ersten krähenden Rufe des Kindes nach Atem und Leben. Er trug eine Toga aus schwarzem Bombasin, und ein schmuckes Schwert in silberner Scheide blitzte an seiner Seite. Um die Taille war ein Patronengurt geschlungen, und eine Pistole mit elfenbeinernem Griff steckte darin. Auf seinem Kopf trug er seinen steifen schwarzen Filzhut aus Italien.
Ein Gewehrträger stand hinter ihm und hielt das kostbare Gewehr in seiner Hülle aus scharlachroter Baumwolle hoch über dem wirbelnden Staub. Entfernt von dem Paar, aufgefächert zu einem weiten Halbkreis auf dem sanft abfallenden Hügel, stand ein großes Kontingent Soldaten in Paradeuniform, und ein jeder hielt einen geladenen Karabiner. Und jenseits dieser Männer waren Gruppen von Bauern, die sich niedergeworfen hatten zum Gebet. Die heißen Böen aus der Wüste trugen ihre inbrünstigen ›semas‹ (Gebete) hinein in die kühlen Winkel des Hauses.
Dort drinnen waren Ärzte und Dienerinnen unter den wachsamen Blicken der Priester, die lange ›malwamiyas‹ (Gebetsstöcke) umklammert hielten, bekümmert um die Mutter. Mit gebeugtem Kopf und abgewandten Blick erfüllten die Dienerinnen schnell und schweigend, was ihnen aufgetragen wurde, aber sie waren außergewöhnlich sorgsam dabei, denn sie wussten, dass ihr eigenes Leben davon abhing, ob sie ihrer Herrin in dieser bedeutsamen Stunde auf beste Weise zu Diensten standen. Die Mutter lag in den letzten Wehen, und in ihrem Bemühen, sich nicht der Panik zu überlassen, hätten die Diener beinahe die ersten Wimmertöne des Babys überhört, als es den Schoß der Mutter verließ und sein winziger Körper leicht dampfte.
Die furchtbare Spannung löste sich im schrillen Kreischen des braungelben männlichen Säuglings, und alle konzentrierten sich darauf, das Kind vorzubereiten für den Vater. Tränen der Erleichterung standen in den Augen der Dienerinnen, als sie den Säugling wuschen, ihn salbten mit feinem Öl und seine dünnen Lippen mit der geweihten geschmolzenen Butter bestrichen, und in ihren Ohren hallte der Lärm von Salutschüssen aus Hunderten von Gewehren, die aus allen Tälern und von allen Höhen die Geburt von Tafari Makkonen, dem Sohn des Gouverneurs Ras Makkonen von Harar unter Kaiser Menelik II. und seiner Ehefrau Woisero Yaschimabet, verkündeten.
Das Kind, so sagte man, stamme in direkter Linie von dem biblischen König Salomon von Jerusalem und Königin Makeda von Saba, dem südlichen Teil von Äthiopien, ab. Ja, seine Blutsverwandtschaft war zurückgeführt worden auf Salomons Großvater, Jesse, den schwärzesten Juden, den die Welt je gesehen hatte.
Seit mehreren Jahren hatten Ras Makkonens Geistliche und Astrologen die Geburt des Kindes angekündigt. Neptun und Pluto, so erklärten sie, hatten im Jahre 1399 begonnen, sich langsam aufeinander zuzubewegen. Beide Planeten bewegten sich auf der heliozentrischen Bahn und brauchten 493 Jahre, um sich zu kreuzen. Dieser Moment werde im Juli 1892 kommen und Strahlungen von anderen Sternkreiszeichen verursachen, die auf mystische Weise die Konstellation Löwe beeinflussen würden, die mit dem biblischen Haus Juda korrespondierte, Jakobs viertem Sohn, der im selben Monat geboren wurde, wie bei Jesaja berichtet wird.
Aber vor dieser Geburt, so sagten Seher, werde es noch eine große Dürre in Äthiopien geben, die 1889 beginnen werde, obwohl sich das Land doch traditionellerweise zweier Regenzeiten im Jahr erfreuen konnte. Die Wiederkehr der Regenfälle werde die Identität und das Schicksal des Kindes bestimmen, wie es geschrieben stehe in Jesaja 9,6: »Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.«
Als alles bereit war, brachte man ein gesatteltes Maultier, das Ras Makkonen die paar Meter zur Eingangstür des Hauses tragen sollte. Er trat ein, erblickte das strahlende Kind und schickte ein feierliches Gebet zum Himmel, auf dass dieser Sohn, anders als die frühen Nachkommen, die er mit Yaschimabet gezeugt hatte, das Säuglingsalter überleben möge. Die Priester taten ähnliche Bittgebete, um dämonische Geister zu vertreiben und die ›buda‹ – menschliche Helfer des bösen Blicks, die sich des Nachts raubgierige Hyänen verwandeln.
Der normalerweise so steife und schweigsame Ras (Prinz) sprach ein paar Worte des Trostes und des Lobes zu Yaschimabet, die ihm dankte, schwach wie sie war. Dann ritt er fort auf seinem Maultier, und seine Gefolgsleute und Soldaten folgten ihm, als er den Weg einschlug zur von Mauern umgebenen Stadt Harar. Irgendwann an der Wegstrecke würde er an einem feierlichen Mahl teilnehmen, bei dem es ›wot‹ gab, ein scharf gewürztes Rindergulasch, das traditionsgemäß gegessen wird mit Fladenbrot namens ›indjera‹, um die Soße aufzusaugen, und hinuntergespült mit süßem Wein und ›talla‹, einem kräftigen Bier.
Als Ras Makkonen die Hauptstraße erreichte, die nach Harar führte, fielen ein paar Regentropfen auf seine Toga. Ein Diener eilte zu seinem Herrn und hüllte ihn flink in ein ›barnos‹, einen schwarzen Umhang aus feiner Wolle mit einer Kapuze. Während der sommerlichen Regenzeit wurde dies Gewand bei schlechtem Wetter von allen Reichen getragen. Tief in Gedanken versunken, bemerkte Makkonen kaum den Regen und auch nicht die unterwürfige Geste seines Dieners.
Er fragte sich, ob sein Kind lange genug leben würde, um ein Mann zu werden. Warum nur waren so viele zuvor schon in der Wiege dahingerafft worden? War sein Same verflucht von einem Teufel, einem ›sar‹, geschickt von den Zauberern, um seinem Ehrgeiz Hohn zu sprechen? Oder hatten gekaufte Diener die Kinder mit schlechtem Kaffee vergiftet? Und wenn der Junge heranwuchs und kräftig wurde, würde ihm Erfolg gegeben sein, wo er seinem Vater verwehrt blieb? Würde er die Krone des Kaisers für das Haus Makkonen erwerben? Oder war es Gottes Wille, dass der Sohn nur so hoch aufsteigen sollte wie sein Vater – und nicht höher –, damit dieser stolzen Familie die Bedeutung wahrer Demut klar werde?
Und doch gab es noch nicht einmal die Garantie, dass der Junge zum Gouverneur wurde. Nicht einmal als direkter Nachfahre von Jesse und Salomon und dem Urenkel von König Sahela Selassie, dem Landesherrn der Provinz Schoa, der die mächtigen Galla-Völker seinem Willen unterworfen hatte, Verträge geschlossen hatte mit ausländischen Monarchen wie der Königin Victoria und die Traditionen, Verantwortlichkeiten und den Ruhm der salomonischen Dynastie fortgeführt hatte, wie es geschrieben stand im heiligsten aller äthiopischen Bücher, dem Kebra Nagast.
Dies hier war das Land des Verrats, der Intrigen und der niedrigen Taten an höchsten Orten, wie Makkonen wusste. Wenn auch Menelik II. sein geliebter Vetter sein mochte, ein Mann, dem er ewige Gefolgstreue schwor, so war doch die Kaiserin Taitu eine übelwollende Schlange, die vor nichts haltmachen würde, um jemanden aus ihrer Familie auf dem Thron zu sehen, wenn der schon alte Kaiser gestorben war. Sollte sein Sohn leben, würde er viel lernen müssen über die Verantwortung, die edle Geburt mit sich brachte, über Gehorsam und die Kunst der Manipulation.
Der Regen wurde stärker, als der Gouverneur und seine Gefolgschaft ein fruchtbares Feld mit ›durra‹ überquerten, und ein plötzlicher Wind fuhr durch die dichte Hirse und scheuchte ein paar Perlhühner auf, die sich zwischen den kürzeren Halmen am Wegesrand versteckt hatten. Die Gruppe suchte in einem Mango-Hain Unterschlupf, bis der Regenguss sich gelegt hatte.
Noch immer vor sich hin brütend, griff der Prinz geistesabwesend nach einer reifen, rosaroten Mangofrucht, die von einem niedrigen Ast herunterhing, als sein Maultier darunter hindurchging, und seine Gefolgsleute erstarrten vor Schreck. Es war höchst unziemlich für äthiopische Edelleute, auch nur die geringsten Verrichtungen selbst zu tun, besonders etwas so Niedriges wie das Pflücken einer Frucht. Ras Makkonen biss tief in das weiche Fruchtfleisch, und der warme Saft rann ihm aus beiden Mundwinkeln. Er wollte schon das große Stück schlucken, als er ein seltsames Zucken an seiner Zunge spürte. Er spuckte aus und untersuchte die Frucht in seiner Hand: die übriggebliebene Hälfte eines großen grauen Wurms schlängelte sich aus der weichen gelben Mitte der Mango.
Voller Ekel warf Makkonen den Rest der Frucht zu Boden und spuckte nochmals aus. Dann rieb er sich das Innere des Mundes mit seinem Umhang. Und in eben diesem Moment bog ein schlimmer Windstoß die Äste des Mangobaums, und Regen fiel, und ein mächtiger Blitzstrahl erleuchtete den tiefschwarzen Himmel, und in dem geisterhaften Licht duckten sich die Bäume vor Furcht, so schien es dem Prinzen, als ihre reifen Früchte abgerissen und von der wilden Kraft des Sturmes weit fortgeschleudert wurden.
Die Dürre war vorüber! Makkonen war voller Freude, aber dann verfinsterte sich die Stimmung des Prinzen. Wahrlich, mächtige Zeichen und Omen machten sich immer häufiger bemerkbar an diesem eigenartigen und schicksalshaften Geburtstag, aber sie standen im Widerspruch zueinander. Der Regen war gekommen, die Dürre hatte ein Ende, aber die verdorbene Frucht des Erdbodens und die grellen Gerippefinger am Himmel waren Omen, die im Gegensatz dazu Böses kündeten. Makkonen sehnte sich nach uneingeschränktem Vertrauen in die Orakel, aber er fand es nicht, und stattdessen war er versucht, laut Gott zu lästern wegen seiner grausamen Ungewissheiten. Doch etwas an ihm ließ ihn seine Zunge hüten.
Der Regen wurde stärker, und der kümmerliche Schutz der Bäume reichte nicht. Also machte sich die Gruppe wieder auf den Weg und strebte eilig Harar zu. Und jedem der Gefolgsleute des Prinzen stand die Ungewissheit ebenso im Gesicht wie ihrem Herrn.
Makkonen beschloss, der junge Tafari solle in den Genuss sowohl einer traditionellen wie auch einer europäischen Erziehung kommen. Das galt bei den isoliert lebenden und ethnozentrischen Bürgern Äthiopiens im späten 19. Jahrhundert als überaus ungewöhnlich. Die Völker dieser Nation, deren meiste Vorfahren aus Arabien ins Land gekommen waren, teilen sich in zwei wesentliche Sprachfamilien, die kuschitische und die semitische. Die Galla (das Volk von Tafaris Mutter) waren die vornehmsten unter den Kuschiten, und die amharischen Völker von Schoa die einflussreichsten unter den Semiten, und Sprache, Politik und Religion (die autonome christlich-orthodoxe äthiopische oder koptische Kirche) der letzteren wurden vorherrschend, als Tafari das Erwachsenenalter erreichte.
Als Mitglied des schoanisch-amharischen Adels wurde Tafari so erzogen, wie es sich für einen jungen Prinzen geziemte, der eines Tages mit einer vornehmen ›woisero‹, einer adligen Dame, verheiratet werden würde. Makkonen, der eine Anzahl von Staatsbesuchen in Europa gemacht hatte (zum Beispiel zur Krönung Edwards VII. von England), teilte Meneliks Ansicht, dass Kenntnisse in Europas Politik, Handel und Kultur absolut notwendig seien, wenn Äthiopien je aus seiner feudalistischen Isoliertheit befreit und zu einem Mitglied der modernen Staatenfamilie werden sollte. Daher stellte Makkonen einen französischen Tutor aus Guadeloupe, Dr. Vitalen, ein und beauftragte später Abba Samuel, einen Äthiopier, der an der französischen Botschaft arbeitete, seinem Sohn eine solide westliche Erziehung zu vermitteln.
Aber Makkonen war auch der Ansicht, dass ein zukünftiger Ras die außergewöhnliche Vorrangstellung über seine Landsleute zu erkennen und würdigen lernen müsse, die seine Herkunft von der Dynastie Salomons mit sich brachte. Die zitternde Unterwürfigkeit der Bauern und Pächter, die sie zeigten, wenn sie sich in Gegenwart von Adeligen befanden, war, wie er meinte, natürlicher Respekt, durchaus angemessen, und darüber hinaus eine Gunstbezeugung von Gott. Ein amharischer Aristokrat, ausgestattet mit riesigem, unbesteuertem Grundbesitz, den er von seinen Vorfahren geerbt hatte, und reicher gemacht durch die Geschenke seines Kaisers, sollte in der Lage sein, im Vertrauen auf göttliche Rechtmäßigkeit eine strenge Verwaltung seiner Güter durchzuführen und seine Soldaten einzusetzen (Makkonen hatte mehr als sechstausend Mann in seiner privaten Armee), um seinen Besitz zu schützen und Pacht und Steuern einzutreiben. Die Privilegierten müssen darüber wachen, dass eine soziale Ordnung eingehalten wird, die auf der Gefolgschaftstreue und der bescheidenen Unterordnung von Seiten der Niedriggestellten basiert, und sie müssen gleichzeitig den kaiserlichen Hof mit demselben Respekt und derselben Lehnstreue begegnen. Makkonen hatte im Laufe seines Lebens auf schmerzhafte Weise eines gelernt: Derjenige, der Macht nicht zu identifizieren und einzuschätzen in der Lage ist, sowohl bei sich selbst wie bei anderen, wird von ihr getäuscht werden, und derjenige, der nicht weiß, wie er die Macht einzusetzen hat, die er besitzt, wird am Ende von ihr zugrunde gerichtet werden.
Von Beginn an war sich Tafari bewusst, dass sein Vater auf seltsame Weise hin und her gerissen war zwischen seinem Enthusiasmus für Europa – besonders einer Bewunderung für die Ordnung und soziale Mobilität der westlichen Gesellschaft – und den schoanisch-amharischen Traditionen, denen er nichtsdestoweniger anhing, indem er ein strenges fürstliches Regiment führte. Das Ziel war, wie seinem Sohn schließlich klar wurde, auf irgendeine Weise die widersprüchlichen Elemente in seiner Welt miteinander zu kombinieren, damit nicht das eine das andere ausschloss.
Es wurde jedoch bald offenkundig, dass er in dieser Angelegenheit auf sich allein gestellt sein würde. Seine Mutter Yaschimabet war zwei Jahre nach seiner Geburt gestorben, und sein Vater, ein liebevoller, wenn auch äußerst zurückhaltender Mann, war meistens in offizieller Mission auf Reisen oder wirkte als Richter in Harar. Verbittert über seine fast vollständige Isolierung, verübelte es Tafari seiner Mutter, dass sie ihn verlassen hatte, aber bewunderte seinen entfernten Vater, weil er so frei war von sentimentalen Bindungen und Verpflichtungen. In mehrerer Hinsicht war Tafari absolut der Sohn seines Vaters: Er betonte sogar noch stärker Makonens romantische Vorstellungen von dem lehrreichen Wert kultureller Verbindungen mit dem Westen; er teilte seine Hochachtung vor Macht und seinen Hunger nach ihr, und er hatte seine kühle Zurückhaltung geerbt. Schon in sehr frühem Alter hatte sich seine Persönlichkeit zu der eines absoluten Autokraten entwickelt.
Makkonen, der dies sehr wohl bemerkte, machte seinen dreizehnjährigen Sohn zum Dedjasmatsch, oder Hüter der Tür, eines Teils der Harage-Provinz. Ein Jahr nachdem der stolze Vater seinem Sohn diese vornehmlich ehrenamtliche Stellung verliehen hatte, starb er im Jahre 1906.
Als der junge Tafari seinen ersten Prüfungen ausgesetzt wurde, stellte er sich ihnen mit der ungebrochenen Überzeugung, dass alles, was sowohl materiell wie politisch von seinem verstorbenen Vater erworben worden war, ihm vererbt sei. Zudem war seine angestaute Verachtung von Frauen hilfreich in der Auseinandersetzung mit seinen beiden Hauptgegnern: der Kaiserin Taitu und ihrer Tochter Zauditu.
Taitu wollte unbedingt Yelma Makkonen, den Sohn des verstorbenen Prinzen aus erster Ehe, als Nachfolger seines Vaters im Amt des Gouverneurs sehen. Tafari (Sohn von Makkonens zweiter Frau) war bestürzt und dann voller Zorn darüber, dass Yelma ihm vorgezogen werden sollte. Er wusste jedoch genug von dem Nepotismus in der äthiopischen Politik, um einzusehen, warum dieser Kurs eingeschlagen wurde: Die erste Frau seines Vaters war eine Cousine von Taitu, und da ihr schon alter Ehemann bei schlechter Gesundheit war und überdies Tafari bevorzugte, wollte Taitu mit aller Macht den Anspruch ihrer Familie auf den Thron behaupten, solange noch Zeit war, einen solchen Präzedenzfall zu schaffen.
Und so wurde Yelma zum Gouverneur von Harar sowie zum Führer der Armee, die zu diesem Amt gehörte, während man Tafari mit einem minderen Amt als Gouverneur von Selale abspeiste, einem kleinen und unbedeutenden Winkel des Reiches, nordwestlich der kaiserlichen Hauptstadt Addis Abeba gelegen. Da man ihn vollständig machtlos halten wollte, wurde Tafari von Taitu gezwungen, das winzige Gebiet von Meneliks Palast aus zu regieren.
Aber die Tatsache, dass er im Palast gleichsam eingesperrt war, sollte sich für ihn als nützlich erweisen, denn weil er gezwungen war, in einer Atmosphäre nicht enden wollender Intrigen zu leben, da die Auseinandersetzungen um die Kontrolle über den Thron immer weiter eskalierten, konnte sich Tafari eine Menge wertvollen Wissens aneignen, weil es ihm möglich war, die Schlangen in ihrer eigenen Grube zu beobachten.
Meneliks angegriffene Gesundheit wurde immer schlechter, und 1908 erlitt er einen Schlaganfall. Fern von seinem letzten Verbündeten, dem inzwischen nicht mehr handlungsfähigen Kaiser, musste Tafari daraufhin an den südlichen Grenzen von Äthiopien als Gouverneur der Provinz Sidamo dienen. Aber hier hatte er den Befehl über dreitausend Soldaten und konnte sich des zynischen Rats seiner Großmutter mütterlicherseits, der Wosiero Wallata Georgis, erfreuen, die man zusammen mit ihm nach dorthin verbannt hatte. Während Tafari sich besonnen damit abfand, über sein abgelegenes Territorium zu herrschen, musste Taitu sich wütend endloser Intrigen in Addis Abeba erwehren.
Im Jahr zuvor hatte Menelik Lidj Jasu, seinen eigensinnigen zwölfjährigen Enkel, zum Nachfolger bestimmt. Taitu jedoch förderte als gefügigere Kandidatin Zauditu, eine von Meneliks Töchtern. Da starb Tafaris Halbbruder Yema, und das Gouverneursamt von Harar war frei. 1910 erreichte dann Tafari mit politischer Unterstützung anderer Prinzen, was ihm von Geburt aus zustand, und zusammen mit seinen neuen Kameraden umstellte er sehr bald darauf den kaiserlichen Palast mit Truppen. Ruhig, aber bestimmt informierte er Taitu, ihre Pflichten am Hofe seien von jetzt an auf die Fürsorge für den schwachen Menelik beschränkt und die Macht werde einstweilen Ras Tasamma übergeben, einem Mann, der Tafari nahestand.
Eine Zeitlang blieben diese kühnen Maßnahmen wirksam, aber 1911 starb Tasamma, und wieder erhob Lidj Jasu Anspruch auf den Thron. 1913 starb dann schließlich Menelik, aber Lidj Jasu wurde nicht gekrönt, denn er war schamlos genug gewesen, zum Islam überzutreten, und hatte damit der beträchtlichen Autorität der Monophysitisch-Orthodoxen Kirche Äthiopiens getrotzt. Die Kirche und die schoanischen Edelleute kämpften lange und hart, um Jasu in Misskredit zu bringen, und 1917 beschlossen sie, Zauditu als Kaiserin zu bestätigen.
Während die Marionetten-Kaiserin machtlos inmitten der Auseinandersetzung stand, versuchten die Moslems unter der Führung des exkommunizierten Lidj Jasu, die dreitausendjährige Erbfolge Salomons zu untergraben. Aber der fünfundzwanzigjährige Tafari, der inzwischen als Lohn für seine Loyalität von der Kirche zum Ras ernannt worden war, ersuchte das Regime unter Zauditu, ihn zum Regenten zu ernennen. Der überaus gutaussehende und außerordentlich zurückhaltende und respektvolle Mann erschien der Kirche und der Schoa-Fraktion als ideales zweites Aushängeschild, und man erfüllte ihm seinen Wunsch. So erreichte er listenreich, was er mit Waffengewalt niemals hätte erreichen können. Er war dem kaiserlichen Zepter so nahe, wie es nur ging.
In den folgenden dreizehn Jahren machte er sich politisch unentbehrlich. Er scharte eine Gruppe von Vertrauten um sich und gab ihnen Regierungsämter in Addis Abeba. Er führte eine Bürokratie nach europäischem Muster ein und importierte Berater und Kenntnisse im politischen Handwerk aus dem Westen. 1923 hatte er schließlich erreicht, dass Äthiopien Mitglied des Völkerbundes wurde. Er machte ausgedehnte Auslandsreisen und war auf ihnen von einem Gefolge begleitet, zu dem auch Zebras und Löwen gehörten. Er wurde zu der Figur, mit der man in der Welt das exotische und rätselhafte Äthiopien identifizierte. Wenn er von solchen Reisen zurückkehrte, ließ er sich in einer europäischen Limousine zum Palast chauffieren – in Äthiopien so außergewöhnlich wie zahme Löwen im Westen.
Lidj Jasu ließ er 1921 gefangen nehmen und in eigens für ihn geschmiedeten goldenen Ketten unter wahrhaft luxuriösen Bedingungen zwölf Jahre lang bis zu seinem Tode festhalten. 1926 starb Habte Georgis, ein Kriegsminister, der sich dem schnellen Aufstieg des Ras Tafari wiedersetzt hatte, eines natürlichen Todes – so wurde zumindest behauptet. Eilends konfiszierte Ras Tafari seinen Besitz und übernahm den Befehl über seine Armee aus sechzehntausend Mann, die er gegen Kaiserin Zauditus letzte kriegerischen Anhänger aufbot: »Er schleicht wie eine Maus, aber hat den Rachen eines Löwen«, bemerkte ein anderer Ras in jenem Jahr.
Ras Tafari war zu dem hervorragendsten Mann in Äthiopien geworden, und er bestand darauf, dass Zauditu ihn zum ›negus‹, zum König, krönte, wobei er damit drohte, er werde sie höchstpersönlich von ihrem Thron vertreiben, wenn sie sich weigern sollte. In einem letzten Versuch, ihn gefügig zu machen, schickte Zauditu die große Armee ihres Mannes gegen die Streitkräfte des Ras Tafari, aber sie unterlagen und ihr Mann wurde getötet. Am 2. April 1930, zwei Tage nach dem Sieg des Ras Tafari, war auch Kaiserin Zauditu tot, und die Umstände, unter denen sie ums Leben kam, sind bis heute nicht geklärt.
Ein schmaler, scheinbar zerbrechlicher Mann, der kaum über einen Meter sechzig groß war und den man nur selten hatte laut sprechen hören, ein Mann, der vor gut zwanzig Jahren ohne Eltern und starke Verbindungen dagestanden hatte, die ihm politisch den Weg hätten ebnen können, hatte es geschafft, gegen alle Erwartung schließlich auch noch den letzten seiner Gegner herauszufordern, zu überlisten und aus der Welt zu schaffen.
In Addis Abeba gingen die Gerüchte um, dass sogar die engsten persönlichen Berater des Ras Tafari voller Furcht vor ihm waren, dass es ihnen widerstrebte, ihm die Hand zu schütteln oder ihm direkt in das ausgeprägte Gesicht mit seiner spitzen Nase, dem spärlichen Bart und den durchdringenden, fast schwarzen Augen zu sehen, all das umrahmt von wilden, buschigen Haaren.
Viele seiner Landsleute fühlten sich erinnert an die biblische Vorhersage, dass nach dem Letzten Krieg ein König der Könige aus Jesses Wurzel im Lande Davids gekrönt werde, ein Mann, dessen Augen wie Flammen des Feuers, dessen Haar wie Wolle und dessen Füße schwarz sein würden wie brennende Bronze, und dass dieser größte aller Könige den Tod besiegen und das Jüngste Gericht abhalten werde, nachdem er den Thron Babylons umgestoßen hatte, und alle, die Anspruch erhoben auf zeitweilige Macht, und ihre fehlgeleiteten Anhänger hinabstoßen werde in das Nichts.
Seltsame Geschichten begann man sich zu erzählen über die Kindheit von Tafari, und darin hieß es, er könne mit den Tieren sprechen. In seiner Jugend, so wurde behauptet, habe man ihn des Öfteren im Busch mit Leoparden und Löwen sich unterhalten sehen, und die wilden Bestien des Dschungels seien zahm gewesen zu seinen Füßen, so wie sie Jahrhunderte zuvor auf den berühmten äthiopischen Eremiten, den Heiligen Abbo, reagiert hätten.
Weiter wurde gesagt, dass Tafari als junger Student sehr klug und fähig gewesen sei, dass er aber die Priester wahrhaft erstaunt habe mit seinem ausgedehnten religiösen und mystischen Wissen. Nicht nur könne er nach Belieben zitieren aus dem Kebra Negast, sondern auch aus dem Buch von Kufale, dem Buch von Enoch, dem Hirten von Hermas, Judith, Ecclesiasticus, Tobit, dem Matschafa Berhan (Buch des Lichts), dem Sechsten und Siebten Buch Mose, den Büchern von Eden (während des Mittelalters heimlich aus der Genesis entfernt), allen einunddreißig Büchern der hebräischen Bibel, den einundzwanzig kanonischen Büchern des Neuen Testaments und zahlreichen anderen apokryphen und pseudo-epigraphischen Werken.
Es ging eine Geschichte, wonach ein einheimischer Priester in Harar den jungen Tafari kurz nach dem Tode seines Vaters besucht habe und wissen wollte, woher sein so weitreichendes Wissen stamme. Tafari erwiderte, ein Großteil sei ihm im Augenblick der Taufe gekommen, die der Tradition gemäß am vierzigsten Tag seines Lebens stattgefunden habe. Der Priester, der die Zeremonie leitete, habe Tafaris Augen mit der ersten Berührung des heiligen Chrisam geöffnet, und alles, was folgte, sei dem Säugling verständlich gewesen, als sei er schon erwachsen. Der Priester sprach seinen Nachnamen aus, daran könne er sich erinnern, und dann seinen Taufnamen, und dann habe er sanft an Tafaris Gesicht geblasen, um die bösen Geister zu vertreiben. In diesem Augenblick, so behauptete Tafari, habe er sich von einem goldenen Glanz umfangen gefühlt, und als der Priester begonnen habe, ihn zu salben, mit Wasser seine Stirn, seine Brust, seine Schultern und alle anderen siebenunddreißig vorgeschriebenen Stellen zu berühren, da habe er gefühlt, wie sein Wissen sich vergrößerte, wie es ihn anfüllte wie ein Gefäß und ihn ausstattete mit der großen klaren Erkenntnis über die Schöpfung und die wahre Aufgabe der Menschheit.
In den Wochen danach seien jedoch das Wissen und jenes besondere Gefühl der Klarsicht scheinbar immer weniger geworden.
Wann es wiedergekommen sei, habe der Priester gefragt.
Als die Vögel und die wilden Tiere und sogar die Insekten begonnen hätten, ihn zu begrüßen und mit ihm zu sprechen, ihn an das zu erinnern, was er schon wusste, habe Tafari geantwort.
Welches sei das erste Geschöpf gewesen, das mit ihm gesprochen habe?
Tafari habe um ein Blatt Papier ersucht und um Kreiden und mit außergewöhnlicher Leichtigkeit das Bild eines Vogels gezeichnet. Es habe einer Taube geglichen, aber ihr Gefieder sei bunt und exotisch gewesen. Der Priester habe Tafari fragen wollen, um was für einen Vogel es sich handele, und in eben dem Moment habe er verblüfft mit ansehen müssen, wie der Vogel von dem Blatt Papier aufgestiegen und aus dem nahen Fenster davongeflogen sei, hinauf in den Himmel, wo er verschwand.
Die Nachricht von dem merkwürdigen Sohn des verstorbenen Gouverneurs verbreitete sich in den Provinzen rasch und diskret durch das Netz der ›liqe kahnat‹ (Oberpriester), und es heißt, sie vereinbarten mehrere geheime Versammlungen mit ihm, um ihn zu befragen und nach Möglichkeit bei etwas zu ertappen, was nach ihrer Meinung blasphemischer Unfug oder heidnische Zauberei war.
Bei einer dieser Versammlungen soll der Junge verdeutlicht haben, er sei gut vertraut mit den seltenen Manuskripten Abba Aragawis und jener koptischen Mönche, die man die »neun Heiligen« nannte. Sie waren im Jahr 480 nach Äthiopien gekommen und hatten in der Provinz Tigre die ersten Klöster gegründet. Außerdem enthüllte er, er kenne die okkulten Anwendungen Urims, Thummims und der Mezuzah ebenso wie die Verwendung der in der ägyptischen Zauberei vorkommenden magischen Worte ›gematria‹ und ›notarikon‹ und die magischen Namen Adonay, El und Elohe. Er zeigte Vertrautheit mit den kabbalistischen Lehren, den Schriften Gilgameschs, den heidnischen Riten des Isis-Kults, wusste von der Schlange Arwe und den abessinischen Göttern von der Erde (Meder), Meer (Beher) und Krieg (Mahem), und kannte die Geheimnisse der Astrologie und Numerologie. Am wichtigsten jedoch war: Tafari offenbarte den Priestern sein Wissen über die wichtigsten Botschaften des Ägyptischen Totenbuches und des ägyptischen Buches der zwei Wege.
In der altägyptischen bzw. koptischen Sprache bedeutet das Wort für Zauberer ›Schreiber im Haus des Lebens‹. Männer, die man so bezeichnete, waren als freundliche, weise Menschen bekannt, nicht als gottlose Schwindler, und das Ersuchen des Volkes um Zaubersprüche, die das Böse fernhalten sollten, stellten für sie eine alltägliche Aufgabe dar. Es gab jedoch verschieden offizielle Riten, die nur Zeremonien von äußerster Ernsthaftigkeit vorbehalten waren, unter anderem dem Heb-Sed-Fest, zu dem der Pharao, wenn er dreißig Jahre geherrscht hatte, ins etwa 30 Meilen von der Großen Pyramide entfernte Sikkah reiste. Dort, an einem heiligen, von gewaltigen Monumenten flankierten Ort, musste der in die Jahre gekommene Pharao laufen, springen, ringen und tanzen und wurde auf geheimnisvolle Weise verjüngt und wieder mit der Vitalität eines Heranwachsenden versehen. Es gab auch ein Ritual namens ›Zerbrechen der Roten Krüge‹, wobei roten Tonschalen aus Theben und menschliche Figürchen aus Sakkarah in peinlich genauer Folge zerschmettert wurden, um die Feinde des Herrschers abzuwehren oder zu vernichten.
Diese Riten wurden unter der Aufsicht älterer koptischer Zauberer durchgeführt, aus dem gleichen Männerorden, den der Pharao einst gebeten hatte, seine Zauberkunst im Wettstreit mit Moses und Aaron zu messen, um zu erfahren, ob sie tatsächlich mit der Autorität von Gottes Wort sprachen, als sie von den Ägyptern verlangten, sie sollten die Israeliten ziehen lassen. Denn die Ägypter glaubten, wenn man im ›Haus des Lebens‹ die korrekte Abfolge der Riten und Zauberformeln einhalte, seien die magischen Möglichkeiten grenzenlos.
Im Kern dieser Zauberei stand das ›Wort‹. Wurde das passende Wort ausgesprochen oder geschrieben, reichte dies aus. Namen hatten im alten Ägypten natürlich die höchste Bedeutung. Jeder Ägypter hatte eine Reihe verschiedener Namen, von denen nur einer echt war. Dieser wurde, falls möglich, niemandem enthüllt. Zaubersprüche, so kunstvoll sie auch gefertigt waren, konnten nur wirksam werden, wenn man sie gegen jemanden richtete, dessen wahren Namen man kannte. Von jemandem, dessen Macht der Macht des Pharaos nahekam, hieß es: »Nicht einmal seine Mutter weiß, wie er wirklich heißt.«
Niemand, erzählte Tafari den Priestern, kenne seinen wahren Namen.
Irgendwann bat angeblich ein alter ›abmnet‹ (Abt), man möge ihn Tafaris Handflächen untersuchen lassen. Er sah, dass die Stigmata da waren und die Lebenslinie in einem Sinnbild der Unendlichkeit zu sich selbst zurückführte. Tafari flüsterte ein Wort in das Ohr des Abtes, woraufhin alle Farbe aus dem Gesicht des alten Mannes wich. Er verließ den Raum wie im Schockzustand und weigerte sich, zurückzukehren oder mit seinen Kollegen zu sprechen.
Tafari beendete die Abschlusssitzung mit den Gelehrten und frommen Männern, indem er – so lebhaft, als habe er den Ereignissen persönlich beigewohnt – die Geschichte erzählte, wie König Salomon von Jerusalem Königin Makeda von Saba kennen- und lieben gelernt hatte. Unzählige Stunden, so wird berichtet, hörten die frommen Männer entzückt und aufmerksam zu, erstaunt über die intime Vertrautheit des Jungen mit den uralten Ereignissen und ohne ihn jemals zu unterbrechen.
Der Junge sprach langsam und sorgfältig und ließ keine Einzelheit aus, ob es nun um den Stand der Sonne an einem bestimmten Tag und das nachfolgende Wetter ging, um die Architektur und Innenausstattung der Paläste, den Schmutz der Sklavenhütten, den stechenden, wundscheuernden Staub der städtischen Straßen, das heraufsteigende spätnachmittägliche Hitzeflirren aus den weiträumigen Wüstenbecken oder die Kleidung, die Reden, das Benehmen und sogar die Kost einer ehrwürdigen Gestalt, die in seiner Erzählung vorkam. Gefühlsbeschreibungen nahm er mit besonderem Respekt vor, die Zusammenhänge verschiedener Schlüsselaspekte entwirrte er ohne Eile, und all dies verwob er gewandt zu einem Geflecht äußerst fesselnder Abhandlungen.
Laut Tafari hatte die hinreißende und reiche Königin Makeda durch den äthiopischen Kaufmannsprinzen Tamrin, den Besitzer von fast vierhundert Schiffen und fünfhundert Kamelen, von dem großen König Salomon erfahren. Nach seiner Rückkehr von einer Handelsreise nach Jerusalem, bei der er dem hebräischen König große Mengen Ebenholz, Rotgold und Saphire geliefert hatte, erzählte Tamrin Makeda von Salomons majestätischen Tempel, seinem Palast, seiner Güte und seiner Rechtschaffenheit als Richter über seine Untertanen.
Makeba beschloss bezaubert, den großen König zu besuchen, und machte sich mit einer Karawane aus achthundert Kamelen und zahllosen Bediensteten in einem gewaltigen Tross, den Tamrin führte, auf den Weg. Bei der Ankunft in Jerusalem wurde sie von Salomon, dessen Gastfreundschaft sie entzückte und dessen Klugheit sie erleuchtete, in seinem Palast willkommen geheißen. Salomon brachte sie davon ab, die Sonne anzubeten, und Makeda wurde Jüngerin des einzig wahren Gottes, des Gottes Israels, dessen Namen niemals ausgesprochen werden durfte.
Die jungfräuliche Königin artikulierte ausführlich ihr Verlangen, alles Gelernte an ihr eigenes Volk weiterzugeben, doch Salomon, der sich in Makeda verliebt hatte, brachte sie dazu, ein weiteres Jahr bei ihm zu verbringen, um ihre ›Einführung in die Weisheit zu vervollkommnen‹. In der letzten Nacht fand in seinem Palast ein Abschiedsbankett von nie dagewesener Pracht statt, dann bat Salomon Makeda, mit ihm das Bett zu teilen. Makeda lehnte ab und bat ihn inständig, sie nicht mit Gewalt zu nehmen. Salomon entsprach dieser Bitte nur unter der Bedingung, dass sie in dieser Nacht nichts mehr von ihm verlangte. Makeda war einverstanden, und so befriedigte Salomon sich an ihrer Sklavin. Doch in der Nacht stand Makeda auf, um sich einen Schluck Wasser aus ihrer Kammerzisterne zu holen, und Salomon, der den Schlaf nur vortäuschte, um sie zu beobachten, beharrte darauf, sie habe ihren Eid gebrochen, indem sie in einem so trockenen Land eine so kostbare Substanz zu sich nahm. Und so hatte sie keine andere Wahl mehr, als sich seiner Lust zu fügen.
Am nächsten Morgen schenkte Salomon ihr einen Ring, in den das Siegel des Löwen von Juda eingraviert war. Er wies sie an, ihn ihrem erstgeborenen Sohn zu schenken, und den Jungen, wenn er reif genug war, zu ihm zu schicken, damit er ihn erziehen könne. Während der langen Heimreise nach Äthiopien schenkte Makeda einem Jungen das Leben, den sie Ebna Hakim nannte, was ›Sohn des Weisen‹ bedeutet.
Als Ebna in Saba aufwuchs, wurde er wegen seiner unehelichen Geburt fortwährend von seinen Gefährten gehänselt. Als Heranwachsender konnte er den Spott und die Kränkungen nicht mehr ertragen. Zornig und verwirrt nahm er allen Mut zusammen, den er zuvor nicht aufgebraucht hatte, und fragte seine Mutter nach dem unbekannten Vater. Erfreut berichtete sie ihm von Salomon und zeigte ihm seinen Ring.
Der in seiner kühnen Einfachheit geschmackvolle Ring war anders als alles, was Ebna je gesehen hatte. Anfangs widersetzte er sich, als Makeda ihm den Ring an den Finger stecken wollte, doch dann nahm er ihn und tat es selbst. Die Wirkung auf Ebna war beunruhigend – ihm war, als ströme plötzlich ein Schwall gezackter, brennender Energie durch seinen Körper. Da es ihm peinlich war, so fassungslos vor seiner Mutter zu stehen, bemühte er sich, seine Angst zu zügeln, doch das Durcheinander in seinem Geist wollte sich nicht legen. Als er einen Versuch machte, sich den Ring vom Finger zu ziehen, begann seine Hand heftig zu zittern. Von Schwindel ergriffen und schweißgebadet hielt er Makeda den Ring hin, doch sie wollte ihn nicht zurücknehmen. »Es ist ein Männerring und das Geschenk eines Königs«, sagte sie zu ihrem Sohn, und dann schickte sie ihn zu seinem Vater, damit er von ihm lerne.
Als Ebna vor dem König stand, erfuhr er zu seinem Ärger und Erstaunen eine schroffe Abweisung, da Salomon ihn für einen Schwindler hielt. »Ich erkenne meinen Sohn«, donnerte er, »an dem Ring, den er trägt!« Beschämt holte Ebna den Ring hervor, und der Zorn seines Vaters verwandelte sich in Trauer. »Du fürchtest dich vor seiner Macht«, sagte Salomon, »doch seine Macht kommt aus dir. Du musst lernen, dich mit deinem Schicksal abzufinden.«
Ebna verbrachte viele glückliche Jahre an Salomons Hof, aber schließlich entschied er, »in die Berge seines Mutterlandes« zurückzukehren. Der König, enttäuscht darüber, dass Ebna nicht sein Nachfolger werden wollte (Salomons ältester Sohn Rehoboam war nämlich ein reichlich frivoler Geist), gestattete ihm nur unter einer Bedingung, abzureisen: Er sollte die belesensten Söhne seines persönlichen Beraters mitnehmen, damit sie in Äthiopien das hebräische Gesetz lehrten. Ebna war einverstanden, doch der Berater und seine Söhne widersetzten sich, da sie glaubten, sich aus der Reichweite der besonderen Gnade und des Schutzes Gottes zu entfernen, wenn sie Israel verließen.
Von ihrer Unverschämtheit erzürnt, stellte Salomon die Söhne des Beraters unter einen heiligen Bann. Daraufhin kapitulierten sie zwar, aber sie sannen auf Rache. Azarius (auch Eleazar genannt), der Sohn des Hohepriesters Zadok, brütete eine Intrige aus, um die Bundeslade zu stehlen und heimlich nach Äthiopien zu schaffen, um sich Jehovas Nähe zu versichern. Der Plan wurde ohne Ebnas Wissen ausgeführt.
Als Salomon erfuhr, was geschehen war, sandte er Reiter aus, um die Karawane zu überwältigen, doch Jehova, über seine Schwelgereien und seine Eitelkeit erzürnt, verwirrte die Reiter des Königs und brachte die Karawane dazu, so schnell zu reisen, dass sie ihr Ziel Monate vor dem festgelegten Termin erreichte.
Und so, erläuterte Tafari den Priestern am Ende seines Monologs, fand die Bundeslade mit Jehovas Segen eine neue ständige Heimat in Äthiopien, und Ebna, der Salomons Ring am Finger trug, wurde Kaiser und nahm den Namen Menelik an.
Nach und nach erwachte der Neid der anfänglich vor der Kraft und Schönheit von Tafaris Vortrag demütigen Priester, und sie argwöhnten über den Detailreichtum, mit dem der Junge die biblische Geschichte ausgeschmückt hatte. Sie wollten wissen, welches seine Informationsquellen seien.
Statt auf dieses Ersuchen zu antworten, wandte Tafari sich an einen Mönch, der in der Kathedrale von Azum gedient hatte, in der man die Bundeslade aufbewahrte. Er beschrieb ihm leise das ›kedusta kedussan‹, das Allerheiligste, in dem die ›tabbot‹ –
Bundeslade – steht, und rezitierte verschiedene sie zierende Inschriften. Der Schock seiner Enthüllung soll den Mönch, der einer Ohnmacht nahe war, dazu gebracht haben, sich die Ohren zuzuhalten, um die blasphemischen Worte nicht zu hören. Er und die restlichen Priester zerstreuten sich in aller Eile.
Später schlossen sie ein feierliches Abkommen, um alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, den jungen Tafari daran zu hindern, die Macht über das Land zu erringen. Er war zu gefährlich – unvorstellbar gefährlich.
Die Geschichten über Tafaris frühe Begegnungen mit den Priestern und seine okkulte Weisheit sowie seine unheimlichen Kräfte verbreiteten sich wie Buschfeuer 1930 in Äthiopien, als sich das Land darauf vorbereitete, Ras Tafaris Gelöbnis zu erfüllen, seine Krönung im November werde die großartigste und feierlichste sein, die Afrika je erlebt habe.
Es war Gesetz, dass alle innerhalb der Landesgrenzen erlegten Löwen in den Besitz des Kaisers übergingen, des siegreichen Löwen des Stammes Juda. Monate vor der Krönung schickte man einen Ballen Löwenfelle nach London, um sie von einem Schneider in der Bond Street zu zeremoniellen Gewändern verarbeiten zu lassen. Tafaris Gesandte erwarben in Europa Gold und Edelsteine im Wert von einer Million Dollar; auch sie wurden nach England gebracht, um sie zusammen mit Salomons Siegel und der Mähne des Löwen von Juda in zwei Kaiserkronen einzuarbeiten. (Die Kronen mussten pünktlich fertiggestellt und den koptischen Priestern in Addis Abeba persönlich übergeben werden, damit sie die vorgeschriebenen einundzwanzig Tage vor der Krönung mit ihnen beten konnten.) Zudem erwarb man die Staatskarosse Wilhelms II.,
ein Gespann schneeweißer Habsburger-Hengste und engagierte einen österreichischen Kutscher, der zuvor in den Diensten von Kaiser Franz Joseph gestanden hatte, um den Kaiser und die Kaiserin zu fahren.
In Addis Abeba wurden neue Straßen angelegt, vorhandene erweitert, und eine große Anzahl neuer Gebäude, Monumente, Torbögen und Statuen wurde errichtet, um an das große Ereignis zu erinnern, das für den 2. November festgesetzt worden war. Einladungen an Würdenträger in aller Welt gingen hinaus, und die Gäste begannen Mitte Oktober einzutreffen. Mit dem Schiff landeten sie im Hafen von Dschibuti am Golf von Aden im damaligen Französisch-Somaliland, und ihre Reise in das gebirgige Innere von Äthiopien erfolgte mit einer Eisenbahn, die eigens für den 780 Meilen langen Weg auf den neuesten technischen Stand gebracht worden war.
Zu denen, die am Monatsende eingetroffen waren, gehörten Isaburo Yoshida aus Japan, Marschall Franchet d’Esperey aus Frankreich, Konteradmiral Prinz Udine aus Italien, der griechische Graf Metaxas, Baron H.K.C. Bildt aus Schweden, Muhammad Tawiq Pascha aus Ägypten und der Herzog von Gloucester, der eine tonnenschwere Hochzeitstorte überbrachte. Hindenburg schickte fünfhundert Flaschen erstklassigen Rheinweins, und die französische Regierung stellte ein Privatflugzeug. Sonderbotschafter Herman Murray Jacobs, den Herbert Hoover beauftragt hatte, die Vereinigten Staaten zu vertreten, war jedoch mit den meisten Geschenken beladen: Neben einem signierten und hübsch gerahmten Foto des Präsidenten hatte er eine Bestandsliste nichtamtlicher, privat erworbener Geschenke mitgebracht. Sie umfassten einen stromgespeisten Kühlschrank, eine rote Schreibmaschine mit dem Wappen der kaiserlichen Streitkräfte, einen Radio-Phonographen, einhundert Platten ›echt amerikanischer Musik‹, fünfhundert Rosenstöcke – einschließlich einiger Dutzend der sogenannten Präsident Hoover-Sorte, einer neue Amaryllisart, die das US-Landwirtschaftsministerium entwickelt hatte –, eine gebundene Ausgabe von National Geographic, einen gebundenen Bericht über die Abessinien-Expedition des Chicago Field Museum und Kopien der Filme ›Ben Hur‹, ›King of Kings‹ und ›With Byrd at the South Pole‹.
An den Tagen vor der Krönung wurde eine Statue Meneliks II. vor der Kathedrale von St. Georg enthüllt, und am Vorabend der Feierlichkeiten fand ein Gottesdienst in der Kathedrale statt, der die ganze Nacht andauerte. Der Negus Ras Tafari und seine Gattin Woisero Menen beteten im Chor mit Priestern und Diakonen in kostbaren Gewändern, die tanzten, sangen, auf Trommeln schlugen und ihre Gebetsstöcke im Takt der Musik von Harfen, Leiern, Tambourinen, Becken und der einsaitigen ›masanko‹ bewegten. In bestimmten Zeitabständen hallte das weihrauchgeschwängerte Sanktuarium wider vom inbrünstigen Gesang eines Frauenchors und dem rhythmischen Klatschen, mit dem die Hymnen begleitet wurden. Draußen, auf den Stufen der Kathedrale, standen Adlige und Diplomaten mit brennenden Kerzen.
Sonntag, der 2. November 1930, dämmerte klar und milde, und schon um sieben Uhr in der Frühe hatten die meisten der siebenhundert offiziellen Gäste ihre Plätze in der üppig geschmückten Halle auf der westlichen Seite der Kathedrale eingenommen. Löwenmähnige Feudalhäuptlinge saßen Seite an Seite mit uniformierten ausländischen Würdenträgern. Kurz nach sieben Uhr dreißig öffneten sich die mächtigen Türen des Allerheiligsten, und Hunderte von singenden Priestern traten heraus, gefolgt von dem Negus, bekleidet mit einer weißseidenen Kommunionsrobe. Er trat unter einen Baldachin, der auf goldenen Pfosten ruhte und im Zentrum des Mittelschiffs stand. Dann setzte er sich auf seinen rotgoldenen Thron. Die amharische Liturgie wurde von Abuna Kyril zelebriert, dem Erzbischof der Orthodoxen Kirche von Äthiopien, ihm assistierte ein Repräsentant des koptischen Patriarchen von Alexandria.
Seine Majestät erhob sich, um Kirche und Staat seine Loyalität zu geloben und zu versprechen, das Wohl seiner Untertanen allen persönlichen Belangen voranzustellen. Bei den Erklärungen und Segnungen empfing er nacheinander die Zeichen seines kaiserlichen Amtes: die königlichen Insignien, die mit Gold verzierte scharlachrote Robe, den juwelengeschmückten Säbel, das Zepter und den Apfel, den Ring des Salomon, zwei diamantene Ringe und zwei goldene Lanzen. Der Abuna trat vor und salbte in einem Ritus, der zurückgeht auf die Weihe des David durch Samuel und des Salomon durch Nathan und Zadok, die Stirn des Tafari mit Öl und krönte ihn als Haile Selassie I., Macht der Heiligen Dreieinigkeit, zweihundertfünfundzwanzigster Kaiser der Dynastie Salomons, Auserwählter Gottes, Lord der Lords, König der Könige, siegreicher Löwe vom Stamme Juda. Und dann besiegelte der Abuna den Augenblick mit der Segnung: »Gott möge diese Krone zu einer Krone der Heiligkeit und der Herrlichkeit machen. Und mögest du durch die Gnade und die Segnungen, die wir erteilt haben, einen unerschütterlichen Glauben gewinnen und ein reines Herz, auf dass du die ewige Krone zum Erbe bekommst. Amen.«
Als Selassies ältester Sohn, der Kronprinz Asfa Wossen, vor dem Kaiser in einer Geste höchsten Respekts niederkniete, schossen einhundertundeine Kanone vor der Kathedrale donnernd Salut. Tagelang dauerten die Festlichkeiten in Addis Abeba und im gesamten Kaiserreich, auch bei den Bauern und Kleinstädtern, die von den Krönungsfeiern ausgeschlossen worden waren und sich nicht in den Stadtteilen rings um die Kathedrale hatten aufhalten dürfen. Korrespondenten der internationalen Presse berichteten überschwänglich von den Ereignissen.
In Afrika pries man Selassie als den größten der modernen Monarchen und als Symbol der gigantischen Möglichkeiten des Kontinents. In den USA strömten die Bewohner von Harlem in die Kinos, um die Wochenschauberichterstattung über die Krönung mitzuerleben. In der Karibik war wie an anderen Orten im Westen der Beginn von Selassies Herrschaft für alle unterdrückten farbigen Völker der leuchtende Beweis dafür, dass, wie die Garveyites, die Zurück-nach-Afrika forderten, und die Fanatiker des synkretistischen Rasta-Kults vorhergesagt hatten, der Tag der Erlösung bevorstand.
Für die Garveyites war Haile Selassie ein Held ohnegleichen. Für die Rastas war er der lebendige Gott Abrahams und Isaaks, Er, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf.
Bald nachdem Selassie den Thron bestiegen hatte, begann er, demokratische Institutionen einzuführen und ganz allgemein Äthiopien aus seiner feudalen Vergangenheit zu führen. Die neue Verfassung von 1931 machte die 26 Millionen Einwohner Äthiopiens, die zuvor nur Sklaven des Adels gewesen waren, zu Bürgern des Kaiserreichs.
Um die arme Landbevölkerung, die fast nur aus Analphabeten bestand, langsam in das zwanzigste Jahrhundert zu überführen, wurde ein System von Grund- und weiterführenden Schulen eingerichtet. Das antiquierte System der Landverteilung wurde reformiert, und die Sklaverei wurde abgeschafft. Man brachte den Verwaltungsdienst auf einen neueren Stand, baute mehr Straßen und initiierte andere Projekte der öffentlichen Hand, die Arbeit brachten. Aber der Fortschritt ging nur langsam vonstatten in einem Land von 455.000 Quadratmeilen Größe, dessen Stammesbevölkerung sich in mehr als zweitausend verschiedenen Sprachen und Dialekten verständigte.
Der Schatten des Faschismus, der sich in den dreißiger Jahren über Europa ausbreitete, fiel 1934 plötzlich auch auf Äthiopien, als Benito Mussolini versuchte, Italiens Kolonialinteressen in Afrika über Eritrea und Italienisch-Somaliland hinaus auszudehnen. Selassie versuchte beim Völkerbund Unterstützung zu erlangen, aber wurde nicht erhört. Im Oktober 1935 wurde Äthiopien besetzt, kurz darauf fiel Addis Abeba, und 1936 ging Selassie ins Exil, zuerst nach Jerusalem, um zu beten, und dann nach England. Im Juni des Jahres sprach er vor dem Völkerbund in Genf, und in einer außergewöhnlich würdevollen und leidenschaftlichen Rede, in der er die Selbstbestimmung forderte, beschämte er die Delegierten wegen ihrer Feigheit. »Gott und die Geschichte werden sich Ihrer Entscheidung erinnern«, sagte er. »Heute sind wir es. Morgen werden Sie betroffen sein.«
Im Mai 1940 rettete Winston Churchill ihn aus seinen Schwierigkeiten, als Italien als Feind Großbritanniens offiziell in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Von den Briten nach Khartum eingeschmuggelt, organisierte Selassie in den Wüsten des Sudan eine Armee. Am 5. Mai 1941 kehrte der Kaiser auf den Tag genau fünf Jahre nach der italienischen Invasion im Triumph nach Addis Abeba zurück. Sein Werk der Reform und Modernisierung weiter vorantreibend, ließ er zweihundert neue Schulen bauen und machte sich daran, die stagnierende Wirtschaft wiederzubeleben, indem er zum Beispiel einen lebenswichtigen Hafen an der Küste des Roten Meeres ausbauen ließ.
1955 erließ er eine neue Verfassung, die allen seinen Untertanen das allgemeine Wahlrecht und Gleichheit vor dem Gesetz zusprach, aber das Dokument enthielt einen entscheidenden Vorbehalt: »Kraft seines Kaiserlichen Blutes sowie der Salbung, die Er empfangen hat, ist die Person des Kaisers heilig. Seine Würde ist unverletzlich und seine Macht unbestreitbar.«
Fünf Jahre später, als sich Selassie auf einem Staatsbesuch in Brasilien befand, gab es eine Palastrevolution, die von seinem Sohn, Kronprinz Asfa Wossen, unterstützt wurde. Der Kaiser kehrte zurück, um den Umsturzversuch niederzuschlagen, und ließ den Anführer, den Kommandanten der Kaiserlichen Leibwache, hängen. Der Prinz blieb verschont, und das war eine Geste der Milde, die an die gnädige Behandlung der geschlagenen italienischen Truppen durch den Kaiser im Jahre 1942 erinnerte. Aber Selassie spürte, dass ein neuer politischer Wind über seinem Reich aufgekommen war.
Erklärtes Ziel des Umsturzversuches war gewesen, ein neues Regime einzusetzen, das einen rascheren gesellschaftlichen und ökonomischen Fortschritt gewährleisten sollte. Selassie begann, von Zeit zu Zeit in Rundfunkansprachen seine Landsleute über die neuesten Programme und politischen Entscheidungen zu informieren. Aber viele waren der Meinung, er tue zu wenig und es sei überdies zu spät. Eine winzige Fraktion der intellektuellen Elite Äthiopiens machte sich in den frühen siebziger Jahren bemerkbar, als das sogenannte Horn von Afrika zu einer der strategisch wichtigsten und politisch unsichersten Regionen der Welt wurde. Die USA schickten Militärhilfe, um die äthiopische Armee zu stärken, und die Sowjetunion bewaffnete den ewigen Feind Somalia und unterstützte den revolutionären Befreiungskampf in der Region Eritrea.
Unterdessen verbreitete sich in der Bevölkerung Unzufriedenheit, denn man war zornig über den extrem niedrigen Lebensstandard und die in höchste Höhen steigenden Preise. Als 1973 eine Dürre in zwei nördlichen Provinzen zum Hungertod von ungefähr 100.000 Menschen führte, erreichten Unzufriedenheit und Wut über die Unfähigkeit der Regierung ihren Höhepunkt. Die Armee, die zum größten Teil aus Bauern bestand, verlangte eine Erhöhung des Solds und war voller Ingrimm über ihren Kaiser, der inmitten schrecklicher Armut im Überfluss lebte und angeblich Milliarden Dollar auf Schweizer Bankkonten in Sicherheit gebracht hatte (obwohl derartige Behauptungen nie bewiesen worden sind).
Die abtrünnigen Streitkräfte organisierten sich, und am Donnerstag, dem 12. September 1974, erhoben sie sich bei Kälte und Regen gegen ihren Kaiser. Vorangegangen war eine volle Woche schlechten und regnerischen Wetters, für den Kaiser nur unterbrochen durch Fernsehnachrichten über die Verhaftung seiner Minister und Freunde. Einige wenige Verwandte entkamen dem Fangnetz der Revolutionäre, und Kronprinz Asfa Wossen erholte sich in einem Schweizer Krankenhaus von einem Schlaganfall, aber die meisten Angehörigen des Hauses Makkonen und der innere Kreis seiner Familie kamen ins Gefängnis oder wurden exekutiert.
Zum angekündigten Zeitpunkt trat dem Kaiser eine Abordnung seiner Truppen im Vestibül seines Büros im Palast entgegen. Er stand vor einer dekorativen Landkarte Äthiopiens in untadeliger Uniform. Man fuhr ihn in eine Kaserne, und auf dem Weg wurde er von der Menge als Dieb beschimpft. Man warf ihn in eine kleine, schmutzige Zelle und ließ ihn dort zurück, gehüllt in seinen wollenen Umhang, mit einem Blechnapf kalter Verpflegung, und die Kakerlaken machten sich zu seinen Füßen darüber her. Er kniete nieder und betete.
Monate später brachte man den zweiundachtzigjährigen Haile Selassie I. in den Palast zurück, wo er in einer kleinen Wohnung den Tod erwarten durfte.
Am Morgen des 27. August 1975 schlug die Uhr sieben, als ein Diener weinend am Bett des Löwen von Juda stand – so die Meldung der Regierung. In London gab Kronprinz Asfa Wossen eine schriftliche Erklärung ab, in der gefordert wurde, dass »unabhängige Ärzte und das Internationale Rote Kreuz die Erlaubnis erhalten sollten, eine Autopsie durchzuführen, um die Todesursache des Vaters von Äthiopien und Afrika festzustellen«.
In der Kathedrale von St. Georg wurde kein ›tezkar‹, Gedenkgottesdienst, abgehalten, und auch nirgendwo sonst im Lande.
In den darauffolgenden Jahren wurde die Grabstätte von Haile Selassie I. nicht gefunden, obgleich viele danach gesucht haben. Und niemand fand den heiligen Ring des Salomon.
In der Karibik, auf der Insel Jamaika, hatten die Brüder des Rastafari-Kults ein seltsames und freies Lächeln auf den Lippen.
»You nuh cyan bury Jah«, sagten die Rastas. »Jah kann man nicht begraben.»