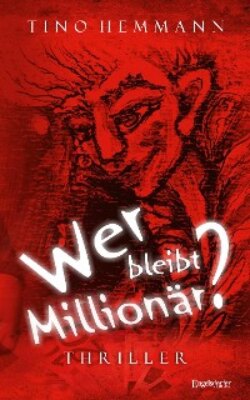Читать книгу Wer bleibt Millionär? - Tino Hemmann - Страница 6
Jeder Mensch kann die Narrheit erlernen, die wenigsten lernen die Weisheit.
ОглавлениеThomas Quaarck, Medienunternehmer und Besitzer des unbedeutenden privaten Shoppingsenders Kanal E-17, war achtunddreißig Jahre alt, blond, blauäugig und ein wenig nach rechts tendierend politisch eingestellt. Er vertrieb über seinen Fernsehsender meist Billigprodukte aus Asien. Produziert wurden die Sendungen in Leipzig, genau drei Stunden pro Tag. Das Verkaufsportal sendete jedoch über Satellit rund um die Uhr, wobei die Beiträge zum gleichen Angebot oft zehn Mal am Tag über die Bildschirme flimmerten. Quaarck wurde nicht ausgesprochen reich damit, doch für einige ausschweifende Orgien mit jungen tschechischen Mädchen reichte das Geld auf jeden Fall.
Eines Tages tauchten zwei Männer in seinem Studio, einer eher nach Abriss als nach Fernsehen riechenden Halle in einem alten Leipziger Industriegelände, auf. Sie waren angeblich Filmemacher so wie er. Im Grunde genommen begehrten sie nur zu wissen, über welche technischen Möglichkeiten der Chef von E-17 verfügte. Auf dessen Frage, was sie denn wollten, gingen die beiden Herren nicht näher ein. Vielleicht gäbe es später ein lukratives Angebot für Quaarck, sagten sie. Und sie erkundigten sich nach Eric, einem vollbärtigen, dünnen Kerl, dem angeblich auf offener Straße bereits Geld zugesteckt worden war, weil man ihn für einen Obdachlosen gehalten hatte. Eric war Quaarcks Mädchen für alles, zudem ein begnadeter Tontechniker, der gleichzeitig Regie führen, den Schreibkram als Produzent erledigen und die Technik instand halten konnte.
Dann kam dieser gewisse Sonntagmittag. Leipzig glühte, die Menschen wirkten träge und müde. Faul wirkende Urlauber bevölkerten die Strände der Tagebau-Restlöcher im Süden der sächsischen Scheinmetropole.
In seinem Büro, einem dunklen und muffigen Raum unmittelbar neben der großen Halle, entspannte sich Quaarck rücklings auf einer Matratze liegend, ein auf seiner Brust abgestelltes Glas mit Schirmchen in einem alkoholischen Cocktail mit einer Hand haltend und eine weit in die Stirn gezogene, rote Schirmmütze von Ferrari tragend. Der recht schwammig wirkende Mann sabberte ein wenig, denn neben ihm kniete mit freiem Oberkörper eine recht attraktive, mit Sicherheit minderjährige Rothaarige, die mit der rechten Hand abwechselnd Quaarcks nicht sonderlich großen, erigierten Schwanz und seinen haarigen Hodensack in den himmelblauen Shorts massierte.
Das Öffnen der Tür war kaum zu hören. Ganz langsam fiel das Glas aus der Hand des Medienmännleins und rollte von dessen Brust auf die Matratze, während das Schirmchen unterhalb des Kehlkopfes liegen blieb und ein Rinnsal des grünlichen Getränks über seinen Hals lief, um sich dort mit einem roten Flüsschen zu vermischen, denn gleichzeitig verließ ein wenig Blut Quaarcks Hals.
Das Mädchen hörte den verwunderlich leisen Schuss erst, nachdem der Bruchteil einer Sekunde vergangen war, worauf ihre rechte Hand augenblicklich den Rückzug aus den himmelblauen Shorts antrat. Sein ängstlicher Blick wanderte zur Tür. Eben dort standen zwei maskierte Herren – das Mädchen konnte nicht wissen, dass es sich um die kürzlich hier aufgetauchten Besucher handelte. Der eine zielte noch immer mit seiner recht groß wirkenden Waffe auf Quaarck, die Lippen unter der Maske des zweiten schienen das Mädchen anzulächeln. Die Rothaarige schlüpfte hektisch in ihre überschaubare Anzahl an Kleidungsstücken und blickte die beiden Herren ängstlich an.
»Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Hat er dich bezahlt?«, fragte der eine. Seine Stimme klang sehr jung.
Sie nickte.
»Dann geh jetzt. Und keine Angst, in einer Stunde ist er wieder bestens drauf.«
Kaum war das Mädchen verschwunden, nickten sich die Herren zu. »Sperren wir den irren Halbnazi für ein paar Tage weg.«
»Mit diesem Eric geht alles seinen Gang?«
»Ich denke schon. Er will zehn Prozent.«
»Eine faire Forderung. Ist er verlässlich?«
»Absolut.«
»Ich will ihn sprechen. Sorg dafür, dass er in einer Stunde hier ist. Bis dahin prüfe ich das Equipment und die Räumlichkeiten.«
»Alles klar, Chef.« Derjenige mit der jungen Stimme nahm sein Handy zur Hand. »Ihr könnt kommen und Quaarck wegbringen. Und vier Mann sichern das Gebäude. Unsichtbar. Und bringt mir diesen Eric her.«
*
»Haben wir heute noch was vor?«
Schauspielveteran Klaus van Boomerland, einer der wenigen, die sich einbilden durften, es in der jüngsten deutschen Filmbranchenzeit tatsächlich zu etwas gebracht zu haben, fuhr sich über das kahle Haupt. Dabei blickte er das vor ihm stehende, mit körperbetonten Fetzen in schrillen Farben bekleidete männliche Model lustvoll fragend an.
Francesco erfüllte unter anderem die Aufgaben eines modernen Butlers, der sich gern im Glanze van Boomerlands sonnte und der wahrlich alle Aufgaben zu erfüllen gedachte. Nach kurz angespieltem Theater sagte er »Nein«, um anschließend die gestylten Finger grazil und übertrieben zappeln zu lassen und aus runden, auffällig geschminkten Lippen zu hauchen: »Oder etwa doch?«
»Wonach steht dir wohl der Sinn, Francesco?«
»Wonach schon?« Der Butler sprach gerade so laut, dass seine Worte ausschließlich für die kleinen Schweinchenohren van Boomerlands bestimmt sein konnten. Sie suggerierten eher eine innere Freude denn einen Vorwurf. Er stolzierte mit Modelschritten und schwingendem Popo auf den Wagen zu und öffnete schwungvoll die hintere rechte Seitentür. »Wir sollten in unserer hübschen, geräumigen Badewanne neue Kräfte tanken.«
»In meiner Badewanne?« Klaus van Boomerland betonte das Wort »meiner«, während er seinem jungen Etwas grinsend folgte. »Warum nicht?«, flüsterte er mehr zu sich selbst.
Der kahlköpfige Dreiundsechzigjährige wirkte im Gegensatz zu seinem Freund unglaublich maskulin und wurde nach wie vor von der Frauenwelt angeschmachtet, obwohl seine öffentlich praktizierte homosexuelle Neigung schon vor etlichen Jahren die deutschen und internationalen Medien aufschäumen, ja übergären hatte lassen. Jahrzehntelang ritt van Boomerland – ein in den Niederlanden geborener, deutschsprachiger und bereits in den Siebzigern nach Hamburg übergesiedelter Absolvent der besten Schauspielschulen Europas – von einem Erfolg zum nächsten. Gegenwärtig konnte er sich die allerbesten und lukrativsten Rollen aussuchen, denn die Anbieter übertrafen sich gegenseitig. Sehr gern spielte er Charakterrollen, in denen er sich ausleben durfte, viel sprechen musste und sich gebärden konnte.
Jetzt aber saß der einhundertdreizehnfache Millionär auf der bequemen hinteren Sitzbank seines deutschen Wagens und betrachtete die Rückansicht Francescos. Der – Francesco selbst benutzte für seine Person den Artikel ›die‹ – zählte gerade einmal vierundzwanzig Lenze, wusste den alten Millionär mit ausgefeilten Methoden zu verführen und sorgte im heimischen Palast der acht Räume zählenden, die meisten Dächer Hamburgs überragenden Mansardenwohnung für eine himmlisch erotisierende Atmosphäre, die van Boomerland genoss und ihn fast jeden Stress vergessen ließ.
Die beiden hatten sich bei einem alltäglichen Casting kennengelernt. Damals war Francesco blutjung gewesen, gerade sechzehn Jahre alt, völlig unbedarft und dachte, die gekonnte, weil gewohnte schwule Masche würde jeden Produzenten augenblicklich überzeugen. Dem war jedoch nicht annähernd so. Wie ein kleines heulendes Mädchen, das beim Hickelkasten-Hüpfen gestürzt war und sich das Knie lädiert hatte, saß Francesco mutterseelenallein in der Maske, als van Boomerland auf der Suche nach einer Erfrischung das gebrochene Individuum vorfand, sich nach dessen Problemen erkundigte, aufbauende Worte versprühte, den mädchenhaften Jungen schließlich an sein uferlos geöffnetes Herz drückte, sich ausweinen ließ und schlussendlich zärtlich streichelte. Mag es auch schrecklich altmodisch klingen, der Schauspielstar fühlte bei der Begegnung mit dem vorpubertär wirkenden Francesco Liebe auf den ersten Blick.
Mittlerweile war Francesco im wahrsten Sinne des Wortes ein Mädchen für alles. Er bekochte, verführte und chauffierte seinen männlichen Schwarm und genoss dessen Reichtum und Fürsorge. Streit hatten die beiden nur selten. Und was Francescos Schauspielambitionen betraf, so brachte van Boomerland seinen Jüngling in so manch einer gut zahlenden Show unter, in der auf weibliche Grazilität eines männlichen Geschöpfes besonderer Wert gelegt wurde. Zudem war das junge, allzeit fröhliche Geschöpf fester Bestandteil der deutschen Modelszene geworden. Francesco war schmal, groß und selbstverständlich bis auf die gestylten Kopfhaare am gesamten Körper völlig haarlos. Er zeigte nur zu gern seine endlos langen, aalglatten Beine und den knackigen Popo. Scham kannte er nicht und ein auffälliges Sensibelchen war er über die Zeit geblieben, denn genau diese Eigenschaft Francescos liebte der stattliche Mann im Haus an seinem Mädchen. Nur dadurch konnte jener mit großem Heldenmut Beschützer eines zerbrechlichen Wesens sein – eine Rolle im wahren Leben, die ihn in seinen Filmen entzückt hätte. Dabei fühlte van Boomerland seine wahre Größe, eine andere als seine Körpergröße, denn die war mit fast zwei Metern ohnehin beachtlich. Es war die innere Größe, die ihn über sich hinauswachsen ließ.
Das Hamburger Wetter war wie so oft trüb. Francesco lenkte den Wagen, der ein Automatikgetriebe besaß, meist nur mit der rechten Hand sanft durch die Hansestadt, während er den Kopf mit der linken abzustützen schien, den Zeigefinger ausgestreckt an die Wange gelegt, so als würde er nachdenken. Ständig wechselten seine Blicke zwischen Straßenverkehr und Innenspiegel.
Im Wagen lief Musik. Schnulzen aus den Siebzigern, nicht zu laut und nicht zu leise.
»Endlich sind wir zu Hause.« Diese Worte ließ Francesco stets dann mit einem kleinen Seufzer erklingen, wenn sich das Rolltor zur Tiefgarage öffnete. Es klang so, als stiege der Butler des Millionärs bereits mit einem Fuß ins warme Duftschaumbad der drei Meter langen Badewanne mit Whirlpool-Funktion, dabei verschlingende Blicke auf den Körper seines geliebten Gönners richtend.
Vorsichtig betätigte das junge Wesen das Bremspedal, während der Wagen in die Tiefgarage hinabrollte. Es lenkte behutsam um äußerst enge Kurven, um schließlich in der deutlich markierten, angemieteten Parkzone seines Herrschers zu stoppen und den Motor des Fahrzeuges abzustellen.
Klaus van Boomerland holte tief Luft, als wäre gerade ein halsbrecherischer Dreh beendet worden, obwohl er sich, wenn auch nur die geringste Gefahr einer Verletzung bestand, doubeln ließ.
Nachdem Francesco ausgestiegen war, öffnete er sofort die hintere Tür des Wagens und reichte van Boomerland eine helfende Hand.
In eben diesem Moment spürte Francesco, dass sich hinter ihm etwas bewegte. Eine unbekannte, grobe Hand fuhr um seinen Kopf und drückte ihm einen stinkenden Lappen ins Gesicht.
Der schwitzende Millionär saß regungslos in seinem Wagen und sah mit Entsetzen den Niedergang seines Lieblings, der von den starken Armen einer fremden Person gedämpft wurde. Diese Person, deren Gesicht unter einer feinmaschigen Maske und deren athletischer Körper unter schwarzer Kleidung aus Lederimitat verborgen waren, lehnte den ohnmächtigen Francesco mit dem Rücken gegen das Fahrzeug, doch der Butler fiel zur Seite, als die Person ihn losließ.
»Was bitte soll das?« Welch eine mutige Frage, wie aus einem Drehbuch übernommen, aus dem Munde des am ganzen Körper zitternden Schauspielers!
Eine Pistole mit Schalldämpfer wurde auf van Boomerlands Kopf gerichtet. Die Antwort fiel weniger bühnenreif aus. »Schnauze halten und aussteigen!«, forderte eine tiefe, barsche Männerstimme, die den Millionär zittern und gehorchen ließ. »Befolgen Sie unsere Anweisungen, dann passiert Ihnen auch nichts, Herr van Boomerland!«
»Wollen Sie mich etwa entführen? Es gibt niemanden, den Sie erpressen könnten!«, gab van Boomerland, angesichts der bedrohlichen Situation sabbernd, von sich. Er stieg aus dem Wagen und schaute sich in der Tiefgarage um. Hier gab es viele düstere Ecken, wenig Licht und keine Menschenseele außer diesem obskuren Ninja-Kämpfer, dem bewegungsunfähigen Butler und ihm selbst. Der Schein trog allerdings, denn im gleichen Moment heulte ein starker Motor auf, ein schwarzer Mercedes Vito näherte sich und hielt mit lauten Reifengeräuschen unmittelbar neben dem Fahrzeug van Boomerlands – die im fahlen Schein der Garagenbeleuchtung funkelnden Sterne standen auf einer Höhe. Eine Schiebetür öffnete sich, zwei weitere schwarz gekleidete Gestalten sprangen heraus und näherten sich als lautlose Schatten. Der Millionär spürte einen Einstich am Hals, dem augenblicklich eine rasch um sich greifende Dunkelheit folgte.
Erst vier Stunden nach diesem Vorfall erwachte Francesco aus dem erzwungenen Tiefschlaf. Er hockte zunächst lange Zeit auf dem Boden und zerfloss in Tränen, bis endlich ein anderes Fahrzeug in die Tiefgarage fuhr, dessen Insassen nach dem Aussteigen von dem sterbenden Stimmchen des jungen Geschöpfes herbeigejammert wurden.
*
Sigrun Tamelroth verabschiedete sich von ihrem Vater. Das tat sie stets mit wenig Zärtlichkeit und in einer gewissen hochmütigen Art und Weise, die an Schneewittchens Stiefmutter erinnerte. Sie zählte gerade neunundzwanzig Lenze, erweckte aber einen wesentlich reiferen Eindruck. Damals, als sie das berühmte Licht der Welt erblickte, war der Vater bereits vierzig Jahre alt gewesen. Nun wohnte sie in München und war alleinstehend, denn für eine Beziehung blieb als Tochter eines Industriellen mit eigenem Konzern keine Zeit. Sie trug halblange, naturschwarze Haare, verfügte über eine modelverdächtige Figur, versuchte stets intelligent aufzutreten und besaß nach dem letzten Geschäftsjahresabschluss ein eigenes kleines Vermögen von 424,3 Millionen Euro.
»Bring bitte die aktuellen Umsatzzahlen deiner Firmen zur Gläubigerversammlung mit, Mädchen.« Der grauhaarige Sigurd Tamelroth, dessen Vermögen mehr als das Zehnfache des töchterlichen Besitzes betragen dürfte, gab ihr einen gut gemeinten, wenngleich flüchtigen Kuss auf die rechte Wange.
Dieser aber wurde rabiat weggewischt. Vorwurfsvoll kam die prompte Antwort. »Sicher, Papa. Die hätte ich glatt vergessen. Danke, dass du mich erinnerst.« Ein verbissenes Lächeln verunzierte sekundenlang das ungeschminkte Gesicht der hübschen Frau. Dieser Mann, der sich Vater nannte, hatte nach der Scheidung von Sigrun Tamelroths Mutter mit dem Einsatz eines kleinen Vermögens das alleinige Sorgerecht für das Töchterchen erstritten.
»Leb wohl, Vater«, raunte sie, ohne ihm in die Augen zu blicken.
»So, wie du das sagst, klingt es fast wie ein Abschied für immer.«
»Was ein Tag bringen wird, weiß man erst, wenn der Tag zu Ende geht.« Sie lächelte erneut verbissen.
Sigurd Tamelroth antwortete nicht auf diese Lebensweisheit. Er wandte sich einfach von ihr ab. Seine Tochter machte kehrt, schwang gekonnt die Handtasche und verschwand im gerade ankommenden Aufzug des modernen Büroriesen. Unten, im Foyer, klapperten ihre Absätze aufdringlich und ließen den einen oder anderen Angestellten in die Unsichtbarkeit flüchten.
»Meinen Wagen!«, rief sie im Tonfall eines Generals quer durch die Halle und schritt, ohne um sich zu schauen, mit erhobenem Haupt und wackelndem, in engen Jeans steckendem Hintern an den Männern vom Sicherheitsdienst vorbei. Durch die sich selbsttätig öffnende Glastür des Haupteingangs trat sie schwungvoll hinaus an die Münchner Innenstadtluft, so als erwarte sie, dass ihr Wagen bereits einstiegsbereit warten würde. Dieser musste jedoch erst aus der Tiefgarage geholt werden. Also steckte sie sich eine weiße Frauenzigarette zwischen die Lippen, gab sich selbst Feuer und rauchte ein wenig hastig.
»Du kannst alles haben, was du willst. Und doch versuchst du mit Hilfe von Lungenkrebs auf all die schönen Dinge zu verzichten«, würde ihr Vater jetzt sagen.
Ihre Mundwinkel zuckten verächtlich. All die schönen Dinge! Langweilige Versammlungen, ständiges Zur-Schaugestellt-werden, eintönige Betriebsbegehungen, Kostüm statt Jogginganzug und unfreiwilliger, stumpfsinniger Nachhilfeunterricht in Marketing-Strategien.
Der Benz kam angebraust. Sie schnippte die Zigarette in Richtung Asphalt, schenkte dem jungen Angestellten, der rasch bei laufendem Motor aus dem Auto flüchtete, keinerlei Beachtung, stieg ein, zog die Tür zu und jagte davon.
Sie hatte um einen eigenen Bürokomplex gekämpft, möglichst weit von der innerstädtischen Familienzentrale entfernt, und ihn am Rande der Landeshauptstadt erhalten.
Sigrun Tamelroth fuhr rasant, hupte oft und regte sich über jeden Nicht-Münchner auf, der die von ihr beanspruchten Straßen verstopfen half.
Die Leopoldstraße. Ein derber Tritt auf das Gaspedal ließ den Benz beschleunigen. Im letzten Moment sah Sigrun Tamelroth jedoch ein, dass diese Grünphase ungenutzt an ihr vorübergehen würde. Der Schalthebel wanderte auf Position N, die Fußkraft übertrug sich sofort auf die Bremsanlage und das elektronische Stabilitätsprogramm sorgte dafür, dass das Fahrzeug nicht ausbrach und einen Meter vor der Haltelinie zum Stehen kam, sodass der Ampelblitzer kein Foto auslöste. Das tat er allerdings kurz danach, denn ein Transporter vom gleichen Hersteller schob den Wagen der jungen Dame einen halben Meter in Richtung der Kreuzung. Wütend schlug die Frau auf das Lenkrad. Es war zwar nur ein sanfter Stups gewesen, doch Ärger war vorprogrammiert. Ihr Blick wanderte in den Rückspiegel. Das gegnerische schwarze Fahrzeug stand bedrohlich nah hinter dem ihrigen.
»Warum steigt denn keine Sau aus?«, fluchte sie, ohne das fremde Auto aus den Augen zu lassen. Überreizt gab sie sich einen Ruck, löste den Gurt, öffnete die Fahrertür und stieg aus. Ihr Wagen schien keine sichtbaren Schäden davongetragen zu haben. Ihr Blick wanderte zu jenem schwarzen Fahrzeug.
An dessen Steuer saß keiner!
»Hallo?« Noch klang ihre Stimme fest, wenngleich sie bereits ein wenig Unsicherheit verspürte. Sie lief hinter das fremde Fahrzeug. Irgendwo musste der Fahrer schließlich stecken. Nichts. Nun schaute Sigrun Tamelroth auf der Beifahrerseite des Unfallverursachers nach und fand deren Schiebetür geöffnet vor. Sie blickte sich um. Wie es der Zufall so wollte: Weit und breit waren keine Zeugen zu sehen!
Sie erschrak. Zwei von braunen Wildleder-Handschuhen gewärmte Hände griffen aus dem Inneren des Fahrzeuges nach ihr.
»Steig ein. Es ist soweit«, sagte die Stimme eines Mannes.
»Du hättest mich vorwarnen können«, erwiderte Sigrun Tamelroth und ließ sich in den Transporter helfen.
»Du wusstest doch, dass es heute geschehen würde.«
»Ich wusste aber nicht wie.«
Der Transporter setzte sich in Bewegung und erhöhte rasch die Geschwindigkeit.
*
Berlin, Bezirk Marzahn-Hellersdorf, vormittags, trübes Wetter, obwohl der Wetterdienst strahlenden Sonnenschein angekündigt hatte. Der eher zurückhaltend auftretende Bauunternehmer Franz Schneidmann schritt gemächlich die Baustelle ab. An seiner rechten Hand führte er einen achtjährigen Jungen, in der linken trug er eine altmodische Aktentasche. Bauleiter Sporing, dessen graue, wüste Haare unter dem gelb leuchtenden Helm hervorlugten, lief in Gummistiefeln mit großen Schritten nebenher und redete ununterbrochen.
»Sie haben mir glatt vierzig Mann weggenommen. Ganze Horden von Polizisten waren hier, meine Baustelle wurde komplett lahmgelegt. Ich …«
Schneidmann unterbrach seinen Bauleiter. »Ich hatte angewiesen, dass alle Arbeiter vor der Einstellung ganz genau überprüft werden!«
»Tut mir leid. Ich bin nicht die Personalabteilung«, rechtfertigte sich Sporing. »Die habe ich auch schon angerufen. Die feinen Leute dort sind der Meinung, alle Bauarbeiter wären absolut legal im Land.«
»Nun«, ein erzwungenes Lächeln erschien auf Schneidmanns Gesicht, »dann ist ja alles in bester Ordnung.«
Der Sohn zeigte auf einen riesigen Kran, der eigentlich ununterbrochen Baustoffe in die dritte Etage des Rohbaus eines Hauses für Sozialwohnungen heben sollte, doch bereits seit Stunden stillstand. »Papa, ist das dein Kran?«
»Ja, Villads. Das ist meiner.«
Schneidmann war gerade vierundvierzig Jahre alt geworden, als er erfahren hatte, dass es nach den drei halbwegs erwachsenen Kindern aus erster Ehe einen vierten Spross von seiner laufstegerfahrenen, neuen Gattin geben würde. Diese Ehe, die fast planlos dem eiskalten Winter einer unglaublich starken Midlife-Crisis gefolgt war. Jetzt, mit zweiundfünfzig Jahren, klebte sein jüngster Sohn an seiner Hand, weil sich dieser Tag zu einem typischen Magengeschwürtag entwickelt hatte. Was nutzten ihm einhundertzweiundzwanzig Millionen Euro Kapital, wenn die Frau wegen einer akuten Blinddarmreizung in der Nacht operiert werden musste, wenn der Junge einen schulfreien Tag hatte, weil die Lehrer auf Anordnung der Gewerkschaftsleitung streikten, und wenn ausgerechnet an diesem Tag scheinbar die gesamte Berliner Polizei nichts anderes zu tun hatte, als seiner wichtigsten Baustelle kurz nach Schichtbeginn das Personal zu rauben! Erfahrungsgemäß kehrten am folgenden Tag neunundneunzig Prozent der Polen und Südeuropäer zur Arbeit zurück. Dieser Tag aber war verloren. Und im Moment erhöhte der Senat den Zeit-und Preisdruck täglich! Die Flughafenhysterie griff um sich.
»Och, Papa, ist der riesig! Bestimmt ist der größer als der Fernsehturm. Darf ich da mal hoch?«
»Wissen Sie was, Sporing?« Schneidmann antwortete dem Kleinen nicht. Dafür dem Großen. »Absolut nichts ist in Ordnung! Nutzen Sie diesen beschissenen Tag, um mit dem verbliebenen Personal Ordnung auf der Baustelle herzustellen!«
»Beschissen!« Der Kleine zog aufgeregt an der Hand des Vaters. »Papa, du hast beschissen gesagt!«
Der Angesprochene schaute in das grienende Gesicht des Jungen, als würde er einen hässlichen Fußabdruck auf frisch poliertem Boden betrachten. »Ich habe beschissen gesagt, weil ich nämlich beschissen gemeint habe, Villads. Davon hast du keine Ahnung.«
»Na, so ein Mist.« Bauleiter Sporing griente ebenso wie der Junge. »Das war ja nur eine kleine pädagogische Entgleisung. Sie wird kaum Folgen haben.«
»Ihr Mist heißt Baustelle!«, fluchte Schneidmann grimmig und zog den Jungen mit sich. »Also kümmern Sie sich gefälligst um Ihren Mist und nicht darum, wie ich mit meinem Jungen rede.«
Villads schwieg lieber. Er benötigte zwei Schritte, um die Strecke von einem des Vaters zurückzulegen. Erst am Auto, einem schwarzen Volkswagen, wagte der Achtjährige den Mund wieder zu öffnen: »Und jetzt?«
Schneidmann fuhr dem Sohn über den Kopf. »Weißt du was? Nach beschissen kommt scheißegal. Wir beide pfeifen auf den ganzen Mist. Was ist, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Ich mach mein Handy aus und die verfluchten Behörden können mir den Buckel runterrutschen.«
Die Augen des Kindes strahlten. »Oh, ja, Papa! Ins Kino!«
So etwas gelang Franz Schneidmann tatsächlich: eine Flucht ins Niemandsland. Und das war keinesfalls seine erste Flucht. Die Mutter seiner anderen drei Kinder hatte diese Eigenheit nie verstehen wollen.
»Du kannst doch aber nicht einfach abtauchen«, hätte sie jetzt gesagt. »Du hast schließlich Verantwortung.«
Und er hätte geantwortet: »Und ob ich das kann. Irgendwo bin ich auch ein Mensch und nicht nur Sklave der glorreich sozialen, anpissenden und ausnutzenden Marktwirtschaft. Glorreich sozial ist die Marktwirtschaft für die meisten Beamten, die Unternehmer werden angepisst und die Arbeiter ausgenutzt.« So referierte ein Multimillionär im Familien- und Freundeskreis über die Wirtschaft.
»Schnall dich an, Spatz.« Schneidmann hatte dem Sohn in den Wagen geholfen und warf nun die hintere Tür zu. Auf dem kurzen Weg zur Fahrertür vernahm er eine garstig klingende Stimme.
»Ähm, Herr Schneidmann?«
Mit ungutem Gefühl und kaltem Blick schaute der Bauunternehmer auf. Eine fremde Person in grauem Anzug, mit Krawatte und weißem Hemd? Wollte man ihm nun auch noch den Kinobesuch mit dem Kleinen verderben? Schon stand der Mann unmittelbar vor ihm.
»Guten Tag, Herr Schneidmann.« Er zeigte flüchtig einen Ausweis vor. »Selig, Bauaufsichtsbehörde. Wir müssen Sie kurz sprechen. Können Sie bitte mitkommen, unser Fahrzeug steht dort.« Er wies auf einen schwarzen Mercedes Vito, der auf der anderen Straßenseite parkte.
Eine ihm bestens bekannte Empfindung, hervorgerufen durch die Einsicht, dass er mit solchen Leuten unbedingt kooperieren musste, breitete sich von Brechreiz begleitet in Schneidmanns Magen aus. Kurzzeitig öffnete er die hintere Tür. »Mach keinen Blödsinn, Spatz, ich bin gleich zurück.« Dann folgte er arglos diesem Selig von der Bauaufsichtsbehörde, während der Kleine seinem Vater enttäuscht nachblickte, bis dieser hinter dem großen schwarzen Auto verschwunden war.
»Es geht um die Gerüste.« Selig stand an der geöffneten Schiebetür und breitete auf dem Wagenboden einen Plan aus. Dann bat er den Bauunternehmer heranzutreten.
»Das ist ein Stadtplan von Berlin. Was soll das?«, fragte dieser.
»Nichts«, bekam er zur Antwort. Der vermeintliche Behördenmitarbeiter ergriff Schneidmanns Handgelenke und bog die Arme auf dessen Rücken, während eine dunkle Gestalt aus dem Fahrzeuginneren dem Unternehmer die Kanüle einer Spritze in die linke Schulter rammte. Schneidmann wurde in das Fahrzeug gestoßen, Selig stieg rasch auf der Beifahrerseite ein, die Seitentür fiel ins Schloss.
Erstaunt beobachtete Villads, dass jenes große schwarze Fahrzeug ganz plötzlich davonfuhr. Von seinem Vater fehlte jede Spur. Lange saß der Junge wartend auf dem Rücksitz und beobachtete die Dreckwolke, die sich allmählich senkte. Er schluchzte, ohne tatsächlich zu weinen. Irgendwann näherte sich Bauleiter Sporing, den Villads an den Stiefeln erkannte. Der Achtjährige öffnete hastig den Sicherheitsgurt und anschließend die schwere Fahrzeugtür.
»Haben Sie vielleicht meinen Papa gesehen?« Nun aber standen Tränen in seinen Augen.
*
»Es sind viel zu wenig Medien da!« Theodor Fack blickte nervös um sich. »Warum nur sind keine Medien da?« Sein schwäbischer Dialekt verriet unanzweifelbar seine Herkunft. »Da tut man nun was dafür, das Leben in dieser Migranten-Einöde zu verbessern und die Medien scheren sich einen Dreck darum!« Er blickte hilfesuchend zu seiner blutjungen Marketingchefin.
»Vielleicht kommen sie ja noch«, antwortete seine auf zweiundzwanzig Zentimeter hohen Absätzen stehende und einen schrillen Minirock tragende Angestellte.
In Facks Ohren klang diese Antwort jedoch wie: »Heute kommt bestimmt keiner mehr.« Wie schauderhaft! Theodor Fack, Sohn von Franz-Ferdinand Fack, einem der weltweit größten Einzelhändler, wollte sich auf Titelblättern wiederfinden. Stattdessen wurde er von unzähligen türkischen, ein Kopftuch tragenden Frauen angestarrt, die darauf warteten, dass er endlich den Billigladen in einem heruntergekommenen Stadtteil mit Plattenbauten jenseits des Neckars eröffnen würde. Immerhin lockten die abermals preisgesenkten Eröffnungsangebote.
Fack war achtunddreißig Jahre alt, wirkte jedoch älter, und ein Lebemann. Er zeigte sich gern mit mehreren Models an der Seite in der Öffentlichkeit. Als ungeschickter Golfspieler betrieb er diesen Sport nur, um sich auf exquisiten Golfplätzen zeigen zu können. Zu seinem Konzern zählte die Ladenkette b&s – eine Abkürzung für billig und super –, die ihm wider Erwarten täglich ausreichend Geld in die offenen Taschen spülte. Das Vermögen von Theodor Fack wurde jüngst auf sage und schreibe 3,6 Milliarden Euro geschätzt. Es war sprunghaft angestiegen, weil Franz-Ferdinand seinen einzigen Sohn als Alleinerben eingesetzt hatte, bevor er kürzlich in einem Flugzeug zum wiederholten Male einen Herzinfarkt erlitt und nach der Landung in Stuttgart trotz aller Mühen des medizinischen Personals nicht wiederbelebt werden konnte. Fack hasste feste Beziehungen, er hasste die Vorstellung, eigene Kinder erziehen zu müssen, und er hasste die Medien.
Energisch winkte er den Privatfotografen zu sich. »Sie werden die Redaktionen in ganz Baden-Württemberg mit Fotos und Berichten überschwemmen!«, befahl er. Und an seine Marketingchefin gewandt stellte er die Frage: »Sehe ich gut aus?«
Sie zupfte ein wenig an ihm herum und nickte dann heftig. »Supergut.«
»Dann los! Bringen wir es hinter uns. Wo ist die Schere?« Eilig schritt Fack zum Portal der neuen b&s-Filiale. Ein Firmenmitarbeiter reichte ihm auf dem Weg dorthin eine überdimensional große Schere. Der Fotograf schoss bereits ein Foto nach dem anderen. Hinter dem blau-roten Absperrband warteten drei eigens für den heutigen Tag georderte, junge, gut aussehende Verkäuferinnen. Sie trugen blau-rote b&s-Verkaufskittel, welche die Blicke auf ihre Dekolletés nicht beeinträchtigten.
»Dann wollen wir mal.« Fack hielt die Schere hoch, jemand brachte ihm ein Mikrofon. Er schob sich zwischen seine Marketingchefin und die drei Verkäuferinnen, sodass zwei von ihnen dicht neben ihm stehen mussten, und verzog das Gesicht zu einer heftig grinsenden Grimasse. Die vier Mädchen eiferten ihm nach und im Publikum machte sich Unruhe breit.
Facks Stimme schallte über den Vorplatz: »Ich eröffne hiermit die dreihundertsiebenundzwanzigste Filiale von b&s – dem besten und billigsten Discounter in ganz Europa!« Anschließend versuchte er, mit der Schere das Band zu teilen, was ihm aber erst beim zweiten Versuch gelang. Die drei Auf-Zeit-Verkäuferinnen ließen die Enden des Bandes, das sie bislang hochgehalten hatten, los und traten zur Seite, während der Milliardär fast von der einkaufswütigen Menge überrannt wurde.
Zwei Personenschützer kämpften sich durch die Menge, ergriffen den etwas hilflos dastehenden Fack an den Schultern und führten ihn mit beruhigenden Worten zu einem Fahrzeug. »Steigen Sie bitte ein, Herr Fack, wir bringen Sie gesund hier raus.«
Eine Sekunde lang feixte der ambitionierte Kaufmann. »Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchem Enthusiasmus die Leute ihr Geld zu mir bringen.«
Der Riese vom Personenschutz nickte, ohne zu lächeln, und schob Fack in den schwarzen Mercedes-Van. »Setzen Sie sich.« Er drückte den Milliardär auf die Sitzbank und zog die Schiebetür von innen zu.
Einen Moment lang glaubte Theodor Fack zu träumen. Neben ihm befanden sich zwei weitere Männer vom Personenschutz. Allerdings geknebelt und ohnmächtig. Dann fühlte er einen derben Stich im Hals und wandelte kurz darauf ebenso im Traumland.
»Der Fack hat’s aber eilig wegzukommen«, stellte die Marketingchefin fest, während der Vito rasch den Parkplatz der Filiale verließ. Sie schaute skeptisch drein, denn sie hatte von diesem Tag wohl etwas mehr erwartet.
*
Hannes Gartenleitner hatte vor zwei Jahren in zunehmendem Maße an einer akuten Niereninsuffizienz gelitten. Zwei Monate wartete er vergeblich auf Spendernieren, dann nahm er das Heft des Handelns selbst in die Hand. In Brasilien wurde er fündig. Während das Land bereits im Fußballfieber versank, wurden ihm in einem großen privaten Hospital gleich zwei Nieren erfolgreich transplantiert. Er hielt nichts von den Gerüchten, die besagten, dass man die Nieren jungen Menschen gestohlen hatte, die zuvor in den Favelas in belanglose Unfälle verwickelt worden waren, um sich in die Obhut eines Krankenhauses begeben zu müssen, und die im Laufe der Behandlung dann tragisch und unerkannt verstarben. Für ihn war dies nur das Geschwätz jener Leute, die Brasilien alles Positive abzusprechen versuchten. Außerdem hatte er ein Vermögen dafür geopfert, wenngleich in Gartenleitners Maßstäben nur ein kleines Vermögen.
Der sechsundvierzigjährige Software-Entwickler würde mehr als siebenhundertvierzig Millionen Euro auf seinen Konten vorfinden können. Den größten Teil seiner Einnahmen erbrachte die in seiner Spieleschmiede in Kassel entwickelte Software »Dragonblaze«, ein Online-Rollenspiel, das sich weltweit millionenfach verkauft hatte. Er selbst lebte in beinahe bescheidenen Verhältnissen am Rande der Stadt Kassel. Dort teilte er sich eine Eigentumswohnung mit einer Fläche von vierhundertzehn Quadratmetern mit seiner Frau und der bereits volljährigen Tochter.
Es war so eine Situation, wie sie sich in den letzten Monaten ständig zu wiederholen drohte. Die dreiundvierzigjährige Marion Braun-Gartenleitner, Chefin der Werbeabteilung einer recht bekannten Zeitschrift und zudem nicht selten als Frauenrechtlerin in Erscheinung tretend, verfiel in einen nicht enden wollenden Streit mit ihrer Tochter. Emilia, eine lustlose BWL-Studentin, lebte nur zu gern in den Tag hinein und bat meistens freitags – in Abwesenheit der Mutter – den Vater um Taschengeld-Nachschub, um spätestens am Freitagabend und möglichst während des gesamten Wochenendes das Leben mit Freundinnen und Freunden zu genießen.
Gartenleitner zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um dem Kreischen der Frauen zu entfliehen. Er schaltete eine über seinen Computer gesteuerte Soundanlage ein. Bei Dire Straits gelang es ihm kurzzeitig, sich zu beruhigen. Das Brummen des Telefons holte den gestressten Mann in die Gegenwart zurück. Nach einigen Tastengriffen sah er das Kamerabild seines Stellvertreters Knut Simon auf dem Monitor, bereit zum Skypen.
»Was ist los, Knut?«
Simon kratzte sich im Vollbart, ein sicheres Zeichen, dass er außergewöhnlich stark erregt war. »Ein Typ von SV hat hier angerufen. Er will dich sprechen. Dich ganz allein.«
Ein Lächeln huschte über Gartenleitners Gesicht. »Hat die Science Vision tatsächlich angebissen?« Science Vision – ein börsennotiertes, weltweites Unternehmen, das in erster Linie Online-Games multilingual und per Lizenz verwaltete! Dollarzeichen glänzten in Gartenleitners graublauen Pupillen. »Hat der Typ schon was angedeutet?«
»Kein Wort. Du sollst pünktlich fünfzehn Uhr vor dem Schlosscafé Wilhelmshöhe stehen. Alles klang ziemlich geheimnisvoll.«
»So sind die nun mal.« Ein unterdrückter Jauchzer entfuhr Gartenleitner. Er warf einen Blick auf die Uhr seines Computers. »Das ist in einer Stunde. Weißt du, was das heißt, Knut?«
»Viel Knete, hoffe ich. Wenn wir denen eine Lizenz für ›Dragonblaze‹ verkaufen …«
»… dann können wir uns getrost zur Ruhe setzen«, beendete der Software-Entwickler den Satz seines Mitarbeiters. »Endgültig!« Er war bereits aufgestanden, nahm ein Jackett von der Stuhllehne und schlüpfte hinein. »Okay, ich muss los. Ich melde mich bei dir.«
»Aber nur mit positiven Nachrichten, Hannes.«
Der Rechner fuhr herunter, während Gartenleitner den Inhalt seiner Laptoptasche prüfte, dann diese über die linke Schulter hängte und das Arbeitszimmer verließ.
Das Kreischen im Nebenzimmer war noch in vollem Gange, hatte sich gar gesteigert. Auf der Innentreppe blieb der Programmierer stehen, um kurz zu überlegen, ob er einen Abschiedsgruß brüllen sollte, ließ es dann jedoch bleiben und verließ das Haus.
Achtundvierzig Minuten später fuhr er auf den fast leeren Parkplatz vor dem Schlosscafé, schnappte sich die Tasche und lief die wenigen Meter zurück zur Landstraße.
›Warum so geheimnisvoll?‹, hätte er denken müssen. Doch soweit dachte er nicht. Er fühlte sich in die eigene Kindheit zurückversetzt, in jene Zeit, als er von einem Fuß auf den anderen tretend, erwartungsvoll und mit weichen Knien vor der Weihnachtsstube stand. ›Heute ist endlich Bescherung‹, dachte er stattdessen. Mühevolle Wochen des Anbiederns und Einschmeichelns lagen hinter ihm. Nun endlich sollten die Früchte seiner Arbeit geerntet werden. Branchenüblich waren zweihundertfünfzig Millionen Euro Gewinn im Rahmen des Möglichen. Freilich, mehr als die Hälfte würde sich der Staat holen, doch übrig blieb genug.
Gartenleitner schob die Sonnenbrille hoch und blickte die Straße hinunter. Erstaunlicherweise war sie wenig befahren. Ruhe herrschte. Ein Motorengeräusch näherte sich und mit ihm ein schwarzer Van. Das mussten sie sein! Der Puls des Programmierers erhöhte sich.
Das Fahrzeug hielt unmittelbar neben ihm, die Seitentür öffnete sich. »Wollen Sie viel Geld verdienen?« Die fragende Stimme wartete nicht auf eine Antwort. »Dann steigen Sie ein, Herr Gartenleitner.«
*
»Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an« … Das schien das Lebensmotto von Frau Dr. Carola Blauschner zu sein. Sie lebte seit wenigen Jahren in einem eingemeindeten Vorort der sächsischen Hauptstadt Dresden, war seit drei Jahren verwitwet und empfing fast wöchentlich überwiegend familiären Besuch in ihrer Villa, die – obwohl modern saniert – einen barocken Eindruck erweckte. Nahezu immer war eine der Familien ihrer vier Kinder zugegen. Die Nachkommen hatten ihr insgesamt elf Enkel geschenkt, von denen einige bereits ans Erwachsenenalter anklopften. Die Blauschner genoss die Gegenwart junger Menschen. Und einer der Gründe, warum sie dies tat, bestand darin, dass ihr verblichener Gatte vor vielen Jahren mit ihr gemeinsam einen Altenpflegering gegründet hatte. Als Dr. Blauschner noch berufstätig war, kam sie unablässig mit dem Elend des Altwerdens, das bekanntlich nur einen kleinen Schritt vom Tod entfernt ist, in Berührung. Nun erst, da sie sich als grauhaarige alte Dame im Spiegel sah, begriff die studierte Allgemeinmedizinerin, dass auch ihr das unvermeidliche Schicksal drohte, dem unzählige ihrer Berufsgenossen bereits anheimgefallen waren. Deren Nachkommen hatten schlussendlich für die Wertsteigerung des deutschlandweiten Altenpflegerings gesorgt, sodass selbst der übereilte Verkauf des Geschäftes dafür Sorge trug, dass sich das Vermögen der Ärztin zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mit fast einundneunzig Millionen Euro beziffern ließ. Sie widmete sich der Kunst, schrieb mehrere literarisch wenig anspruchsvolle Bücher und versuchte, in der Königsstadt und Elbmetropole anerkannt zu werden. Klappte das nicht wie geplant, dann erkaufte sie sich die gewünschte Beachtung.
Dr. Carola Blauschner prüfte zum wiederholten Male den Sitz des Kleides, das als Einzelstück von einem teuren Schneider in ihrer Geburtsstadt Bremen gefertigt worden war, dann betrat sie die Galerie in der Dresdener Neustadt, saugte die Atmosphäre der Ausstellung in sich auf und begann zu lächeln.
Der uralte Kunstprofessor Morgenstern kam mit weit geöffneten Armen auf die Gönnerin zu. Ein Charmeur, der seinesgleichen suchte! »Nu, meine Liebste, Sie sehen so jung und frech aus. Ich bin entzückt.«
»Das sollten Sie auch sein, diese Galerie hat mich ein kleines Vermögen gekostet.« Die Blauschner nahm das Sektglas entgegen, welches der Professor von einem Tablett entwendet hatte, und nippte daran. »Und, wie läuft es?«
»Nu, wunderbar.« Eine andere Antwort war nicht zu erwarten gewesen. »Wenn man bedenkt, dass die meisten erst am Abend hereinschneien werden.« Morgenstern stellte sich auf Zehenspitzen, sodass sich seine Lippen dem linken Ohr der Sponsorin nähern konnten. »Da ist ein Herr, der seit einer halben Stunde eines Ihrer Bilder betrachtet. Vielleicht sollten Sie …«
»Denken Sie an meine Beachtung oder an Ihr Honorar, Herr Professor?« Verschmitzt lächelte die Blauschner.
»Nu – ganz ehrlich gesagt – natürlich an beides, meine Liebste.«
»Sie sind mir vielleicht einer …« Sie lief leichtfüßig, als würde sie schweben, durch die kleinen Räume der Galerie und näherte sich den eigenen fünf Werken, die einen der Räume füllten.
Tatsächlich! Da stand ein schätzungsweise vierzigjähriger Herr, bekleidet mit einem schwarzen Anzug, einem rosafarbenen Seidenhemd und einem reinweißen, korrekt gebändigten Binder. Er betrachtete durch die Gläser einer modernen Brille hindurch das Bild »Elbtalwärts«, das achtzig mal fünfundsechzig Zentimeter maß und, umfasst von einem schneeweißen Passepartout, in einem massiven Holzbilderrahmen mit feinem Profil verweilte. Sein Schnauzer zuckte etwas, er bewegte den Kopf leicht, als wollte er das volle Haar nach hinten gleiten lassen.
Morgenstern hüstelte und sprach recht laut: »Nu, dann will ich mich mal um die anderen Gäste kümmern, liebste Frau Dr. Blauschner.« Und schon war er verschwunden.
Der Kunstliebhaber – um einen solchen musste es sich zweifellos handeln – schaute sich fast etwas erschrocken um. Er blickte über die Gläser der Brille hinweg und äußerte nur: »Nein.«
»Nein?«, fragte die Blauschner und errötete.
Nun lächelte der Mann. »Sie sind die Künstlerin?«
Die Blauschner lächelte ebenfalls und nickte, worauf er sich wieder dem Bild zuwandte. »Sie haben im Elbbogen gestanden, als Sie das Bild malten. Nicht wahr?«
»So ist es. Wobei, ganz ehrlich gesagt, die meiste Zeit habe ich gesessen.«
Er schaute unablässig auf das Bild. »Ich habe die Stelle sofort wiedererkannt. Hier bin ich aufgewachsen. Ich lief oft von zu Hause weg, für ein paar Stunden nur, verstehen Sie, und ich war stets genau hier.« Er zeigte auf einen Punkt des Gemäldes, unweit des filigran gemalten Ufers. »Eben dort habe ich gesessen.«
»Was haben Sie dort getan?«
Der Mann rückte nachdenklich die Brille auf der Nase zurecht. »Nachgedacht, philosophiert, gelesen, gelauscht, beobachtet.« Er nickte dem Bild zu. »Eben all die Dinge, die man tut, wenn man jung ist und an einem solchen Ort verweilt. – Ist dieses Werk käuflich zu erwerben?«
Sie genoss den Hauch von Ruhm, das bisschen Aufmerksamkeit dieses fremden Herrn, der ihr längst nicht mehr so fremd vorkam. Trotzdem antwortete sie nur: »Vielleicht.«
»Wie wäre es«, er zierte sich nicht lange, »wenn wir nebenan im Café die Modalitäten besprechen? Ich lade Sie herzlich ein.«
Die Blauschner schaute sich unbeholfen um.
Er lächelte erneut. Ein verzauberndes Lächeln! »Ihre Kunstwerke werden nicht davonlaufen.«
Überzeugt stimmte sie zu. »In Ordnung.«
Wenige Minuten später saßen die beiden an einem kleinen Korbtisch im straßenseitigen Bereich des Boulevard-Cafés, eine große Tasse Kaffee vor sich.
»Wollen Sie Milch und Zucker?«, fragte er.
»Viel Milch bitte«, antwortete sie schmunzelnd. Tatsächlich war ihr plötzlich der Gedanke gekommen, dieser deutlich jüngere Mann hätte den Versuch gestartet, ihr den Hof zu machen. Das Schmunzeln galt den eigenen Gedanken.
Der nette Herr goss die Milch in ihren Kaffee, wobei unbemerkt etwas pulverige Substanz in die Tasse gelangte. »Darf ich?« Er nahm ihren Löffel und rührte sanft um, dann schob er das Getränk zu ihr hinüber.
»Was tun Sie beruflich?«
»Was glauben Sie denn, was ich tue?«
Sie betrachtete seine Hände und nahm einige Schlucke ihres Kaffees. »Jedenfalls sind Sie kein Handwerker.«
»Das haben Sie gut erkannt.« Er lächelte und trank ebenfalls. »Ich bin beim Fernsehen.«
»Oh.« Eine kurze Pause folgte. »Beim Fernsehen?«
»So ist es. Ich denke mir Dinge aus, die die Quoten erhöhen sollen.«
Keck fragte sie nach: »Gute Sendungen oder auch solche, die verblöden?« Kaum waren die Worte verklungen, hielt sich Dr. Carola Blauschner eine Hand vor den gähnenden Mund.
»Sowohl als auch. Entscheidend sind die Einschaltquoten. Würden Sendungen – Sie sagten so schön treffend –, die verblöden, nicht angeschaut werden, dann würde man sie nicht produzieren.«
Die Ärztin widmete sich abermals ihrer Kaffeetasse, denn sie fühlte sich plötzlich sehr müde. »Damit haben Sie wahrscheinlich recht.« Normalerweise sorgte Koffein für Munterkeit. Doch heute schien alles anders zu sein.
»Würden Sie denn gern in einer großen Show auftreten?« Der Mann hatte die Frage in vollem Ernst gestellt. »Wahrscheinlich wären Sie ein guter Kandidat, wenn es nicht gerade um sportliche Höchstleistungen geht.«
Sie lachte übertrieben. Ihre Augenlider schlossen sich für mehrere Momente, dann blinzelte sie und wollte die rechte Hand zur Kaffeetasse bewegen, doch die gehorchte ihr nicht. Ihr Lachen verebbte so schnell, wie es gekommen war. »Was …?«
Er stand auf, ging zu ihrem Platz und hielt die Rentnerin fest, damit sie nicht vom Korbstuhl fallen konnte. Sein Blick wanderte über den Gehweg der vielbefahrenen Straße. Sein kurzes Nicken galt einem jüngeren Mann, der eine Kapuzenjacke und eine Sonnenbrille trug. Dieser näherte sich einen Rollstuhl schiebend und fuhr geschickt neben den Platz der Ärztin. Er hob sie in Sekundenschnelle in den Rollstuhl, schnallte sie fest und drückte ihren Kopf gegen eine Kopflehne, während der vermeintliche Kunstliebhaber ihr eine große Sonnenbrille aufsetzte.
Kurze Zeit später war der junge Mann mit dem Rollstuhl verschwunden. Der andere winkte die Bedienung heran, gab ihr einen Zehn-Euro-Schein, sagte Zähne zeigend »Thank you« und verließ das Café. Als er in den zwei Kreuzungen weiter geparkten schwarzen Mercedes Vito stieg, wies sein Gesicht weder Schnauzer noch Brille auf, der Kopf ließ die Haare vermissen.
Weitere dreißig Minuten später trat der alte Morgenstern aus der Galerie ins Freie, schaute sich lange um und ging schließlich kopfschüttelnd wieder hinein.