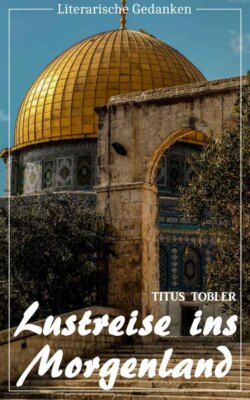Читать книгу Lustreise ins Morgenland (Titus Tobler) (Literarische Gedanken Edition) - Titus Tobler - Страница 6
Fahrt nach Alexandrien.
ОглавлениеLage.
Die Stadt Alexanders (Skanderun) liegt auf einer Landzunge, die in der Richtung gegen Nordwest ins Meer sich verliert. Die Spitze verläuft in einen Lappen, der sich südwestlich umbiegt, und in einen Faden, der sich in entgegengesetzter Richtung bis zu einer kleinen Festung ausdehnt. Hier, an der Stelle dieses Vertheidigungswerkes, soll einst der Pharus gestanden haben. Der westliche Zungenrand begränzt den alten Hafen und der östliche den neuen, welcher letztere indeß wegen seiner Untiefe, durch die gränzenlose Nachlässigkeit der jetzigen Beherrscher Egyptens, sehr wenig belebt ist, immerhin aber sich sehr hübsch herausstellt. Auf der Wurzel der Zunge hatte sich das alte Alexandrien ausgebreitet, und dieselbe ist jetzt nur wenig angebaut. Dagegen strotzt es gleichsam von Ruinen, sobald man den Schutt weghebt. Die schönsten Marmorsäulen sind von diesem bedeckt, und eben grub man eine hervor. Unlängst zog man auch ziemlich viel Goldmünzen heraus.
Man kann heutzutage nicht mehr behaupten, daß die Stadt landwärts von einer Wüste umgeben sei. Gegen Mittag schließen sich schöne Gärten an, woraus die Dattelpalme den neu angekommenen Europäer dem Afrikaner willkommen heißt. Der am nördlichen Ufer des Mareotis angelegte Garten des Ibrahim-Pascha verdient vor andern Lob. In der Nähe desselben übernimmt ein Strich angebauten Landes die versöhnende Rolle zwischen dem üppigen Garten und dem kahlen Sandmeere der Sahara. Der Mareotissee selbst, mit seinen wenig aufragenden, wüsten, gelbsandigen Ufern, sieht eher einem Sumpfe gleich, und gewährt daher keinen angenehmen Anblick.
Gebäude.
Die Moscheen sind meistens häßlich; die Minarets oder Thürme steigen nicht hoch empor. Beide weiß, überkalkt, ohne Schmuck, ohne ein Bild, mit dem Gepräge des Zerfalles. Antike Säulen tragen hie und da den Söller (Decke) des Tempels oder den Thurm. Der Zerstörungswuth, die vor Zeiten den Ton angegeben hatte, entgingen doch zum Theile die Säulen, und als brauchbare Baustoffe trifft man sie auch an andern Gebäuden. Indeß liegen Säulenstücke noch müßig herum. Eine einzige Moschee erspähete ich, die man schön nennen darf.
Der Sommerpalast des Vizekönigs liegt auf dem bezeichneten Zungenlappen (Ras-el-tin), vortheilhaft für das Auge. Auf der Morgenseite trat ich durch ein bewachtes Thor der Umfangsmauer, und ich gelangte auf einen schönen, geräumigen Platz. Mit gespanntem Gemüthe richtete ich meinen Blick umher, rechts auf das einstöckige, statt der Glasfenster — mit hölzernem Gitterwerke versehene Harem, links auf den Palast des Pascha, der, ebenfalls nur ein Geschoß hoch, in einen Giebel sich aufdachet. Das Wohn- oder Audienzzimmer des Vizekönigs schaut gegen den Hof oder gegen Mitternacht. Diese Lage erklärt sich leicht, da unter einem so heißen Himmel die Sonne geflohen und der Schatten gesucht wird. Den Eingang in den Palast bildet eine Halle, welche schöner, weißer Marmor auskleidet. Hier immerwährender Schatten, angenehme Kühlung. Da sieht man Höflinge in ihren orientalischen Prachtgewändern ein- und ausgehen, um nicht zu sagen, ein- und ausschlendern. Die Hoflakaien warten ihrer Herren. Stolze Hengste stehen an einer Reihe gesattelt in Bereitschaft. Das Roß des Pascha, mit nicht sehr ausgezeichnetem Schmucke, wird vom Sattel nie befreit, auf daß es immer gerüstet sei, seinen Herrn von hinnen zu tragen.
Ich sah eben eine Truppe Araber in ihren mitunter schmutzigen Mänteln einherschreiten, denen man zwar Fassung genug, aber doch so viel ansah, daß sie sich zu einer Vorstellung vorbereiteten, indem sie die Mäntel etwas zurecht legten und ihre Köpfe zusammensteckten. Die Truppe zog festen und weidlichen Schrittes die breite Marmorstiege hinauf. Als sie vor dem Pascha erschien, erblickte ich diesen vom Hofe aus; denn das Fenster war offen. Mehemet-Ali imponirte durch seine Haltung, trug eine rothe Mütze, einen auf die Brust herabwallenden, dichten, grauen Bart, und hatte das schöne Aussehen eines muntern Greises. Ich schaute neugierig hinauf, und keine Seele hinderte mich daran. Man sagte mir später, daß ich hätte hinaufgehen und an der Thüre des Audienzzimmers zusehen dürfen. Solche Dinge geschehen im Morgenlande weniger geheim, als in Europa. Freilich darf man nicht unberücksichtiget lassen, daß die physische Kälte die Europäer so oft zum Schließen der Fenster und Thüren nöthiget. Die Leibwache des Pascha ist mit blauem Tuche, einer rothen Mütze und mit gelben, plumpen Schuhen bekleidet. Ein Wachposten kam aus dem Palaste, die Füße ungleich bewegend, die Schuhe gleichsam nachschleppend, lachend, beinahe spielend. Bei aller Leichtigkeit des Karakters fällt es dem französischen Militär doch nie ein, am Posten oder unterwegs von einem Posten zum andern Spaß zu treiben. Selbst unsere Knaben von acht bis vierzehn Jahren benehmen sich ernster, wenn sie sich in den Waffen üben.
Die Häuser sind von dreierlei Art: europäische, türkisch-egyptische und die Hütten.
Die europäischen Häuser liegen im Frankenviertel. Ein Theil derselben hat flache Dächer oder Söller. Ibrahim-Pascha ließ ansehnliche aufbauen — um einen sehr geräumigen Platz. Ibrahim (Abraham) thut wirklich zur Verschönerung und Belebung der Stadt sehr viel, wobei er durch Beziehung schwerer Hauszinse seine Rechnung recht gut findet. Die Konsulatsgebäude stehen nahe beisammen. Hoch über ihren Dächern flattern die Flaggen, welche dem Abendländer einen sehr wohlthuenden Anblick gewähren, und ihm gleichsam Schutz und Sicherheit zulispeln. Wenn ein Schutzempfohlener stirbt, so wird eine besondere Flagge, doch minder hoch gehißt. Den Söller der hohen fränkischen Häuser heißt man Terrasse, auf der man sich angenehm aufhält. Von derselben erhebt sich ein offenes Thürmchen, Belvedere genannt, und mit Recht, da man darauf eine schöne Aussicht genießt. Man kann auf einem Thürmchen die ganze Stadt und die Häfen übersehen. Die Flachheit der Dächer beklagen manche Europäer. Während der Regenzeit dringt durch das Deck Wasser, welches das Wohnen nicht weniger unangenehm, als ungesund macht.
Man will behaupten, daß der Regen, welcher im Winter tageweise und in starken Güssen anhalte, in Alexandrien von Jahr zu Jahr häufiger falle, und man schreibt dieß den im Weichbilde angepflanzten Bäumen zu. In der That ist der Regen in Mexiko seltener geworden, seit der in seiner Nähe belegene Wald ausgehauen ist. Die Franken scheinen sich zu überzeugen, daß geneigte Dächer zum Bedürfnisse gehören, und während meiner Anwesenheit zog man einen Kanal durch die Frankengasse, um das Regenwasser abzuführen. Weil ohnehin in der Stadt keine Gasse gepflastert ist, so wird der Schmutz, bei starkem Regen, tief und lästig. Ich vermuthe aber, daß man von rascher Abänderung des Klima und vom jährlich zuwachsenden Regen ein wenig träume, wie denn auch die Vorstellung von der sengenden Gluth der egyptischen Sonne bei Manchen übertrieben sein mag. Ich könnte den Doktor Prosper Alpinus, der vor zwei Jahrhunderten Egypten bereiset hat, zum Zeugen anrufen. Er bemerkt, daß in einem Theile dieses Landes, wie in Kairo, der Regen eine seltene Erscheinung sei, wogegen es an der Meeresküste, in Alexandrien und Damiat, oft und sehr stark regne. Wenn auch, vor Christo, Pomponius Mela das wahrscheinlich viel baumreichere Egypten ein regenloses Land („terra expers imbrium“) nennt, so darf man wohl immerhin nicht glauben, daß dieß zur Zeit des Autors durchhin wahr sein mochte, sondern vielmehr, daß er die Regenlosigkeit auf einzelne Gegenden bezogen, und diese für das Ganze genommen hat.
Mischten die Egypzier sich nicht in das Schauspiel, wenn man in das am neuen Hafen liegende Frankenquartier kommt, man würde gerne läugnen, daß man den Boden Afrikas unter den Füßen hätte, so sehr ist Alles über den europäischen Leisten geschlagen. Laden an Laden, Kaffeehäuser und zwei Wirthshäuser sorgen für die Bequemlichkeiten der Europäer. Alexandrien ist halb europäisch, halb afrikanisch, und darum erscheint es dem europäischen Ankömmlinge eben so freundlich, als merkwürdig.
Die türkischen Häuser, in der Regel ziemlich niedrig, haben gegen die Gasse einen großen Vorsprung oder Erker, worin man zu faulenzen pflegt; die Fenster werden meist von einem niedlich gearbeiteten engen Holzgitter versehen. Solches kann unter einem milden Himmel gut angehen; allein es dürften nur Kälte und Regen stärker werden, so würden die empfindsamen Bewohner unfehlbar leiden. Manchen Häusern verleiht der Kalk ein schneeichtes Weiß.
Die Hütten zeugen von Einfachheit und Elend. Von der Form eines unordentlich kantigen Würfels, enthält die Hütte bloß ein Gemach, und in dieses führt eine einzige Oeffnung zur Aufnahme der Thüre, welche mit einem hölzernen Schlosse gesperrt werden kann. Wenn man nicht mehr als das Hausgeräthe auf arabisch nennen müßte, so würde man im Nu arabisch verstehen. Der Boden dient als Sessel, als Tisch, als Bettstelle u. dgl., und ist somit ein wahres Wunderding. Mann und Weib, Kinder, Freunde und Verwandte legen sich neben einander, und füllen, wenigstens auf dem Boden, den Raum der Hütte. Die Kleider, womit Manche sich des Tages bedecken, sind im guten Falle die einzige Bettung für die Nacht, und die Leute entkleiden sich in der Regel nur dann, wenn sie der allzu dienstfertigen Kreaturen auf die anständigste Weise los werden wollen. Es soll die Armuth eines Theiles der Alexandriner so groß sein, daß nicht beide, welche eine Hütte bewohnen, ausgehen können, weil sie nur ein Kleid besitzen. Darum warte der eine Elende nackt in der Hütte, bis der andere in dem gemeinschaftlichen Kleide zurücktreffe. Die Hütten sind von Erde aufgeführt und von Farbe schwarzgrau. Sie vermögen lange andauernden Regen nicht zu bestehen. Es ist nicht lange her, daß in einer kalten Regennacht viele Hütten einstürzten; eine Menge obdachloser Bewohner erkrankte und starb. Erst jetzt mochten die Leute den Segen ihres Himmels dankbarer erkennen. Wie viel Schweißtropfen rinnen über die Stirne herunter, bis der Europäer sein Heizungsholz, seine Strümpfe, Schuhe, seine Winterkleider zusammengebracht, bis er seine Wohnung mit allem Nöthigen ausgerüstet hat. Ein Theil der Hütten gefällt sich in der Nähe des vizeköniglichen Palastes. Dort bietet sich die beste Gelegenheit dar, über den schroffsten Gegensatz von „Herr und Unterthan“ Betrachtungen anzustellen. Eine andere Abtheilung von Hütten besetzt den Süden der Stadt, neben den vielen schönen Zisternen des Alterthums, und verspottet die Ruinen, jene Mauern, welche Jahrtausenden widerstanden, und noch die baufälligen Hütten unserer Tage tragen müssen.
Das sind die polsterarmen Hütten, und werden so viele Alexandriner darin geboren, und wo anders strecken sich diese auf das Sterbelager? Und doch werden die polsterreichen Europäer mit nicht minder Schmerzen geboren, und doch müssen sie auch sterben, todt werden müssen sie trotz ihrer Eiderdunen.
Krankenhäuser.
Das europäische, das am Mahmudiehkanal, das auf dem Ras-el-tin und die Observationshütten.
Das europäische Krankenhaus ist für die Europäer bestimmt, wie schon der Name bezeichnet. Es liegt, von kleinen Araber-Hütten auf der einen Seite umgeben, unweit des Frankenquartiers. Das Gebäude, nach europäischem Geschmack, nimmt sich für das Auge recht gut aus. So weit mir ein Blick in das Krankenhaus, das wenigstens eine gute Verwaltung ankündigt, vergönnt war, schöpfte ich die Ueberzeugung, daß der Europäer in seinen kranken Tagen hier gut verpflegt wird, und in dieser Beziehung Europa ihn nicht mit schmerzlichen Erinnerungen quält. Diejenigen, welche mehr (täglich einen levantischen Thaler) bezahlen, bekommen ein eigenes Zimmer, damit ihren Wünschen noch besser entsprochen werden könne. Was vielleicht am hemmendsten auf die Unternehmung einer Reise ins Morgenland wirkt, ist die Vorstellung von der Verlassenheit und den Scheusalen in den kranken Tagen; die Bemerkungen über die Krankenanstalt aber können kaum verfehlen, diese irrige Vorstellung zu verdrängen.
Das Mahmudiehkrankenhaus steht nahe am Mahmudiehkanale, den großen Baumwollenmagazinen gegenüber. Ehe man zum Gebäude kommt, geht man durch ein Gitterthor, womit eine Art Verschlag oder ein Pfahlzaun geschlossen wird. Der Eintritt durch diesen ist Jedermann gestattet. Von der Gitterthüre bis zum Krankenhause beträgt die Entfernung nur wenige Schritte. Den Zwischenraum kleiden, dem Auge sehr wohlthuend, Garten- und Wildgewächse. Am Thore des Krankenhauses selbst stieß ich auf Schwierigkeiten. Der Soldat, welcher Wache hielt, wies mich zurück, doch nicht unsanft. Ich wurde eben einen Mann gewahr der schrieb, und der mir ein Arzt zu sein schien. Ich redete ihn in französischer Sprache an. Es war ein französischer Arzt, mit Namen Etienne, der mir sogleich die Gefälligkeit erzeigte, mich im Krankenhause herumzuführen.
Von allen Krankheiten interessirte mich am meisten die egyptische Augenentzündung. Die daran Leidenden füllen mehrere Säle. Sie ist beinahe ein größeres Uebel zu nennen, als Pest und Cholera. Denn entweder genesen die an diesen beiden Krankheiten Leidenden, wie meistens, ganz, oder sie sterben — ganz. Der letztere Fall kann für die Betreffenden im Grunde nicht unglücklich sein. Welch ein Uebel dagegen ist es, völlig blind zu werden. Von zehn Arabern wird man einen entweder Halb- oder Ganzblinden finden. Ich sah weniger blinde Weiber, als blinde Männer, und die Krankheit scheint den Erwachsenen feindlicher als den Unerwachsenen.
Aus den Krankenzimmern trug ich die Ueberzeugung, daß die Leidenden, wo nicht auf eine glänzende, doch auf eine befriedigende Weise behandelt werden. Meine Erwartung ward übertroffen. Mag ein Anderer das Krankenhaus eine Nachäfferei der europäischen heißen, es wird in demselben so zu sagen Alles geleistet, was sich unter den obwaltenden Umständen thun läßt. Davon, wie Diät und Regimen gehalten wird, kann ich übrigens nichts mittheilen, wenn nicht das Wenige, daß in der Küche Reinlichkeit und guter Geruch mich bewillkommten. Das Haus ward von etlichen neunzig Kranken bewohnt. Beiläufig erwähne ich, daß diejenigen, welche außer dem Bette sich aufhielten, Achtung für Etienne erwiesen, indem sie militärisch sich stellten. Ich konnte nicht umhin meine Glossen zu machen, wenn der Eingeborene gegen den Fremden sich so unterwürfig geberdete.
Geht man zu dem Palaste des Vizekönigs, so sieht man rechts, in der Nähe des Residenzschlosses, ein dem Umfange nach großes, aber niedriges, einstöckiges Gebäude, das von Pallisaden umzingelt ist: wie das letzte, ein Militärspital. Es ist das Krankenhaus auf dem Ras-el-tin (Feigenkap) oder das Tasikispital. Früherhin eine Kaserne, bildet es mehrere Höfe, und ich konnte keine regelmäßige Bauart wahrnehmen. In der Bade- und Dampfbadeanstalt, deren Pracht mich überraschte, begegnet das Auge allenthalben weißem, geschliffenem Marmor bis an die Kuppeln, welche von zahlreichen, runden, mit Glasscheiben verstopften Oeffnungen zum Einlassen des Lichtes durchbrochen sind. Auch dieses Krankenhaus erfreut sich einer Einrichtung, welche den Bedürfnissen abhelfen dürfte.
Das Observazionsspital oder die Observazionshütten.
Ich ritt eines Nachmittags dahin; allein der Arzt war noch nicht eingetroffen. Ich ging unterdessen zum Mahmudiehkrankenhause, welches, dem Meere etwas näher, den Observazionshütten gegenüber liegt. Dr. Etienne ritt eben auf einem Esel daher. Kaum unterhielt ich mich mit ihm, als ein Kranker plötzlich umfiel. Ich sagte: Es ist ein Cholerakranker. Dr. Etienne verneinte, wahrscheinlich weil er glaubte, er könne mir einen Schrecken ersparen. Seine Geschäfte riefen ihn hinweg, und ich begab mich zu den Observazionshütten. Hören wir später das Weitere.
Diese Hütten sind mit einer Pallisadirung umgeben. Man lasse aber den Pinsel der Einbildung fallen, welcher schöne Gemälde entwirft; zur Seltenheit ist ein Pfahl genau so dick, und so hoch wie der andere. Die Pallisadirung fesselt durch ihre Unordentlichkeit schon von weitem das Auge, und wenn ein Europäer das Militär noch nicht kennte, welches, mit dem schwarzbraunen Gesichte, zwar einen Säbel und ein Kleingewehr trägt, aber sonst in Wenigem einem der europäischen Krieger gleich, oder auch bloß ähnlich sieht, so würde er schlechterdings die Hütten für Alles eher, als für ein Staatsgebäude erklären. Die Pallisadirung wird vom Militär bewacht, und dieses läßt Niemand, wenigstens den Europäer nicht, durchschlüpfen. Ich wartete wenige Minuten am Gatter der Observationshütten, und es kam der Arzt, Herr Gallo, ein Grieche, auf dem Esel geritten. Ich machte schon in einem geselligen Kreise seine Bekanntschaft, und so durft’ ich auf seine wohlwollende Aufnahme zählen.
So eben trug man einen Kranken daher über die Gatterschwelle. Plötzlicher Lärm entstand. Die Wärter eilten mit Pestzangen herbei, seinen Träger zurückzustoßen. Nun wurde der Kranke auf den Boden gestellt; allein zu schwach, um sich aufrecht halten zu können, sank er auf die Erde nieder: Der nämliche Kranke, welchen ich an der Pforte des Mahmudiehkrankenhauses umfallen sah. Er war wirklich cholerakrank.
Die Observazionshütten sind nichts, als Hütten, und zwar elende, fensterlose, schlecht ausgezimmerte, daß zwischen den Bretern, woraus die Wände bestehen, Licht eintrat, und zu einer andern Zeit unzweifelhaft Wind und Regen eindringen werden. Die Thüren werden mit einem Vorlegeschlosse gesperrt. Der Boden ist die nackte Erde, und Brutus hätte nur den Spitalboden küssen dürfen, um den Götterspruch von Delphi zu erfüllen. Das Ganze stellt eine Art Dörfchen vor. Die Hütten sind dazu bestimmt, eines pestartigen Uebels verdächtige Fälle, Pest- oder Cholerakranke, so wie auch kranke Sträflinge aufzunehmen. Einen schauderhaften Anblick für mich erregte die Kette, welche von einem Krankenbette zum andern, von einem Leidenden zum andern in gesenktem Halbbogen hinüberlangte. Die Bettstellen sind ein hölzerner Käfich, welchen ich zum ersten Male im Krankenhause auf dem Ras-el-tin wahrnahm. Wenige lagen nur auf einem Strohteppich, und auf etwas Wollenzeug, welche die Blöße der Erde zudeckten.
Die erste Hütte, in die ich geführt wurde, war zur Observazion bestimmt. Nicht Bettstellen darf man hier suchen, noch Sönderung. Cholerakranke und ein von Wechselfieber Befallener waren neben einander auf nackter Erde ausgestreckt; einer der erstern kreuzte seine Beine über den andern. Im Ganzen fanden sich drei neu hereingebrachte Kranke zur Observazion, wovon einer als nichtcholerisch erklärt wurde. Ueberdieß sah’ ich noch etwa sechs andere Choleristen.
Ich nahm die Weltcholera in den Hütten zum ersten Male wahr, und ich werde nun bei dieser Seuche ein wenig mich aufhalten. Man setzt in denselben voraus, daß die Cholera sich durch einen Ansteckungsstoff fortpflanze, und es werden gegen sie ungefähr die nämlichen Maßregeln ausgeführt, wie gegen die morgenländische Pest. Ehe Herr Gallo einem Kranken den Puls fühlte, ließ er sich die Hände mit Baumöl begießen, ohne daß jedoch die Schuhsohlen beölt worden wären.
Das Bild der Cholera ist dasselbe wie in Europa. Gänzliche oder fast gänzliche Abwesenheit des Pulses an der Hand, die Haut kalt, über den Phalangen schrumpfig, wie bei einer Wäscherin, der Abgang einer wässerigen, weißlichen Flüssigkeit sursum et deorsum, das Auge gläsern, wie erstorben, der Blick stier und bedeutungslos, die Nase dünn und spitzig, die Löcher mit Staub, die Lippen trocken und bläulich, die Zunge beinahe starr und wird vom stoßweise Lallenden nur mit Mühe gezeigt, die Backen zu eckigen Vertiefungen eingefallen u. s. f. Kurz, im höhern Grade der Krankheit hat man einen lebendigen Todten vor sich. Der Anblick von Cholerakranken ergriff mich nicht besonders; denn die schwarzbraune Farbe der Araber ist nach europäischen Begriffen ohnehin widerlich, und sie veränderte sich nicht bedeutend, außer daß sie schmutziger wurde. Die Kranken schienen mir keineswegs auffallend zu leiden; sie gaben kein Gestöhne oder irgend einen Schmerzlaut von sich. Die asphyktisch Cholerischen waren vom tiefen Schlafe trunken. Diejenigen, welche in den Hütten untergebracht werden, ziehen beinahe Alle das traurige Loos eines frühzeitigen Todes.
So angenehm das Mahmudieh- und Ras-el-tin-Krankenhaus meine Erwartungen übertrafen, so sehr ich auch geneigt wäre, ein günstiges Urtheil zu fällen, so wenig kann ich der Observazionsanstalt Lobsprüche ertheilen. Es stellt sich in der That zwischen einer solchen und keiner Anstalt wenig Unterschied heraus. Dagegen lauten die Forderungen, daß gerade das Pestlazareth auf dem humansten Fuße stehe. Wo ist die Hülfe dringender, als bei Pest und Cholera? Wo ist es für einen Kranken, mag er selbst ein gefesselter Sträfling sein, peinlicher, als zwischen oder doch in der Nähe solcher Kranken, welche der ganze Rüstzeug der Regierung und die öffentliche Meinung der Franken für ansteckend ausgibt? Wie leicht werden die Erkältungen in der Regenzeit. Es ist für den Ruhm nicht genug gesorgt, daß man einen Obersten des Landes reich besolde, oder einen fremden Marschall mit Ehrenbezeugungen überhäufe, so lange die Noth armseliger und beladener Unterthanen aus einem Krankenstalle schreit.
Nach der einmal gefaßten oder vorgefaßten Meinung von dem ansteckenden Karakter der Cholera sperren sich die meisten Europäer in Alexandrien gegen diese Seuche, wie gegen die Pest, ab. Ich kann nicht umhin, das völlig umgekehrte Verfahren der Kontagionisten in Europa, ins Gedächtniß zurückzurufen, nach welchem die Kranken selbst isolirt werden. Ein sicheres und das beste, aber das inhumanste, die Pflichterfüllung und Berufstreue schnurstracks verhöhnende Mittel, sich vor der Cholera zu schirmen, ist die zeitige Entfernung vom Orte, wo die Krankheit herrscht, an einen solchen, welcher davon frei ist.
Ebenso betrachten die europäischen Alexandriner die Pest durchaus als kontagiös. Sie schließen sich ihretwillen ein, doch nicht überall so, daß gar nicht mehr ausgegangen wird. So besorgte ein Handelsmann die Geschäfte außer dem Hause, in welchem seine Mitarbeiter und das Gesinde stets eingesperrt waren. Er stülpte unten die Beinkleider auf, beölte die Schuhsohlen und, mit einem großen Stocke bewaffnet, machte er sich auf der Gasse Bahn, damit ihn Niemand berühre. Der Araber weicht ohne Anstand aus. Jener Mann, den ich zum Beispiele wählte, rettete sich durch die Pestzeit.
Wenn sonst auf der Straße die häßlichsten Weiber jeden Augenblick erhaschen, ihr Antlitz vor dem Europäer zu verhüllen, so überraschte es mich, in einer der Pesthütten kranke Weiber unverschleiert zu sehen. Sie verriethen beim Erscheinen des Arztes, seines Assistenten und meiner Person nicht die mindeste Verlegenheit, und rollten ihre schwarzen Augen rechts und links, so oft es sie gelüstete. Unter den Kranken befand sich, wie sich etwa der Pariser vornehm ausdrücken würde, auch eine Galante.
**
*
Die Gesundheitspolizei würde in der Stadt noch Manches aufzuräumen haben. Dem Garstigsten vom Menschen begegnet man an den meisten Orten. Ueber dem Bassar, nämlich auf den Deckbretern, häufen sich Unreinigkeiten fast jeder Art, die wohl selten weggeschafft werden. Aeser erblickte ich wenige. Wie dem auch sei, so werden immerhin einige Gassen gekehrt und etliche Plätze mit Wasser besprengt. Gleichwie die Unreinigkeiten am Gesichte auf Nachlässigkeit und schlechte Gesundheitspolizei des Mikrokosmus schließen lassen, so zeigen die Unreinigkeiten an den Gebäuden und auf den öffentlichen Plätzen mit der Gewißheit der Uhr an, wie wenig sich der Staat um das öffentliche Gesundheitswohl bekümmere.
Die Katakomben und der Pferdestall.
Hat man den Mahmudiehkanal überschritten, und ist man an den großen Baumwollenmagazinen vorüber, so leitet der Weg durch eine wüste Gegend, und bald gelangt man zu den Katakomben, welche, südwestlich von Alexandrien, an der Seeküste sich hinziehen. Wo das Meer in Gemächer fließt, heißen diese die Bäder Kleopatra’s. Sie waren es auch wahrscheinlich, und jetzt noch könnte man hier mit Bequemlichkeit Seebäder gebrauchen. Von da ging ich in eine der vielen Oeffnungen. Der Eingang bildet eine geräumige Höhle, welche jetzt als Pferdestall dient. Am Lichte der Fackel wendete ich mich links. Ich trat in einen Tempel, welcher, mit sorgfältiger Hand in den Felsen ausgehauen, durch seinen einfachen und edeln Styl mir ungemein gefiel. Weiter kam ich in eine Menge viereckiger, kleinerer und größerer Gemächer. Bald durfte ich aufrecht gehen, bald mußte ich durch eine Oeffnung oder einen Gang geduckt mich durchhelfen; selbst war ich genöthiget, durchzuschlüpfen oder durchzukriechen. Ich hatte mich wie in einem Labyrinthe verloren. Der Araber, die einzige Seele mit mir, hätte mich an den Ort des Verderbnisses führen können, ich würde ihm nachgegangen oder nachgekrochen sein, wenigstens bis an die Schwelle. Die Größe der unterirdischen Arbeit beschäftigte in diesem Augenblicke am meisten meinen Geist. Ich vergaß der Schakals und Hyänen, die Herr von Prokesch in den Katakomben hausen läßt. Denn ich sah nichts Böses, nur Alles leer, öde, ausgestorben, höchstens einige Gebeine herumliegen, oder ein Käuzlein auffliegen. Ich athmete bei meinem unterirdischen Spazierengehen und Spazierenkriechen keine erstickende Luft, wie Herr von Prokesch (I. 23). Allerdings fühlte ich Hitze, doch keine drückende. An den Wänden konnte ich weder Zeichen, noch Farben finden.
Wer mochte wohl die Katakomben geleert, geraubt, entweiht haben? Wie sehr sind die Religionsformen der Wandelbarkeit unterworfen. Mit saurer Mühe brach man einst die Zellen in den Felsen, mit religiöser Verehrung setzte man die Todten bei; nun ist Alles Heilige aus den heiligen Oertern entwichen, und es fehlt dem Araber nur noch der Geldreiz, daß er seinen Auswurf nicht in den Zellen aufhäuft. Mich beschämte der Gedanke, wie viel mehr Ehre die Alten den menschlichen Ueberresten erwiesen haben, als unsere Zeitgenossen bezeugen. Vielleicht würden sie, wenn sie wieder lebendig wären, uns der Unmenschlichkeit oder des Barbarismus beschuldigen, weil wir den Leichen so wenig Rechnung tragen, daß sie in unlanger Zeit spurlos verschwinden, und auch nicht einen Haltpunkt des Andenkens darreichen, etwa mit Ausnahme der Leichenbeine, welche, unter Zerstörung des Individualitätswerthes, herumgeworfen, oder in der größten Unordnung aufgestapelt werden.
Die Nadeln der Kleopatra und der Flohfänger.
Hart am neuen Hafen sieht man die Nadeln oder Obelisken der Kleopatra, den einen stehen und den andern liegen. Ich näherte mich dem stehenden Obelisken von der Südseite. Ich erblickte einen verwitterten Stein. Ich wendete mich um, die Ostseite zu besehen. Gleicher Anblick. Wie ich mich gegen die Nordseite wendete, siehe, da saß am Schatten des Obelisken ein nackter, erwachsener Mann, welcher die Nähte seines Hemdes durchspionirte und an dem Todschlage oder Toddrucke eines gewissen Missethäters wahrscheinlich eben so sehr sich ergötzte, als ich mich an den Obelisken. Daß es ernsthaft zuging, mußte ich daran merken, daß der neue Adam kaum aufschaute, und ein daneben sitzendes Mädchen in aller Unschuld ihn in seinen Bestrebungen bestens unterstützte.
Ist es nicht eine halbe Gotteslästerung, daß man vor einem so erhabenen Denkmale, welchem die Seele in edler Begeisterung zugelenkt wird, ein Scheusal von Prosa auskramt? In der Natur ist aber überall Gegensatz — neben dem Erhabenen das Niedrige, neben dem Edeln das Unedle. Wenn wir uns dergleichen erhabene Monumente vorstellen, so dichtet freilich unsere Einbildungskraft Allem um sie herum den Anstrich des Erhabenen an; es dürfen keine lumpige oder entblößte Leute in ihrer Nähe herumstehen, herumwandeln oder herumsitzen, sondern nur edle, halbverklärte Geister müssen herumschweben. Wie denn von jeher das Große, Erhabene und Edle seine Verächter und Spötter fand, so wiederholt sich diese Verachtung und dieser Spott im Angesichte der Obelisken. Kann man sich wohl eine größere Verachtung oder einen ironischern Spott auf ein Werk, welches die vereinte Anstrengung so vieler Menschen kostete, denken, als einen Flohfänger, der von aller Pracht nichts wollte, als den Schatten? Ein solches Schauspiel gewinnt selbst höhern Sinn in poetischer und politischer Beziehung.
Schon beherrscht mein Auge die Nordseite des Obelisken. Diese hat sich mit den Hieroglyphen noch in gutem Zustande erhalten; so auch die Westseite. Der Obelisk besteht aus rothem Granit und erhebt sich siebzig Pariserfuß. Nicht durch seine Größe, noch durch seine Form macht er Eindruck, sondern man betrachtet diesen Stein erst mit rechter Aufmerksamkeit, wenn man weiß, daß er ein einziges Stück und ein sehr altes Geschichtbuch ist. Die Sache beim Lichte besehen, bewundern wir nicht den Stein selbst, sondern einzig den ihm aufgeprägten Geist der Menschen. Sonst dürften wir jede Handvoll Erde, die so gut ein Alterthum ist, wie der Obeliskenstein selbst, in die Liste der Denkwürdigkeiten aufzeichnen.
Der zweite Obelisk liegt gleich neben dem stehenden. Die Hälfte bedeckt der vielmächtige Sand; die andere verzeigt Hieroglyphen. Die Engländer sollen ihn umgestürzt haben, in der Absicht, denselben nach ihrem Vaterlande zu bringen, wovon sie bloß die Berechnung des kostspieligen Transportes abgehalten hätte. Der Luxor wurde in der That von den Franzosen freundlicher behandelt.
Die Pompejussäule und die Schandsäule.
Man hat mir so viel von der Pompejussäule vorgeschwatzt, daß ich sie zuerst nicht sehen wollte. Ich stand lieber still bei den Kameelen, in dem Bassar und zu aufmerksam bei den elenden, beinah mehr mit Ketten, als mit Kleidern bedeckten Sträflingen.
Die Säule wurde zu Ehren des Kaisers Diokletian errichtet. Die Statue steht nicht mehr. Die Engländer, welche 1776 den Schaft bestiegen, und auf dem Fußgestelle eine Schale Punsch tranken, entdeckten noch einen Fuß. Die Säule ruht auf einer vortheilhaft erhobenen Stelle im Süden der Stadt. Gleich an ihrem Fuße breitet sich ein Leichenacker aus, auf welchem ich die Turbane durchmusterte. So eben lag eine, in ein blaues Tuch gewickelte Leiche auf einer Bahre, neben Weibern ohne Klage, während gegraben wurde. An manchen Orten Europens hat man das Grab im Vorrathe, und hier muß die Leiche darauf warten. Um keine Verletzung der Sitten und Gebräuche mir zu Schulden kommen zu lassen, stieg ich vom Esel und ging zu Fuß querein durch den Leichenacker. Der Treiber wollte den Esel mir nachführen; allein er wurde angewiesen, mit dem Thiere den Weg um das Leichenfeld einzuschlagen. Man mußte dießmal von der Ansicht geleitet worden sein, daß der Esel nicht würdig wäre, auf den Gräbern der Menschen zu wandeln. Mit dem Purismus ist es aber eine kitzliche Sache; immer und immer wirft er den Fallstrick des Widerspruchs vor. Läßt man jetzt den Esel nicht über die Gräber traben, so versenkt man vielleicht später Ungeziefer in die Gräber. Ich muß es ganz herausbrocken; sonst haben die Worte keine Kraft.
Vom Leichenacker aus gesehen, prangt die Säule des Pompejus als ein großartiges Denkmal, auf welchem das Auge mit Lust weilt. Die ganze Höhe der Säule, nämlich des Schaftes mit Knauf und Piedestal, mißt 98 Pariserfuß. Der Schaft besteht aus einem einzigen Stücke rothen Granits. Billig staunt man darüber, wie ein 68 Pariserfuß langer und 7 bis 8 Fuß im Durchmesser haltender Stein (der Schaft) gebrochen, fortgeschafft, ausgearbeitet und aufgestellt werden konnte.
Das Verdienst, daß die Säule noch aufrecht steht, verdankt sie dem Umstande, daß sie von stummem Stein und schwer ist. Wäre sie mit D. O. M. überschrieben gewesen, so würde sie wahrscheinlich zerstört worden sein, wie die Alexandriner-Bibliothek, deren Verlust einer der unersetzlichsten für die Menschheit genannt werden darf. Es erregt Abscheu im höchsten Grade, daß die Leidenschaften der Menschen schadenfroh zerstören, was Andere Schönes und Erhabenes mühsam zu Stande brachten, und nichts vermag mehr, den Hochmuth unseres Zeitalters zu beugen, als die Betrachtung, daß die gleichen Leidenschaften den Krieger ohne Aufhören in den barbarischen Kampf rufen, in welchem so manches unschuldige Leben verblutet.
Reisende, welche die Säule bestiegen, bezeichneten diese mit ihren Namen. So viel Namen; so viel Entweihungen, so viel Beschuldigungen der Eitelkeit, so viel Stoff zum Aergernisse. Man würde sich scheuen, einen altrömischen Kriegsmann in eine Pariser-Jacke zu zwingen, aber die gleiche Thorheit an der alten, ehrwürdigen Säule zu begehen, trägt man kein Bedenken.
Bei der Pompejussäule genießt man eine schöne Aussicht auf Stadt und Land, Gärten und Wüsten, Hafen und Meer.
Die Nachgrabungen.
Wenn auch nicht das wissenschaftliche, so regt sich ein anderes Interesse, welches die Nachgrabungen im Schutte veranlaßt. Ibrahim-Pascha will neue Bauwerke, und so läßt er die von den längst entschwundenen Vorfahren gemeißelten Bausteine aus dem Schutte heraufholen. Daher sieht man an den im modernen Style sich erhebenden Gebäuden Steine aus der grauen Vergangenheit, die man bloß zurechtsägt, damit sie sich desto besser in die lästige Gegenwart fügen.
Ich sah zwei Schachte, in denen man Nachgrabungen anstellte, und meine Aufmerksamkeit wurde doppelt angespannt: in den Rahmen der neuen Welt waren die Arbeiter und die Behandlung derselben, so wie die Art und Weise in Verrichtung der Arbeit u. s. f., in denjenigen der alten Welt die Antiquitäten gefaßt. Wenn die lebensreiche Jetztwelt mich mit größerer und unwiderstehlicherer Macht zu ihr hinreißt, so wolle der Vorweltler mir nach Herzenslust grollen, aber nur nicht eher, als bis er sich den Alterthumsschlaf aus den Augen gerieben hat. Es standen zwei Aufseher da, ein Grieche, ein dem Anscheine nach unwissender Mensch, und ein farbiger Mohammetaner. Beide hielten Peitschen in den Händen. Mich empörte es, wie der letzte ein etwa zwanzigjähriges Mädchen, welches eine ungemeine Lebhaftigkeit zeigte, und seine Arbeit mit Gesang begleitete, liebkosete, und später ihm mit der Peitsche aufmaß, so daß es entsetzlich schrie, freilich nicht ohne Verstellung. Mehr noch, als das Schlagen ärgerte mich, daß man es duldet. Schimpft nicht auf die Tyrannen, aber auf diejenigen, welche sie leiden. Wenn die Leute nicht in eine Art thierischer Unterwürfigkeit versunken wären, wenn bei ihnen die Selbstachtung nicht gleichsam erloschen wäre, so würde bald eine andere Saite aufgezogen sein. Die Europäerin meint nun zum allermindesten, daß jenes egyptische Mädchen vom bittersten Zorne und Hasse gegen den Aufseher ergriffen wurde. Nichts weniger, als dieß. Kaum schien der Schmerz ausgesumset zu haben, so kehrte die frühere Fröhlichkeit zurück, und man konnte aus dem freundlichen Benehmen des Aufsehers gegen das ihm wieder freundlich zulächelnde Mädchen deutlich schließen, daß nach der Arbeit zwischen diesen zwei Leutchen ein herzlicheres Verhältniß obwalten müsse.
Fast ganz nackte Männer hoben den Schutt hervor; man dürfte wohl sagen, ganz nackte, weil so nichts vor den Blicken verborgen war, indem die Lumpen bald diesen, bald jenen Theil kümmerlich verhüllten. Ich war an den Anblick solcher Leute noch nicht gewöhnt; allein die kleineren und größern Mädchen schienen das nicht zu beachten, was in der Meinung des Europäers die Wohlanständigkeit so tief verletzen würde. Der Schutt wurde in, aus Dattelblättern geflochtene, kleine, runde Körbe geworfen, und so auf dem Kopfe weggetragen. Zugleich richteten es die Lastträger, um sie scherzweise so zu nennen, gar fein ein, dergestalt, daß der eine auf den andern warten konnte, damit ja wieder einige Augenblicke in süßem Nichtsthun dahinfließen. Man las auf den Gesichtern der Arbeiter, und auch alle ihre Bewegungen verriethen es, daß nicht die mindeste Lust zur Arbeit sie beseelte, und daß sie lediglich aus Furcht vor der Gewalt oder aus Zwang sich dazu anschickten. Viele in Alexandrien wohnende Europäer hegen die Ueberzeugung, daß ohne Peitsche und Stock der Araber von seinem Hange zum Müßiggange nicht loszurütteln und zur Arbeit zu bewegen wäre. So bald er etwas erspart habe, behaupten sie, lege er sich auf die Bärenhaut, und verthue oder vergeude wieder Alles. Uebrigens sorgt der Pascha mit väterlicher Theilnahme dafür, daß die Arbeiter nicht zu viel Geld in die Hände bekommen; denn die 30 bis 40 Para, welche er ihnen täglich in die Hand preßt, reichen kümmerlich für die allernothwendigsten Bedürfnisse hin. Würden Mehemet-Ali und Mahmud den abendländischen Fürsten darin nachahmen, daß sie, statt der Chiffres, ihre Köpfe auf der Silbermünze abprägen ließen, sie dürften gewiß nicht besorgt sein, daß sie in den Händen dieser egyptischen Arbeiter rothe Backen bekämen.
Leute. Bevölkerung.
Auf den Straßen ist es ungemein lebhaft. Die Budengassen (Bassar) sind theilweise gedrängt voll. Man darf sich mit Recht wundern, daß, bei allem Gedränge, die in ein bloßes Hemde gekleideten mohammetanischen Weiber den Franken selten berühren. Die bunte Kumpanei von so verschiedenen Menschen mit ihren abweichenden Sitten und Religionsformen, der bunte Wechsel von so verschiedenen Thierarten, als von Kameelen, Büffeln, Eseln, Pferden, hin und wieder das Knarren von Lastkarren (welche der Regierung gehören) wirkt beinahe betäubend. Nirgends traf ich mehr Getriebe und mehr Rührigkeit, als im Arsenale und in den Schiffswerften. Tief in die Nacht dauert der Lärm, und wenn das Getümmel der Menschen verstummt, so erhebt sich das Gebell der herrenlosen Hunde. Schwerlich wird dem Schlaflosen je eine feierliche Stille vergönnt.
Der arabische Alexandriner ist eine wahre Lärmtrompete. Er lernt laut; arbeitet er, so singt er. Wenn dreißig bis vierzig Arbeiter eine Last heben, so tönt nicht unangenehm für das Ohr der Chor der Menge, welcher dem Solo des Kommandirenden antwortet. Alle die Lärmereien sollen eine religiöse Bedeutung haben. So rufen die Mohammetaner gar oft ihren Propheten an, der auch Hamma heißt.
Ueber die Bevölkerung der Stadt konnte ich nichts Zuverlässiges in Erfahrung bringen. Jährlich sollen, nach einem eben so gut unterrichteten, als angesehenen morgenländischen Bewohner Alexandriens, im Durchschnitte dreitausend Menschen sterben. Es leidet kaum einen Zweifel, daß die Sterblichkeit in Alexandrien, dessen Lage allgemein für ungesund gehalten wird, groß ist. Lassen wir, wie in Rußland, den fünfundzwanzigsten Theil der Bevölkerung jährlich sterben, so erhalten wir eine Gesammtheit von fünfundsiebzigtausend Menschen. Jedenfalls steigt die Einwohnerzahl weit höher, als man sie in Europa glaubt. Uebrigens hat sie durch die letzte Pest (1834/5) bedeutend abgenommen, obwohl man, wie man mich versicherte, am Gedränge in den Gassen keinen Unterschied bemerke. Nach den Einen sollen unter dem Todesstreiche der letzten Pest 13,000, nach Andern selbst 20,000 Menschen gefallen sein. Man muthmaßt, daß die Regierung geflissentlich die Zahl der Gestorbenen minder groß (etwa 11,000) angab, und man will bestimmt wissen, daß manche in den Hütten an der Pest Verstorbene gleich unter denselben in die Erde verscharrt wurden, weil die Gesundheitspolizei gegen verpestete Hütten sogleich zu Maßregeln schritt, welche den Araber belästigten. Die Bevölkerung Alexandriens gleicht einem Polypen. Schneidet man ein Stück davon, alsbald wird das Verlorene wieder ergänzt. Wenn die arabische Bevölkerung der Stadt auch viel einbüßt, so wird der Verlust doch wieder in kurzer Zeit ersetzt, theils weil das arabische Weib gerne und leicht Kinder bringt, theils weil vom Lande immerfort Lückenbüßer einrücken. Es mag nebenbei die Bemerkung nicht überflüssig erscheinen, daß der Pascha seine Stärke in der größtmöglichen Vermehrung seiner Unterthanen sucht. Er thut ihr daher jeden Vorschub. So darf ein Seesoldat nicht ans Land gehen, wenn er kein Weib nimmt. Wie wenig wurzelfest ein solches Prinzip sei, könnte er von unsern Lehrern der politischen Oekonomie lernen. Hohl und trügerisch ist der Gewinn für das Ganze, wenn die Zunahme und der Verlust der Bevölkerung in gleichem Grade steigen. Eine klein scheinende Sache ist manchmal von großer Wichtigkeit, und hier die Erhaltung der Bevölkerung, und wollte der Pascha nach diesem Ziele ringen, so könnte er nicht nur über die gleiche, sondern selbst über eine intensiv stärkere Bevölkerung gebieten, sich nicht nur einen Theil seiner Laufbahn von Dornen säubern, sondern auch Andern tausend Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten, tausend Kümmernisse und Seufzer ersparen.
Der Ritt zur Beschneidung.
Was ist das für ein Reuter dort auf stolzem Rosse, den Bassar durchziehend? Was für eine gellende Musik? Was für ein rufendes, wogendes Menschengedränge, aus dem — Salz gegen das Roß anstäubt? Ach, eine Komödieankündigung; mit solchen Ausposaunungen füllt man die Ohren in allen Krähwinkeln der Welt. O Wahnsinn, welcher dergleichen verdeutet! Das wohlaufgeputzte Kind, welches der Reuter auf dem Schooße hält, ist ein mohammetanischer Knabe, mit dem man an den Ort reitet, wo die Beschneidung vorgenommen werden soll. Freilich soll, muß u. s. f., mögen nun seine Augen triefen von Krankheiten und naß sein vor Wehmuth. Was — Wehmuth? Sein Weinen hört man ja nicht, weil das Ohr von Pauken und Tambour und Schalmeien übertäubt wird.
Die Mohammetaner halten auf der Beschneidung sehr viel. Erst wenn der Knabe beschnitten, ist er ein Moslim (Rechtgläubiger). Die Großen begleiten dieselbe mit sehr viel Gepränge. Die Beschneidung des nachherigen Sultans Mehemet dauerte vom 21. Mai bis zum 30. Brachmonat 1582. Die abgeschnittene Vorhaut wurde in einer goldenen Schale der Mutter des Sultans, und das Barbiermesser blutig der Großmutter zugeschickt. Wenn man damit zugleich die Rohheit der türkischen Sitte bezeichnen möchte, so versteht sich von selbst, daß auch Sauls Forderung (1. Samuel, 18, 26 und 27) in der Vorderreihe roher Sittenzüge steht.
Primarschule.
Du gehst auf den Gassen. Du hörst einen Lärm, ein Brumsen und Sumsen. Auf einmal erblickst du eine Menge Kinder, die in einer offenen, über die Gasse nur wenig erhöheten Bude hocken, den Körper vor- und rückwärts bewegen, eine weiß bemalte, hölzerne Schreibtafel in der Hand halten. An einer Wand hockt der Schulmeister, und macht mit seinem Körper eben so komische Bewegungen. Er lehrt und ißt Bohnen zu gleicher Zeit.
Das ist eine Kinderschule. Nirgends sah ich die fröhliche Ausgelassenheit der Kleinen in höherm Grade als hier.
In Alexandrien gibt es mehrere Schulen. Ich glaube nicht, daß sie gesetzlich bestehen. Weil in den Schulen die Religion nach dem Koran gelehrt wird, so schickt der Mohammetaner aus religiösem Eifer die Kinder in dieselben. Der Schreiber wird unter dem Volke sehr geachtet. Mädchen nahm ich unter den Schülern nicht wahr.
Die Zeichenschule.
Ich begegnete im Arsenale einem Europäer, den ich um Auskunft fragte. Sein Aeußeres wollte eben nicht viel versprechen. Mit zuvorkommender Gefälligkeit führte er mich in ein Zimmer, wo etwa zwanzig ältere Zöglinge zeichneten, davon mehrere schon an zwei Weiber verheirathete. Mein Führer, aus Marseille gebürtig, stand der Schule, die er erst vor kurzem gegründet hat, selbst vor. Die Araber saßen auf Bänken vor Tischen, und die Muster lagen oder hingen vor ihnen. Mir schienen die Zöglinge Eifer an den Tag zu legen, und ihre Arbeiten, Laub- und Blumenwerk, z. B. für Tapeten, geriethen nicht übel. Der Zeichenlehrer eröffnete mir, daß der Araber viel Talente besitze, daß er aber zu sehr Schlaraffe sei, um sie anbauen zu wollen. Er bestätigte, was ich von Andern vernahm, daß er denselben nur durch strenge Zucht zur Arbeit und zum Fortschritte bringe. Von Stockschlägen faselte der Franzose ganz geläufig, als wäre er mit ihnen aufgewachsen. Der Mangel gründlicher Kenntniß in der arabischen Sprache stellt dem Lehrer viele Hindernisse in den Weg. Indessen bemüht er sich eifrig, diese Sprache in seinen Besitz zu erlangen, damit seine Mittheilungen leichter werden. Da der Lehrer selbst nicht gar viel Zeit im Schulzimmer zubringt, so sucht er sich durch eine Art Lancasterschen Unterrichtes zu helfen. Während seiner Abwesenheit vertritt der beßte Zögling die Stelle eines Lehrers. Die Lehrlinge werden im Ganzen strenge gehalten. Des Mittags dürfen sie nicht ausgehen, und sie speisen im Zimmer. Eben hockten zwei auf dem Boden, und langten mit ihren Fingern eine Art Brei aus einem großen Teller heraus.
Der Pascha verbindet mit dieser Schule offenbar den Zweck, sich von dem Abendländer mehr und mehr unabhängig zu machen. Vielleicht sind die goldenen Tage des letztern in Egypten vorüber, so bald er den Pascha und seine Leute einen solchen Schatz gelehrt haben wird, daß die Anleitung und die Mithilfe des Fremdlings entübrigt werden können.
Weiberhändel.
(Zum Troste der Europäerinnen gibt es auch in Afrika Weiberhändel.)
Ich lag unter dem Fenster, über einem Bassar. Auf einmal wendete sich eine Mohrin kreischend und, mit einem Schäufelchen drohend, rasch gegen einen Türken. Das Weiße des Auges gegen die Schwärze der Haut, wie das Licht gegen den Schatten, abstechend, warf den lebhaften Glanz der Gemüthsbewegung. Der Türke stand in stolzer Ruhe; fest heftete er seinen Blick an das Weib. Auf einmal fiel ein minder schwarzes Weib der ersten in diejenige Hand, welche das Schäufelchen hielt. Die Weiber wetteiferten mit Lärmen. Was für ein Ende wird der Auftritt noch nehmen? Wie treffen doch die zierlichen Europäerinnen und die plumpen Afrikanerinnen den gleichen Punkt, ob auch nicht so haargenau; denn in Europa raufen sich Weiber die Haare, hier dagegen greifen sie nicht nach dem Kopfe, sondern halten sich einander die Hand, oder kneipen und reißen an den Kleidern. Daß die auf einander erbosten afrikanischen Damen mehr nach dem in der Gemüthsaufwallung gepreßten Herzen greifen, ist es etwa instinktmäßiger? Ich glaube nicht, daß, wenn es keine Männer gäbe, die Welt aussterben, sondern bloß, daß die übrig bleibenden Weiber von einander aufgerieben würden, nämlich zuerst die guten von den bösen, dann die bösen von den bösesten. Und das habe ich nicht nur schon im Stillen gedacht, sondern ich wollte es auch vor Männiglich sagen, wozu es freilich keines Muthes bedarf; denn sollte ich mit meinem harten Urtheile irgend eine Schöne zum Zorne aufregen, so bin ich überzeugt, daß sie sich selbst, im Schmucke desselben, vor dem Mann mißfiele, und daß sie ihn viel lieber an einer schwachen Mitschwester entlüde.
Es kam, um zu unserm Spektakel zurückzukehren, Polizei dazwischen, und so nahm der Handel flugs ein Ende. Natürlich wurde ich an der Fortsetzung meiner nicht ganz unangenehmen Beobachtung gestört.
Geld und Geldnoth.
Eine englische Guinee gilt 100 Piaster (Krusch); 40 Para (Medi) machen einen Piaster aus. Beiläufig 8 Piaster kommen einem Gulden Reichswährung gleich. Die egyptischen Goldmünzen sind 10, 9, 4 und 3 Piasterstücke. Diese letztern empfehlen sich wegen ihrer Kleinheit wenig. Man darf ordentlich auf der Hut sein, um sie nicht zu verlieren. Die Silbermünzen sind 1, ½, ¼ und ⅛ Piaster, selbst ein Para. Es gibt übrigens auch ¼, ¼ Piaster und 1 Parastück in Kupfer. Dieß die Hauptmünzen. Man könnte wohl noch mehr angeben, wenn man weitläufiger sein wollte.
In Alexandrien ist Noth an Scheidemünze, so daß bisweilen für das Wechseln von 4 Piaster in Gold ohne Anstand 10 Para abgezogen werden. Ich war einmal genöthigt, einem Araber, der meine Sprachen nicht besser als ich seine verstand, so viel Para zu bezahlen. Anfänglich glaubte ich freilich hintergangen worden zu sein, weil eine so beschaffene Ordnung von Unordnung mich allzusehr befremdete. In Kaffee- und Wirthshäusern tritt gewöhnlich der Fall ein, daß man nicht quitt rechnet. Bald bleibt der Wirth, bald der Gast schuldig. Einmal konnte der Wirth mir keine kleine Münzen zurückgeben, und erklärte, mit Annahme der Zahlung zu warten. Wie staunte ich über das gastwirthliche Zutrauen, welches das Morgenland so lieblich verkündiget. Man fasse sich wohl, dieses Zutrauen ging auf den Stelzen der Münznoth. Ein andermal blieb ein Kaffeewirth, aber ein Grieche, mir eine Kleinigkeit schuldig. Die Begehr nach Scheidemünze fällt, wenigstens dem Fremden, ungemein beschwerlich; man muß gleichsam auf dieselbe Jagd machen, indem man jede Gelegenheit auffängt, um eine größere Münze auszugeben, die beim Umwechseln kleinere zurückwirft. Dazu kommt noch eine andere Unbeliebigkeit, daß schwierig zu erkennende falsche, oder gebrochene und beschädigte Münze im Umlaufe ist, welche nicht angenommen wird.
Zählen wir doch nichts zu den Unmöglichkeiten. Vielleicht rührt die Scheidemünznoth vom Kometen her, den ich in Egypten gerade zum ersten Male, als einen hübschen, langen Schweif, in der nördlichen Himmelsgegend zur Sicht bekam. Im Kaffeehause erregte diese Erscheinung plötzlich ernstes Rufen, lautes Lärmen, eiliges Laufen, anders nicht fürwahr, als wäre Feuer ausgebrochen. Wenn der Schwanzstern nun dieses zu bewirken, und, wie es denn bekannt ist, Krieg und Pest heraufzubeschwören vermag, wie soll er die Leute nicht auch in die Klemme des kleinen Geldes treiben können? Uebrigens bin ich selbst froh, daß die Sterngucker den Spaß dort ungefähr errathen haben; denn mich bangte nicht wenig, der Komet werde gar ausbleiben, dieweil er aus dem Wirrwarr der Himmelspropheten sich etwa nicht herauszufinden wisse, die in der Festsetzung des Tages oder der Nacht für das Stelldichein so nicht einig werden wollten oder konnten.
Das Schiff der Wüste.
Auf Alexandriens Boden reichten auch die vielen Kameele meiner Neugierde Nahrung dar. Zu Lande werden meist auf dem Rücken dieser Vierfüßer die Lasten fortgeschafft. Wie ein Faden spinnt sich eine lange Reihe von Kameelen oft mitten durch das Menschengedränge in den Gassen, eines hinter das andere gebunden. In ein weitfenstriges Netz von Stricken werden größtentheils die Lasten aufgeladen; so Steine, so Säcke, so Anderes. Das hohe Kameel bewegt sich in gemessenen langen und eher langsamen Schritten, während der niedrige Esel mit seinen kurzen Füßen trippelt. Der Fuß des Kameels ist wie das Pendul einer Thurmuhr, der Fuß des Esels wie dasjenige einer Taschenuhr. Und noch mehr Gegensatz. Das Kameel ernst, der Esel flatterhaft; das Ohr des großen Kameels klein, des kleinen Esels groß. Es macht Spaß, diese zwei Thiere neben einander zu sehen.
Anleitung für den Reisenden.
Langt man im Hafen an, so fährt der Kapitän in seiner Schaluppe ans Land. Ergreift man nicht gleich diese Gelegenheit, so holt man später auf einer der Barken, die im Hafen jederzeit bereit liegen, die Effekten, höchstens für einen Piaster. Zu Lande wird das Gepäcke von den Mauthbeamteten untersucht, welche einen Piaster von mir forderten. Ein Lastträger bringt für einen Piaster das Gepäcke bis ins Logis. Eine größere Last würde man am beßten auf Esel oder auf Kameele laden, und auch auf letztern kostet die Fortschaffung des Gepäckes nicht viel. Ehe ich das Zimmer im Wirthshause zu den drei Ankern (welches sonst dem kostspieligeren zum goldenen Adler nachgesetzt wird) bezog, fand ich mich mit dem Wirthe ab. Das Zimmer war geräumig, mit der Aussicht auf einen Bassar, das Bett rein; die Flügelthüren mußten mit einem Vorlegeschloß gesperrt werden.
Mein Paß war von der Polizei in Triest mit nicht mehr Umständlichkeiten nach Alexandrien visirt, als reisete ich von dort nach Venedig, und der Kapitän händigte am Orte der Bestimmung ihn selbst dem österreichischen Konsul ein. An das Reisen nach Egypten binden sich überhaupt keine polizeiliche Schwierigkeiten. Nachdem mein Paß in meinem Kantone ausgefertigt war, wurde er einzig dem österreichischen Gesandten bei der schweizerischen Eidgenossenschaft zum visiren übersandt, weil ich in Europa keinen andern als österreichischen Boden beschreiten wollte. Die Polizei abgerechnet, fiel er hier weder in die Hände eines Konsuls, noch sonst Jemandes. Als ich mich beim österreichischen Konsulate in Alexandrien anmeldete, eröffnete es mir, daß es mir den Paß nach Kairo unterschreiben werde, wenn ich hinauf reisen wolle, und daß ich ihn dann abholen könne. Das Visum erhielt ich „gratis“, und ich mußte nur einem egyptischen Angestellten, welcher sich auf der Konsulatskanzlei befand, für einen Vorweis bei der Douane am Mahmudiehkanale einen oder zwei Piaster, so wie den Douaniers selbst, welche auf eine den Fremden sehr belästigende Weise die Effekten durchsuchen, wiederum einen kleinen Tribut bezahlen. Manche bedecken den Statthalter mit Ruhm wegen seiner Liebe zu den Abendländern, und die gleichen Abendländer dürfen bloß den Fuß auf Egypten setzen, und er benützt, wie es am Tage liegt, jede Gelegenheit, um ihnen das Geld aus der Tasche herauszudrücken. Als Arzt hatte ich nur meine nothwendigsten Effekten mit einer Zugabe weniger Arzneien bei mir, und demungeachtet mußte ich den Inhalt des Felleisens in Alexandrien zweimal untersuchen lassen.
Wer sich mit Empfehlungsschreiben versieht, thut wohl daran. Die meinigen leisteten mir wesentliche Dienste, was ich auch dankbar anerkenne. Ich stellte mir etwas schwer vor, daß ich, als Ankömmling auf Afrika, in Mitte arabischer Zungen mich zurecht finden werde. Mein Erstes war, durch einen Araber geführt, meine Empfehlungsschreiben an einen Schweizer aus Schaffhausen abzugeben. Ich fand ihn — einen Freund; ich fühlte mich in seiner Nähe so traulich wie zu Hause. Er ertheilte mir zu Allem Anweisungen, deren ich so sehr bedurfte. In der Gesellschaft der Herren Ott, Wehrli, Wyß, Korvettenkapitäns Baumgartner, welche Schweizer sind, und des Oberarztes der Marine, Dr. Koch aus München, hatte ich erfreuliche Gelegenheit, die nöthigen Erkundigungen einzuziehen.
Wenn man einen entferntern Gegenstand besehen will, so bedient man sich am beßten eines Esels. Fiacres gibt es gar nicht und im Ganzen äußerst wenig Gefährte. Man kann aber auch zu Fuß gehen, was ich meistens that, und selten wurde ich von den Eseltreibern bestürmt. Diese fangen eigentlich nur an, in Jemand zu dringen, oder sich in den Weg zu stellen, und ihn so aufzuhalten, wenn sie ihm anmerken, daß er einen Esel sucht. Alsdann ist er augenblicklich von zwölf- bis zwanzigjährigen Leuten umringt, welche, laut lärmend, sich anbieten und so nahe sich andrängen, daß sie Einem die Kleider verunreinigen. Das unverschämte Andrängen war mir immer höchst widerlich, selbst wenn ich dadurch im beengten Raume nicht gehindert worden wäre, den mir beliebigen Esel und Treiber auszuwählen. Man schwingt sich endlich auf ein Thier, bloß um die Stürmer los zu werden; denn sobald man auf dem Esel sitzt, ändert sich die Szene, als wäre ein Licht ausgeblasen, — gänzliche Stille tritt plötzlich ein. Außer dieser Kriegslist schützt auch noch die Peitsche vor der Unverschämtheit. Einige Male folgten mir Eseltreiber, Esel voran, mit dem ermüdenden: Volete un’ buon’ burrico? weit nach. Ich kehrte rasch um, und dann wandelte ich wieder vorwärts. Es half wenig. Die Drohung mit der geballten Faust wies zu guter Letze die Meister in der Zudringlichkeit zurecht.
In einem halben Tage kann man das Sehenswürdigste finden. Man reitet zuerst zu den Katakomben, wo Leute aus den arabischen Hütten den Wißbegierigen unter die Erde führen. Von da zu dem Garten Ibrahim-Paschas, mit den Blicken über den See Mareotis. Weiter zu der Pompejussäule, zu den Obelisken und zuletzt zum Pharus. Für den Ritt nach den Katakomben, zur Pompejussäule und zu den Nadeln Kleopatras gibt sich der Eseltreiber mit vier Piaster zufrieden. Vielleicht verdienen auch die Ruinen der Athanasiuskirche und der Katharinakirche besehen zu werden.
Die Nilfahrt nach Kairo.
Linkische Lastträger; seichter Kanal; licentia poetica; Kornspeicher; Fruchtbarkeit des Nilthals; possirlicher Hühnerhandel; eine Abendunterhaltung; das Schlachten eines Lammes; Gewandtheit der Barkenknechte; die reisende Familie; Truppe nackter Kinder; Einerlei der Aussicht; Kaffeewinkel; Bewässerung des Landes; seltsame Schiffsladung; Pyramidenanblick; Telegraphen; Bulak; hôtel de l’Europe.
Freitags den 16. Weinmonat.
Ich schied von Alexandrien. Aus Rücksicht für die gute Gesellschaft mit einem Dragoman der französischen Regierung und einem jungen, piemontesischen Kaufmanne reisete ich nicht eher ab, wie ich vorhatte, ja ich ließ mich sogar lieber während dieses Tages bis gegen Abend ins Wirthshaus einsperren. Denn da die Cholera immer weiter um sich griff, und der Wirth keine Maßregel dagegen versäumen wollte, so unterstellte er sein ganzes Haus der Quarantäne. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ob die neue Ordnung der Dinge, z. B. der Einkauf von Lebensmitteln, das Parlamentiren vom Rastelle aus bei dem Besuche eines Freundes, mich mehr betrübte oder belustigte. Noch wunderlicher kam es mir vor, wie der italienische Wirth mich als Verpesteten behandelte, weil ich über Nacht Brechen und Anderes litt, und eine Zeitlang mich wirklich von der morgenländischen Brechruhr ernsteren Grades befallen glaubte. Die mit Reiswasser gefüllte Flasche übergab der kummervolle Italiener nicht mir unmittelbar, sondern mittelst eines vor meiner Zimmerthüre stehenden Geschirres, in welches die Flasche ging. In das Weise der Menschen flicht sich auch manchmal so viel Thörichtes, daß man oft nicht weiß, wo der Verstand aufhört oder anfängt.
Ich sorgte für einen kleinen Vorrath an Lebensmitteln, auch Holz, und zwar kaufte ich dieses nach dem Gewichte. Die eine Fürsorge ist vergeblich, und nur für Leckergaumen räthlich. Ueberall am Nil bekommt man gutes Brot, Hühner, Eier, auch Reis, und in den meisten Dörfern Milch, Alles in geringem Preise. Einzig Zitronen, Zucker und Rhum mögen nebst Kohlen und einem Kochofen dienen. Ich kann voraussetzen, daß der über Meer Gelangte auch ein Bett mit sich schleppe.
Von zwei Arabern wurde mein Gepäcke aus der Ankertaverne nach dem Mahmudiehkanal getragen, aber täppisch oder träge genug, indem dieselben, im Schweiße gebadet, die Bürde bald los- bald zusammenbanden, jetzt niederlegten, dann aufnahmen. Ich traf eben da meine Reisegefährten. Es sollte mein Gepäcke nur noch unter den bekannten Förmlichkeiten die Zolllinie überschreiten; ich bestieg das Fahrzeug, und wir stießen in den Kanal. Der Wind blies günstig. Bald verschwand die Pompejussäule aus unsern Augen — und der Tag.
Den 17.
Die Ufer des Kanals sind niedrig, oft wüst, genußarm. Der Kanal ist schmal, hie und da seicht, und Manche glauben, daß in kurzer Zeit der immer mehr anwachsende Niederschlag des Nilschlammes ihn unschiffbar machen werde. Dergestalt würde das glänzende Unternehmen Mehemet-Alis, den Nil mit der See Alexandriens zu verbinden, in Schatten sinken, nachdem es in aller Welt so hochgepriesen war.
Wir segelten einer französischen Dame voran. Vornehm steckte sie durch einen baufälligen Laden ihren Kopf heraus. Von einem Monsieur unserer Barke wurde sie nur befragt, ob sie des Nachts viele Flöhe gehabt hätte. Das war eine schlechte licentia poetica, aber eine natürliche. Gegenseitige Theilnahme an den Plagen ist wenigstens ein Erguß der Gemüthlichkeit.
Um Mittag langten wir in Atse an. Hier verbindet sich der Kanal mit dem westlichen Arme des Nils. Das Dorf mit seinen elenden, schwarzgrauen Hütten gleicht einem Ameisenhaufen, so viel Leben und Regsamkeit zeigt sich in dem Bassar und an den Stapelplätzen. In der Kornhalle, aber keinem Konterfei der Pariser, liegt das Getreide auf dem Boden an einem Haufen unter freiem Himmel. Der Kornhändler hockt auf dem Kornkegel und schmaucht mit aller Behaglichkeit eine Pfeife. Auf diesen Markt soll man nicht gehen, um Eßlust zu fördern. Solche Getreidemärkte besitzt auch das übrige Egypten. Die Kornspeicher stellen indeß andere Male einen, mit einer Mauer umfangenen, unbedeckten Platz vor. Ich wollte im Bassar eine Limonade trinken; allein den widerlichen Geschmack dieses mit Meth oder Melis zubereiteten Getränkes konnte ich nicht überwinden. Ich war noch nicht so weit in das Reisen eingeschossen, daß ich Alles verschlingen wollte. Im Bassar gewahrte ich eine Höckerin mit einem nackten Kinde, das an den Blattern litt. In Egypten hausen diese auf eine schreckliche Weise.
Billig nahm der Nil mit seinem weißgelblichen Schiller meine Aufmerksamkeit in Anspruch. So habe ich denn ein Ziel meiner Reise erreicht. Mit Recht danken dir, o Nil, die Bewohner des Landes, daß du die von dir überschwemmten Ländereien segnest. An andern Orten schadet im Gegentheile der Fluß durch Ueberschwemmung. In der Mitte zwischen den Quellen und Mündungen ist der Weltstrom am größten, und an andern Orten wird der Fluß um so größer, je näher er gegen das Meer anströmt. Nicht durch majestätische Größe, mehr aber durch den reißend schnellen Lauf zeichnet sich dieser Nilarm aus. Und welch’ eine Fruchtbarkeit der Nilufer! Alles keimt üppig, und man sieht der Natur an, daß sie mit der größten Leichtigkeit hervorbringt. Sie scheint den Bewohnern zuzurufen: „Nehmet von mir, so viel ihr wollet; denn ich ermüde nicht mit Wiedergeben.“ Der Karakter der Nilgegend ist eigentlich kein schwerer, sondern ein leichter, kein ernster, sondern ein frohmüthiger, ein jugendlicher. Das alte, das schon so oft und oft geerntete Land ist noch ein Kind.
Es war Mittag. Die Sonne brannte durch einen Flor atmosphärischer Dünste. Wir verweilten einige Stunden, weil die Waaren von unserer Barke auf eine andere umgepackt werden mußten. Gepäcke um Gepäcke aus den Händen legend, schrie der das Schiff beladende Araber Zahl um Zahl laut: für mich eine gute Gelegenheit, die arabischen Zahlen zu lernen. Bei diesem und andern Auftritten verging mir die Zeit leicht, doch angenehmer, als gegen Abend ein herrlicher Wind dahersäuselte, die etwas drückende Hitze zu mildern. In Atfe hält sich ein französischer Konsularagent auf, welcher uns besuchte.
Gegen die Neige des Tages stachen wir in den Nil. Die zwei lateinischen Segel schwollen lustig an, wie die Backen der Kinder, welche dem Aeolus ins Handwerk greifen wollen. Bald lagen wir vor der Stadt Fuah, in der ein Thurm am andern emporragt. Jetzt trat Windstille ein. Der Abend war lieblich warm. Die Leute vertrieben ihn mit Spiel und Tanz, und ich glaube zuversichtlich, daß sie wenig Empfänglichkeit für die Lehren unserer Mystiker gehabt hätten, nach denen das lachende Nilthal ein Jammerthal wäre oder hoffentlich werden sollte.
Sonntags, den 18.
Gegenwind. Das Schiff an einem Seile gezogen.
Ich kaufte drei Hühner für etwa 30 Kreuzer R. V. Man darf aber Eines nicht außer Auge setzen: die egyptischen Hühner erlangen keineswegs die Größe der unserigen. Eine Henne sieht aus wie bei uns ein junges Huhn. Es fiel mir zum ersten Male nicht wenig auf, wie eine Gluckhenne (von der Größe eines europäischen, halbausgewachsenen Huhns) sich bemühte, ihre so außerordentlich winzigen Küchelchen mit den Flügeln zu beschirmen. Hätte ein Säugling an die Brust eines zehnjährigen Mädchens sich geschmiegt, es wäre mir kaum spaßhafter vorgekommen. Auch die Eier der egyptischen Hühner sind bedeutend kleiner.
Ich nahm sofort meine angekauften Hühner zur Hand, wendete mich gegen das Nilufer und ging an diesem hinauf, um an einer vortheilhaften Stelle zu warten, wo ich wieder in den Kahn steigen könnte. Auf einmal verfolgte mich ein Weib wehklagend, juh, juh schreiend. Ich wußte nicht recht was es wollte; nur glaubte ich aus seiner Stimme und aus seinen Geberden entnehmen zu müssen, daß es wähne, ich hätte die Hühner ihm gestohlen. Schon umzingelten mich Leute, selbst von der Polizei; ich sollte mein Eigenthum abtreten. Was anfangen? Ich suchte durch Deuten verständlich zu machen, daß ich mich zur Barke begeben wolle, wo man Aufschluß ertheilen werde. Das Glück brachte gerade den Piemonteser. Meine Vermuthung wich der Gewißheit. Er sagte mir, das Weib habe seine Hühner bezeichnet, und ich solle sie ihm zeigen. Ich that es, und die Bestohlene — überzeugte sich sogleich von ihrem Irrthume. Das Weib war wenigstens moralisch so gut, daß es diesen eingestand. Es gehört zur Macht des Irrthums, wie kleine Zwiste, so selbst blutige Kriege zu entzünden, und ich durfte mich in der That glücklich preisen, daß aus diesem Handel nicht gar ein Krieg entsprang.
Wir rückten heute vor bis Mohalèt-Abu-Ali, einem Orte am Ufer des Delta. Nach einem nebelichten Tage war der Abend sehr schön und wie ergötzlich, das will ich in Kürze erzählen.
In diesem Dorfe wohnt eine Art Großer, welchem die Barken des westlichen Nilarms zugehören sollen. Er kannte den Vater des Piemontesen. Wir schickten ihm Rhum, oder er ließ vielmehr holen. Bald beehrte er uns selbst mit seiner Gegenwart, und trank den Rhum vor Aller Augen. Er erfreute die Gesellschaft zugleich mit einer blinden Sängerin. So wurde der Abend mit rauschendem Vergnügen, unter Sang, Tanz und Spiel verbracht. Wenn die Egypzier mit der Schalmei (Surna) und dem Tambur (Deff) spielen, so klatschen sie mit den Händen den Takt, manchmal unter dem Rufe Hamma. Mich belustigte das fröhliche Geberdenspiel. Man versicherte mich, daß die Sängerin ihre Rolle vortrefflich spielte. Es fesselte mich vor Allem das lange Pausiren, die vielen Molltöne und der Liebeston, eine Art Ach (a-a), der letzte, ersterbende Seufzer der Liebe. Dem Dragoman, einem mit den Sitten und der Sprache des Landes vertrauten Manne, schmeckte die Soirée überaus köstlich. Ich genoß dabei im Ganzen wenig. Weil ich die Nachtluft im Freien fürchtete, stellte ich mich bloß dann und wann, kein Vaterunser lang, unter die Thüröffnung der Kajüte. Ein Kind würde kaum scheuer, unter den Polizeiaugen des sparsamen Vaters, in den Honigtopf gelangt sein. Wenn die Araber mich auslachten, so hatten sie — Recht.
Ich lasse nun ein Verzeichniß der an den Nilufern gelegenen Ortschaften in der Reiheordnung folgen, wie wir an ihnen vorübergefahren sind.
Rechtes Ufer. Linkes Ufer.
Allah-uhu. Sanahbahdieh.
Schurafa. Iluieh.
Salamunih. Kaffer-Schech-Hasan.
Mahalèt-Malèk. Somchroat.
Dissuh. Rachmanieh.
Kaffer-Ibrahim. Margass.
Dimikunum. Miniet-Selamme.
Mahalèt-Abu-Ali.
Den 19.
Es wird ein Schaf von einem Manne auf dem Rücken in die Barke getragen: ein Geschenk von Seite des Barkeninhabers, der uns gestern Abend einen Besuch abstattete. Das schien mir echt morgenländischer Ton. Das Geschenk galt dem Piemonteser. Kurz darnach kam der Barkeninhaber mit seinem jungen Sohne. Sie ließen sich voller Würde am Borde nieder und wurden mit Kaffee bewirthet. Mich wunderte, wie gar der Junge sich so ernst, männlich und geschickt benahm. Mißtrauen wir doch nie dem vielvermögenden Einflüsse des Beispiels in der Erziehung. Vater und Sohn begleiteten uns eine Strecke weit, und ließen sich sodann ans Land tragen.
Bald ward das Schaf geschlachtet und zerhauen. Ein Jeglicher hoffte auf einen guten Bissen. Wir feierten munter die Ostern.
Die Barkenknechte sind Leute von erprobter Geschicklichkeit. Wenn, aus Mangel an Wind, die Barke am Seile geschleppt werden sollte, so nahmen sie die Kleider, wickelten diese zusammen, legten sie über den Kopf, sprangen ins Wasser, schwammen davon, bis sie waten konnten, und, ans Ufer gekommen, zogen sie, bisweilen ohne einen Faden am Leibe, das Schiff. So geschieht es bei Tage, wie bei Nacht, und nicht einmal selten. Auch dem aufsitzenden Fahrzeuge zu Hülfe springen die Amphibien ins Wasser, und heben mit Rücken und Händen die Barke vom Strande. Zu diesem Ende sind sie genöthigt, unterzutauchen, und bemerkenswerthe Zeit bleiben sie manchmal unter Wasser, um die Last zu bewegen.
Wir kamen an einem Landhause des Pascha vorbei.
Unsere Gesellschaft auf der Barke war zahlreich. Stelle man sich vor die gebieterischen Franken und die beugsame Mannschaft des Schiffes, ein Weib mit Kindern und einen alten, magern Kuppler, ein altes Weib neben einem jungen, welches Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, und seinen häßlichen, großen Mund mit Aengstlichkeit verbarg, und man hat das bunte Bild von unserer reisenden Familie. Beinahe aber hätte ich die liebenswürdige Puppe vergessen, welche, eher einer Vogelscheuche ähnlich, einem kleinen Mädchen viel Freude bereitete. Eine Mutter behandelte ihren Säugling mit einer Grausamkeit, welche dem zarten Geschlechte wenig zur Ehre gereicht. Wenn er weinte, so schlug sie ihm mit der Hand fort und fort auf den Mund. Das ist die liebenswürdige Kunst der Egypzierin das Weinen zu zerschlagen. Bei den arabischen Müttern überhaupt nahm ich wenig Zärtlichkeit für ihre kleinen Kinder wahr. Die Brust reichen sie zwar jeden Augenblick, aber, wie es beinahe scheint, mehr aus Gewohnheit und darum, weil sie selbst daran Freude finden, als weil sie solche den Kindern gönnen.
Die Beschreibung meines Zahnwehes dürfte Niemandem angenehm sein. Man wird lieber vernehmen, daß den Araber in der Regel schön weiße Zähne zieren, und daß er selten an Zahnschmerzen leidet. Das zweite Zahnen erfolgt bei den egyptischen Kindern in einem Alter von 6½ Jahren. Sogar ältere Leute erfreuen sich noch weißer Zähne. Es wird allgemein von den Franken behauptet, daß die arabischen Weiber früh altern. Dieß dürfte nicht so durchgängig wahr sein. Eben weil bei ihnen die blendend weißen Zähne lange erhalten werden, so erscheinen sie nicht besonders alt. Die Franken hätten auch bedenken können, daß die geringe Korpulenz, welche so gerne die Jahre multiplizirt, unter den Arabern jedes Alter begleite. Bis Tunup.
Rechtes Ufer. Linkes Ufer.
Dimènki. Kaffer-Osmann.
Kaffer-Megẻr. Sibréchît.
Saffiéh. Maéssra.
Móhalédié. Hali-Dächmèt.
Minidschéhnâ. Sibirîs.
Kaffer-Dówâe. Kaffer-Senâgli.
Génaht. Kaffer-Chadẻr.
Salhadschar. Niklé.
El-Kótabé. Dahrygieh.
Férahstak. Amié.
Mohallèt-el-Läbben. Kaffer-Ibn-Schäet.
Abîtsch. Kaffer-Laihs.
Kufur-Bilsẻ. Schabûr.
Kaffer-Hósâr. Sèlamûn.
Kaffer-Schech-Ali. Kaffer-Harimm.
Manûfur. Chäli-Dächmèt (Hali-Dächmet).
Kaffer-Sajàd.
Tschalgamûn.
Kufur-Haschasch.
Kaffer-Jukûb (Jabobsdorf).
Kaffer-Bâgi.
Kaffer-Tschèddid.
Kaffer-Mischléh.
Mischléh.
Sahyahra.
Tunup.
Den 20.
Am Ufer standen mehrere Bettler, die auch in andern Gegenden von Egypten nicht selten sind. Doch laufen oder rennen sie nicht so unverschämt nach, als in einigen Schweizer-Gauen. Wie in Europa, so spaziren hier die Fliegen auf Zucker. Man jammere nun aber nicht über den Fliegenschwarm, so lange man den Zucker nicht weghebt.
Die Reisebeschreiber erwähnen der Weiber die zahlreich in Krügen aus dem Nile Wasser holen. Ich sah sie sehr selten, und ihre Scheu vor den Männern konnte ich nicht bestätigen. Nichts weniger, als daß sie aus Zartgefühl mit ihren Händen das Gesicht verhüllten. Es muß seit einiger Zeit Manches anders geworden sein. Mich wundert, daß die Reisebeschreiber die ungemein geringe Menge Wassers nicht hervorhoben. Bei uns würde man ein Mädchen ausspotten, wenn es nur einen Krug voll Wasser holte. Man weiß, daß unsere Weibsleute große Gelten voll Wasser auf dem Kopfe oder an den Händen tragen.
An vielen Fellahs (Bauern) würde man vergebens mehr suchen, womit sie ihren Leib bedecken, als eine Lendenschürze. Ich fand jedoch wenig Unanständiges in dieser Kleidungsart, vielmehr etwas Vernünftiges in Beziehung auf die heiße Sonne. Gar viele Kinder, selbst größere, wandeln völlig entblößt herum. Der Anblick einer Truppe nackter Kinder unter freiem Himmel hat immerhin etwas Eigenes. Ihre auffallend großen Bäuche könnten sie wahrscheinlich mit andern Kindern theilen, wenn diese nackt ausgingen, und somit ihre Bäuche den Blicken zugänglicher würden.
Mir thut es leid, den Nilufern nachsagen zu müssen, daß sie, in die Dauer besehen, langweilen. Beinahe immer das nämliche Einerlei. Keine Hügel, keine Berge, keine Seen, dafür flaches Uferland, welches unmerklich in den Horizont verfließt. Selten stützt sich der Himmel auf eine Landlehne. Am Nilufer erblickt man zwar viele Dörfer, aber auch die sehen in der Regel einander beinahe gleich, wie ein Ei dem andern. Aus der Ferne verheißen sie eine seltene Pracht, schon bewundert man antike Paläste, über welche der schlanke Minaret emporsteigt; die runde Moschee füllt das Maß der Täuschung. Alles scheint in Palmen und Sykomoren gebettet. Ja recht viel Reiz in der Ferne, aber in der Nähe Kothhaufen als Mauern, enge, von armseligen Leuten betretene Gäßchen, krumme Minarets, kärgliche, von schönen Waschhäusern überbotene Moscheen. Nichts schmerzt so sehr, als fortwährend getäuscht zu werden. Einfacheres kaum, als ein Häuschen an den Nilufern. Ein viereckiges Zimmer ohne Fenster, mit einer Thüröffnung über dem Erdboden; das Dach platt; der Baustoff aus einer Art von Backsteinen, welche von Schlamm und Mist geformt und an der Sonne gedörrt werden. So die große Mehrzahl der Häuser. In Ghisahi bieten sie eine andere Gestalt. Sie erheben sich kegelförmig. Diese Zuckerhüte dienen den Tauben zur Wohnung.
Gegen Abend langten wir in Nadîr, einem Marktflecken, an. Hier sprach ich deutsch mit einem Hannoveraner, welcher auf einer andern Barke hergefahren war. In Kaffeewinkeln schienen zwei Frauenzimmer sich wenig zu freuen, daß der Vizekönig das berüchtigte Patent zurückgezogen hat. Der Aufenthalt der französischen Armee in Egypten, während dessen freier Verkehr unter den Leuten beiderlei Geschlechts gestattet war, so wie die vom Pascha ausgefertigten Patente lehren, zu welcher unsäglichen Ausgelassenheit der heiße Himmelsstrich führte. Der Vizekönig hat wohl weniger aus religiösen Gewissensbissen diese Patente zernichtet, als vielmehr aus dem Grunde gesellschaftlicher Ordnung.
Auf unserer Barke wurde mancher Spaß getrieben, mitunter auch solcher, welchen zu beschreiben die Feder sich weigert. Der Reis (Kapitän) schlug z. B. einen Barkenknecht. Er genießt übrigens das Recht, seine Leute zu schlagen, wenn sie sich gegen ihn vergehen. Ein Knabe von etwa zwölf Jahren wurde von Jedem, wer wollte, durchgeprügelt. Er bekommt als Barkenjunge monatlich fünf Piaster zum Lohne. Es gibt europäische Burschen, welche sich für 38 Kreuzer nicht so viel prügeln ließen, geschweige daß sie noch als Zugabe einen Monat lang arbeiten würden.
Die meisten Nächte brachte ich ziemlich gut zu. Das Schiff fuhr selten, und wenn es auch unter Segel ging, so gleitete es so sanft dahin, daß ich keine Bewegung verspürte. Alles, was ich während der Nächte erlauschte, war das Bellen der Schäferhunde, das Krähen der Hähne, das Quacken der Frösche und das eigene Pfeifen der Nachtvögel. Hingestreckt auf mein Bett in einem engen und dunkeln Winkel wurde ich, bei meinen Gedankenausflügen in die weite Ferne, durch die Laute jener Thiere an die Wirklichkeit meiner Lage erinnert.
Wir kamen heute bis Abu-Néschâbe.
Rechtes Ufer. Linkes Ufer.
Gómâsi. Nigil.
Amrûß. Sauüt-èl-Bacher.
Béstâma. Sawaff.
Sanüt-èl-Bagli. Machnîm.
Danasûr. Kóm-Scherîk.
Kaffer-Hédglâsi. Darîeh.
Gésiret-èl-Hagar. Abu-Chaui.
Nadîr. El-Gamm.
Schabschir. Dimischlé.
Dannaléhé. Buratschatt.
Ghisahi. Kaffer-Dahûd (Davidsdorf).
Sónsóft. Térânéh.
Kómmagnuß. Lèchmas.
Abu-Néschâbe.
Den 21.
Man würde irren, wenn man den egyptischen Himmel sich wolkenlos vorstellte. Beinahe alle Tage trübten Wolken den unserigen; einmal warfen sie uns so schwarze Schatten, daß der Europäer gewettet hätte, es müßte aus ihnen Regen platzen. Allein vor Nacht verstrich in der Regel das Gewölke.
Ich höre ein schwerfälliges Geknirre vom Ufer her. Was soll denn das? — Blindgebundene Thiere treiben in ihrem kreisenden Gange ein Wasserrad (Sakyeh). Das Wasser wird entweder mit einem fächerigen Rade oder mit an einem Rade befestigten Krügen aus dem Nile geschöpft und in einen Graben ausgeleert, welcher das Wasser dem Felde zuführt. Man begreift leicht, daß die Fächer oder Krüge unten am Rade aufwärts stehen, um so das Wasser zu schöpfen. Wenn das Rad sich halb um seine Achse gedreht hat, so stellen sich dieselben umgekehrt und gießen das Wasser aus. Das einige Schritte vom Nilufer abliegende Wasserwerk, zu welchem ein Kanal gegraben ist, besteht aber nicht bloß aus dem beschriebenen Schöpfrade, sondern noch aus zwei andern Rädern. Ein wagerechtes greift in ein kleines, perpendikuläres, welches mit dem Schöpfrade eine Achse hat. Das Thier, der Büffel z. B., zieht bloß an einem Stricke, womit das wagerechte Rad in Bewegung gesetzt wird. Diese Wasserräder sind meistens so einfach und mit so wenig Eisen zusammengehalten, daß sie nicht viel ausdauern. Es wird daher manche Zeit nur mit dem Nachbessern verloren. Mag meine Beschreibung des Paternosterwerkes auch ein wenig schwierig zu fassen sein, es ist doch die Wasserschöpfung so einleuchtend und so leicht zu bewerkstelligen. Als Aufseher oder Treiber faullenzt in der Nähe ein Knabe oder Mann, nie ein Weib; bei ihm steht eine kleine Kocheinrichtung. Den Treiber scheint kaum so viel Lust zur Arbeit anzuspornen, daß er beim Stillestehen des Thieres chòh chòh ruft, um es aufzumuntern. Nach den Gesetzen der strafenden Gerechtigkeit fällt dem Faullenzer das Leichte so schwer, als dem Arbeitssamen das Schwerste.
Das Wasser wird überdieß, ohne eine solche Vorrichtung von Menschen aus dem Nile geschöpft. An dem Arme eines Hebebaumes ist ein Gewicht, gegen das Land, — an dem andern der an einem Stricke befestigte Wasserkorb, gegen den Nil. Ein Mann schöpft, und das Gewicht des Hebebaumes hilft ihm den mit Wasser gefüllten Korb heben. Weil das Schöpfen und Ausleeren mit großer Schnelligkeit nach einander geschieht, so verliert dieses enge geflochtene Gefäß wenig Wasser. Gewöhnlich schöpfen, statt eines, zwei Männer neben einander, die Gesichter sich zuwendend, fast nackt, vom Wasser benetzt, von der Sonne gebrannt und so fleißig, daß sie kaum sich umsehen, wenn ein Schiff vorübersegelt. Sie bilden den schroffen Gegensatz zu den Thierhütern an den Wasserrädern und zu andern arbeitsscheuen Arabern. Es geschieht wohl auch, daß, ohne weitere Vorrichtung, ein Mann mit einem Korbe aus dem Nile Wasser schöpft und in einen Kanal ausschüttet. Wenn die Egypzier freilich so viel Stammholz besäßen, wie die Europäer und Amerikaner, so würden sie unzweifelhaft ihre Körbe an wasserdichte Kübel vertauschen. Eine Menge Wassergräben durchkreuzen netzweise die Feldereien, damit diese überall bewässert werden. Daher die kleinen Feldbeete, ähnlich unsern Gartenbeeten. Gewöhnlich zieht man bei uns Gräben, um das Wasser abzuleiten, bei den Egypziern aber, um dasselbe zuzuleiten. Es wäre voraus zu sehen, daß die egyptischen Gräben nicht tief sein dürfen, während ihnen in Europa, wo man dem Wasser Abfluß verschaffen will, die entgegengesetzte Eigenschaft zur Tugend angerechnet wird. Wenn man in Egypten das Wasser nicht mehr in ein Beet fließen lassen will, so wird, vermittelst der Hände, der Graben mit Koth und Schlamm zugedämmt. Um einen Begriff zu geben, wie stark die Pflanzen unter Wasser gesetzt werden, so stand der Mais, welcher hier blühte, dort klein war, hie und da einige Zoll hoch in zugeleitetem Wasser.
Die Bewässerung ist die Hauptarbeit, welche der Boden erfordert. Sicher bereitet sich der egyptische Bauer mit Wasser, sofern, im seltenen Falle, der Nil es ihm weder zu reichlich, noch zu sparsam zutheilt, den Feldsegen. Der europäische Bauer schwankt wie der Segelmann. Will dieser glücklich fahren, so muß günstiger Wind wehen; will jener ernten, so muß lauer Regen das Feld netzen. Der Wind aber, wie der Regen, kommen von der unsichtbar waltenden Hand, welche kein Sterblicher zu leiten vermag. Und wenn auch dem europäischen Bauer ein lauer Regen Segen zuwinkt, ach, es muß ihn noch bangen, daß das Wasser des Himmels nicht durch Ueberschwenglichkeit, oder daß kein harter Frost, kein schwerer Hagel die Hoffnung auf Ernte vereiteln. Wenigstens kann kein Hagel die Hoffnung des egyptischen Fellah zernichten.
Neben dem Bewässerungsgeschäfte sind Säen, Hacken oder Pflügen und Ernten die Arbeiten des Ackerbauers. Man machte mir die Mittheilung, daß, wenn das Ueberschwemmungswasser ganz niedrig stehe, bloß der Same auf das Wasser ausgestreut werde. Mit dem Versiegen des Wassers, hieß es, ziehe sich der Same in die Erde, und man dürfe nur die Ernte abwarten. Das erzähle ich einem Franken nach; ich will nun aber dessen gedenken, wovon ich selbst Zeuge war. Ich sah säen und hacken oder pflügen. Sobald das Wasser verschwunden war, wurde der Same mit einer krückenförmigen Hacke oberflächlich unter die Erde gebracht oder viel eher gescharrt. Ich glaube nicht, daß die Hacke sechs Pariser-Zoll tief griff. Der Pflug, welchen ich genauer ins Auge faßte, hatte nur ein Sech, keine Schar. Er ging nicht tief, und ließ eine undeutliche Furche zurück. Es konnte mit diesem Pfluge lediglich bezweckt werden, die Erde etwas durch einander zu wühlen. Zwei Thiere zogen ihn, jedes an einem Stricke, welcher am Halse festgemacht war.
Von den Ackergewächsen erwähne ich einzig des Hanfes und der Baumwollpflanze. Der Hanf wird sehr hoch, ja manneshoch und riecht gewürzhaft. Wegen seines angenehmen Geruchs ist es eine Lust, in der Nähe eines Hanffeldes zu wandeln. Eben bereitete er sich zum Blühen vor. Ohne an mein Vaterland mich zu erinnern, wo die Baumwolle mit vielem Fleiße verarbeitet wird, konnte ich den merkwürdigen Pflanzenstengel nicht betrachten. Dieses Gewächs bedeckt ungeheure Strecken des Delta. Es wuchs gleichsam vor den Augen beinahe durch alle seine Entwickelungsperioden heran: Hier Knospen, dort Blüthen, hüben Kapseln, drüben Wolle, gerade so, als würden alle Aufzüge und Auftritte eines Schauspieles auf einmal sich aufrollen.
Wenn der Herr des Himmels und der Erde ein besonderes Füllhorn des Segens über das Egyptenland ausgegossen zu haben scheint, so wird befremdlich, daß das Wenigste dem Bauer angehört, was er dem Boden abgewinnt. Den Stoff zur Kleidung, welche er sich verfertigt, verkauft er an den Pascha, und dieser gibt ihn um die Hälfte theurer zurück. Der Fellah darf keinen Faden am Leibe tragen, wenn er ihn nicht dem Pascha, dem ersten Kaufmanne in Egypten, abgekauft hat. Die ganze Last von Baumwolle drängt sich in die Hand des Vizekönigs zusammen, welcher damit allein Handel treibt. Kurz, die Bauern sind nur Lehenbauern. Der Pascha ist der Grundherr, der Grundbesitzer des Landes, und dieses Verwaltungssystem bewirkt, daß der Fellah, unter dem Drucke des Monopols, selbst zur frohen Erntezeit seufzet. Es ist seltsam, daß noch kein fränkischer Ulema die Härte des Pascha darum vertheidiget, weil sie dem rechtgläubigen Bauer den Anlaß gebe, sich um so inniger nach den Freuden des ewigen Lebens in dem immergrünen Garten zu sehnen.
Wir begegneten einer Schiffsladung getrockneter Mistfläden. Wo das Holz, wie hier, so theuer ist, läßt man sich selbst den Gebrauch solcher Dinge gefallen; sie dienen als Brennstoff, und kann der Abendländer glauben, daß sogar mit dem Eckelhaftesten vom Menschen geheizt wird? und wenn es der St. Louisianer in Amerika glaubte, würde er sich nicht davor entsetzen, da er nicht einmal die Milch von einer Kuh genießt, welche Gras von einer mit Hausjauche besprengten Wiese fraß?
Ueber Warnâm begann rechts die Düne; links Weideland und Hirtenzelte. Ich erging mich an einer Herde schwarzer Büffel. Dieses Thier ist für Egypten gar nützlich. Der Büffel hält sich sehr gern im Wasser auf, auch liegend und wiederkauend. Es ist kurzweilig, zu sehen, wie er über das Wasser schwimmt, um an den Ort zu gelangen, wo er zu übernachten pflegt. Der behende Hirte schwingt sich wohl auch auf den Rücken des Thieres, das ihn schwimmend ans Land trägt.
Erst von Schmûn aus erblickte ich die Pyramiden von Gizeh. Sie halten mit der aufragenden Düne gleiche Höhe, und ich hielt sie zuerst für Schiffssegel, vielleicht weil ich kurzsichtig (myops) bin. — Bis Abu-èl Gheied.
Rechtes Ufer. Linkes Ufer.
Samüt-Rosiéh. Èl-Chatabẻ.
Sagiéh. Bini-Sèlâmé.
Tagwueh. Awlatt-Fèradsch.
Èl-Hamum. Dé-Rîß.
Karfòrtereiné. Wardàn.
Munsi. Abu-Ghalibb.
Èl-Manschîé. Èl-Katta.
Dschures. Gisahijeh.
Abu-Awuali. Niklé.
Sidi-Ibrahîm.
Schmûn.
Tâlié.
Gawâdi.
Èl-Baraniéh.
Èl-Gonamiéh.
Mimèt-èl-Arûß.
Kaffer-Mansûr.
Schaschâ.
Schatanỏff.
Darawû.
Schalakan.
Charabaniéh.
Abu-èl-Gheied.
Donnerstags den 22. Weinmonat.
Die Nachricht, daß wir in der Nacht an der Spitze des Delta vorüberfuhren, betrübte mich zum Theile, weil ich von ihr nichts sah. Des Morgens lagerte ein wenig Nebel, der aber bald sich verzog. Durch die Vereinigung der Nilarme erscheint der Nil kaum breiter, wohl aber geben ihm zahlreichere Schiffe mehr Leben. Der Berg Mokatam, links oben die westliche Kuppe des arabischen Gebirges, der Basanites Lapis der Alten, an dessen Fuße Kairo sich ausbreitet, brachte angenehmen Wechsel in die Aussicht. Seit einiger Zeit mußte ich den Anblick eines höhern Hügels entbehren, und darum ruhte auf jener Kuppe mein Auge mit besonderm Wohlgefallen. Man fühlt eine gewisse Leere in der Seele, wenn liebgewonnene größere Eindrücke auf längere Zeit keine Nahrung finden, und ein neues, erquickliches Aufleben durchzuckt das Innere, wenn liebe alte Eindrücke durch verwandte neue in einem Male aufgeweckt werden. Mittlerweile wuchsen die Pyramiden immer stattlicher heran.
Meine Reise fiel in die Ueberschwemmungszeit. Die Wasser, wiewohl im Fallen, strömten doch noch in ziemlicher Höhe, ein Umstand, der für uns gerade günstig war, da bei niedrigem Wasserstande das Fahrzeug leicht strandet; denn es kostet oftmals viel Anstrengungen, bis es flott wird.
Eine neue Erscheinung für Egypten sind die Telegraphenthürme. Dann und wann unterbrechen sie während der Nilfahrt die Gleichförmigkeit der Aussicht. Für ein Zeichen der höhern Kultur mochte ich sie eben nicht ausgeben, und wahrscheinlich thun sie ihr nicht den leisesten Vorschub. Dem Europäer mögen sie Vergnügen gewähren, indem sie ihn an das Land seiner Väter zurückmahnen, und indem er sich aufs neue der Wahrheit bewußt wird, daß nun Europa mit seinem Tochterlande Amerika den eigentlichen Brennpunkt der Wissenschaften und Künste, der Entdeckungen und Erfindungen bildet. Vielleicht kommen die Telegraphen, die schnellen Ueberbringer oberherrlicher Befehle, in Egypten der seidenen Schnur trefflich zu Statten.
Links sahen wir noch nach Schubbra, welches sich eines vizeköniglichen Gartens von seltener Schönheit rühmt, und an einer Stadt ergötzte sich das Auge schon von Ferne her. Es war Bulâk, in dessen Hafen wir bald einliefen.
Rechtes Ufer. Linkes Ufer.
Galiubb. Burgaschi.
Basûß. Errahauwi.
Mid-Halfé. Òm-dinâr.
Damanhur. Dikelkó.
Schubbra. Èl-Achsâß.
Minièt-èl-Sirik. Dschaladmé.
Gésiret-èl-Batrân. Hassan-inn.
Bulâk. Èl-Górótin-Hin.
Russim.
Sigîl.
Tanâsch.
Gésiret-Mohammet.
Waran.
Embâbé.
Wir langten in Bulâk eben in der größten Sonnenhitze an, und wir konnten zwischen der großen Menge von Kähnen uns nur mit Mühe Platz verschaffen, auf daß wir das Ufer erreichten. In Atfue zerschmetterten wir beim Anlanden den Hintertheil einer Barke, ohne daß es viel Krieg absetzte.
Unsere Barke war nicht schön, doch gut. Der europäische Holzarbeiter würde an ihr Manches ausgesetzt haben. Dafür leistete sie reichlichen Ersatz mit Mäusen und andern Plaggeistern. Ich wußte mehr als einmal beinahe nicht: Wo wehren? In der Kajüte stand, nach der Uebersetzung des französischen Dragoman, an der Wand auf arabisch, daß man sich den Verordnungen zu unterziehen habe. Etwa den Verordnungen dieser Unholden? Ueber unserer Barke schwebte die dreifarbige Flagge der Franzosen.
Nachdem meine Effekten untersucht waren, wurden sie auf einen Esel gepackt, und einen andern bestieg ich. An hohen Häusern, zwischen denen angenehme Kühlung herrschte, ritt ich vorüber, und bald war ich außerhalb der Stadt. Jetzt, im Freien, erblickte ich das große Kairo, ehedem das Kahira, jetzt das Maser des Arabers. Ergreifendes Schauspiel. Keine halbe Stunde mehr, und ich befand mich in den Ringmauern der Hauptstadt. Da verließen mich die beiden Franken, und, mit einem Eseltreiber allein, zog ich fürbas. Kairo machte gleich Anfangs einen ungemein günstigen Eindruck auf mich. In dem Wirrwarre von Häusern und Gassen folgte ich getrost der Führung des Eseltreibers. Er hätte mich in eine Casa di Diavolo verführen können. Ich wollte freilich nicht dahin, sondern ins Quartier der Franken (el-Musky), die übrigens in Kairo vielmehr zwischen den Mohammetanern zerstreut leben, als in Alexandrien. Lange ritt ich durch Gassen und Gassen, jetzt krumm herum, dann gerade dahin, ohne daß ich einem Abendländer begegnete. Ich war auf dem Punkte, Zweifel zu fassen, daß mein Geleitsmann das Quartier der Franken wisse. Auf einmal bog er um, und ich erblickte Hüte. Ich war richtig im Quartiere; umsonst aber suchte ich die Lokanda, die man mir empfahl. Und kurzen Prozeß, — ich ritt zum ersten besten Wirthshause.
Der Wirth des Hôtel de l’Europe wies mir ein gefälliges und hohes Zimmer an; aber kaum sah ich mich recht um, so fand ich ein Licht ohne Glasfenster. Das fiel mir schwer; denn bei offenem Fenster wollte ich nicht schlafen. Dem Uebel war auch bald geholfen; der Gastgeber eröffnete mir ein anderes Zimmer, welches mit Thüre und Fenster gesperrt werden konnte. Die heimatlichen Gefühle erneuerten sich, als wäre ich in einem Gasthause des Abendlandes; eine Mousquetiere (Vorhang um das Bette, gegen die Stechfliegen) und eine gute, reine Bettung ließen mit Recht eine süße Schlafnacht erwarten. Man lernt den ruhigen Genuß des Schlafes erst recht schätzen, wenn man desselben, sei es durch die Plage des Ungeziefers, oder durch andere störende Einflüsse, eine Zeitlang beraubt war.