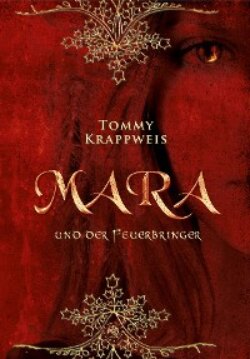Читать книгу Mara und der Feuerbringer - Tommy Krappweis - Страница 11
Kapitel 6
ОглавлениеHinter dem Professor betrat Mara durch die große Glastür zwischen den Säulen die Universität. Instinktiv duckte sie sich vor der zu erwartenden Düsternis! Gleich würden sie auch unzählige längst verstorbene Professoren aus düsteren Bildern mit strengem Blick anstarren, als würden sie fragen: »Was machst du denn hier, kleines Mädchen? Weißt du denn nicht, dass diese Universität nur für Studenten ist und für bärtige Professoren in Cordhosen, die Papierstapel durch die Gänge tragen und dabei laufend lose Blätter verlieren?«
Umso überraschter war sie über das helle grellweiße Licht, das die große Halle erfüllte, in der sie nun stand. Als sie nach oben sah, musste sie sogar die Augen zusammenkneifen. Das Licht fiel gleißend hell durch eine Art gläserne Kuppel hoch über ihren Köpfen und wurde noch verstärkt vom weißen Stuck an der hohen Decke.
Dem Professor schien erst jetzt bewusst zu werden, dass Mara dieses Gebäude wohl zum ersten Mal betrat. Er kam die paar Schritte zurück, die er die große Freitreppe bereits hinaufgestiegen war.
»Ja, das ist der sogenannte Lichthof, der seinen Namen ganz offensichtlich zu Recht trägt. Dort hinten ist der Aufgang zu unserem Auditorium maximum, dem größten Hörsaal in der Uni. Aber wir gehen jetzt hier hinauf in den zweiten Stock und dann rüber in den anderen Trakt.«
»Ich dachte, Ihr Büro ist gleich hier oben?«, fragte Mara.
»Das ist es auch«, antwortete der Professor. »Zumindest im Vergleich zu so manch anderem Büro hier. Die Universität München ist riesengroß. Sie erstreckt sich über mehrere Straßen und dies hier ist nur eines von über zwanzig Gebäuden. Allein in diesem Teil der Universität gibt es den Adalbertstrakt, den Dekanatstrakt, den Senatstrakt, den Amalientrakt und den Bibliothekstrakt. Wir gehen jetzt in das sogenannte Gartengebäude. Und bevor du dir nun einen Schreibtisch in einer Gartenlaube vorstellst, solltest du wissen, dass dieses Gebäude wiederum über drei Geschosse plus drei Zwischengeschosse und drei Innenhöfe verfügt.«
Mara malte sich kurz aus, wie sie auf der tagelangen Suche nach Professor Weissinger irgendwo in den endlosen Hallen und Gängen elend verdurstet wäre. Doch sie erlaubte sich, diese Vision aus ihrem Geist zu vertreiben.
Visionen. Na wunderbar, ich hab wieder dieses Wort benutzt, dachte Mara, als sie dem Professor durch die vielen Gänge, Doppeltüren und Treppenhäuser folgte. Visionen war eins von Mamas Lieblingswörtern. Dauernd hatte irgendeine von ihren Wicca-Frauen irgendwelche Visionen – meistens davon, dass irgendeine Stimme ihnen einflüsterte, dass sie doch »endlich mal an sich selbst denken« sollten oder »sich auch mal was gönnen« dürften. Praktische Sache, so eine Vision, wenn sie immer genau das aussprach, was man gerade am liebsten hören wollte. Auch Mama hatte schon oft Visionen gehabt: zum Beispiel davon, dass Papa zurückkommen würde, weil er eingesehen hatte, dass sie immer schon recht gehabt hatte und es ein großer Fehler gewesen war, sie zu verlassen.
Vor allem im ersten Jahr nach der Trennung hatte sie Mara sehr oft davon erzählt.
Als Mara noch jünger gewesen war, hatte sie sogar daran geglaubt und gehofft, dass Mama diesmal die Wahrheit vorausgesehen hatte.
Doch dann verging das Jahr, schließlich zwei, drei … und Papa war immer noch nicht wieder da. Und das, obwohl Mama inzwischen schon unzählige weitere Visionen, Zeichen und Orakeldeutungen angeführt hatte, die letztlich alle das Gleiche aussagten: Papa kommt zurück. Ganz sicher. Diesmal wirklich. Demnächst. Bald.
Mittlerweile wusste Mara nur eines ganz sicher: Wenn sie selbst irgendwann mal eine Tochter hätte, dann würde sie ihr nur Dinge versprechen, die sie auch halten konnte.
Was ihre Mutter wohl denken würde, wenn Mara ihr erzählte, dass sie sich neuerdings mit Pflanzen unterhielt und Visionen hatte? Na ja, eigentlich hatte sie die ja immer schon gehabt. Nur haben wollen hatte sie die Visionen eben nicht.
Und jetzt das.
Spákona.
Was sollte sie dem Professor eigentlich erzählen? Alles? Nein, auf keinen Fall. Wer glaubte schon einem vierzehnjähriges Mädchen? Und dann auch noch so etwas Unglaubliches. Andererseits war sie doch genau deswegen hergekommen, oder?
Nein, sie würde den Professor jetzt einfach ausfragen über alles, was sie wissen musste, und dabei möglichst wenig über sich erzählen. Oder gar nichts. Und auch nichts über Mama. Genau, das war ein toller Plan!
Zufrieden nickte Mara und stellte im selben Moment fest, dass sie damit wohl gerade irgendetwas bejaht haben musste, denn der Professor sagte: »Na, dann hol ich dir mal einen, bin gleich wieder da!«
Mara blieb allein zurück, vor irgendeiner Tür in irgendeinem Gang in irgendeinem Stockwerk in irgendeinem Gebäude.
Doch gerade als sie spürte, wie ihre Fingernägel sich anschickten in den Handballen bleibende Spuren zu hinterlassen, hörte sie vertraute Geräusche: klimpernde Geldstücke in einer Hosentasche, klickendes Einwerfen von Münzen und ein Tastendruck. Danach ein Summen und ein leises »Sch-Blunk«, gefolgt von einem Geräusch, das klang, als würde jemand in einen Plastikbecher pinkeln.
Professor Weissinger kam mit einer heißen Schokolade auf Mara zu.
»Ich frage mich manchmal, warum diese Kästen immer Kaffeeautomat heißen, obwohl sie alle möglichen Arten von Heißgetränken ausspucken«, sagte er und grinste, als er ihr den Becher reichte.
»Vielleicht weil Schokolade-Kaffee-Tee-und-Rinderbrühe-Automat zu lang ist?«, antwortete Mara und meinte es gar nicht so witzig, wie es offensichtlich beim Professor ankam.
»Hahaha, ja, das kann sein. Und vielleicht weil Diverses-heißes-Gebräu-Automat nicht gerade appetitlich klingt.«
Der Professor trat an Mara vorbei an die Tür und steckte einen der Schlüssel von seinem dicken Schlüsselbund ins Schloss. Nachdem er den Schlüssel dreimal herumgedreht hatte, zückte er einen weiteren Schlüssel und steckte ihn in ein kleines Vorhängeschloss. Und als Mara dann endlich einen Blick in das Büro werfen konnte, wusste sie auch, wofür das zusätzliche Schloss war: Der Professor wollte die Putzfrau aussperren.
Dies war auf jeden Fall der kleinste Raum mit den meisten Büchern, Ordnern und Papierstapeln darin, den Mara jemals gesehen hatte.
»Jaja, ich weiß«, sagte Professor Weissinger, während er sich zwischen den Stapeln hindurchmanövrierte, ohne auch nur einen einzigen der Türme ins Wanken zu bringen. »Aber ich warte jetzt seit vier Monaten auf ein größeres Büro und sehe nicht ein, warum ich hier noch mal aufräumen soll, wenn ich vielleicht schon morgen alles wieder in Pappkartons packen muss. Bitte versuch so wenig wie möglich durcheinanderzubringen.«
Keine Sorge, dachte Mara. Dieses Zimmer kann man gar nicht noch mehr durcheinanderbringen. Trotzdem achtete sie sehr darauf, nichts zu berühren.
Andere Besucher waren dabei offensichtlich weniger erfolgreich gewesen. Ein paar Haufen zeigten deutlich, dass hier bereits die eine oder andere Papierlawine niedergegangen war und tiefer gelegene Notizblock-Dörfer und Post-it-Ortschaften unter sich begraben hatte.
Professor Weissinger umrundete einen der Papier-Gletscher und ließ sich dann mit einem leisen Seufzer in einem abgewetzten Ledersessel nieder. Gleichzeitig zeigte er Mara an, die Tür zu schließen. Dann seufzte er noch einmal und legte gemütlich die Beine auf einem der Bücherstapel ab, als wäre es ein Couchtisch.
»So«, sagte der Wissenschaftler und musterte Mara mit seinen wachen Augen. »Mach es dir bitte bequem.«
»Danke«, sagte Mara und setzte sich auf den Papierhaufen, unter dem sie den Besucherstuhl vermutete. »Oh, und danke für die Schokolade.«
»Hast du sie schon probiert?«, fragte der Professor und Mara schüttelte den Kopf.
»Dachte ich mir schon, denn sonst hättest du dich nicht bedankt. Aber jetzt zu dem Grund deines Besuchs. Du hast mir da vorhin ein paar sehr seltsame Fragen gestellt, Mara Lorbeer aus der Au. Und ich bin von meinen Studenten wirklich einiges gewöhnt.«
»Tut mir leid«, sagte Mara kleinlaut. »Ich wollte nicht …«
Doch der Professor winkte sofort ab: »Aber nein, du musst dich nicht entschuldigen! Es tut mir leid, wenn ich dich angestarrt haben sollte wie ein Gummistiefel.«
Auch schön, dachte Mara, aber ich fand das Sofakissen trotzdem besser.
»Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du darauf gekommen bist«, fuhr der Professor fort. »Wie zum Beispiel auf die Frage nach der Frau mit Holzschale im Loki-Mythos. Das ist zugegebenermaßen schon recht ungewöhnlich, wenngleich auch einfach zu beantworten … Oh, entschuldige, vielleicht nimmst du erst mal auf dem Besucherstuhl Platz, denn du sitzt auf den Klausuren meiner Studis … ja, genau, der Stapel daneben, da ist er drunter oder war es zumindest mal … komisch, na ja, dann setz dich doch wieder auf die Klausuren, denn die erleben sicher noch Schlimmeres, wenn ich erst mal mit den Korrekturen anfange … So, und jetzt erzählst du mir erst mal, wie du auf diese Fragen gekommen bist.«
Oh nein!, dachte Mara panisch, bis eben ist es doch so gut gelaufen. Er hat schon von selbst angefangen, über Loki zu reden, und jetzt das! Ich soll was erzählen! Von mir! Was mach ich denn jetzt?
Sie blickte kurz auf. Der Professor wartete immer noch! Mann, hatte der eine Geduld! Mist!
Okay, ich muss ja nicht alles erzählen! Ich lass die seltsameren Momente weg und erzähle nur die weniger seltsamen!
Doch sofort fiel Mara auf, dass sie sich an keinen einzigen weniger seltsamen Moment erinnern konnte. Also tat sie weiter das, was sie eh schon tat: Sie schaute auf den Boden und schwieg.
Der Professor wartete noch weitere ewige fünfzehn Sekunden. Dann seufzte er.
»Darf ich dein Schweigen derart auslegen, dass du mir nichts über dich erzählen möchtest?«, sagte er und klang dabei nicht im Entferntesten vorwurfsvoll.
Mara nickte nur stumm.
»Hm, da kann man wohl vorerst nichts machen. Mal sehen, vielleicht erzählst du es mir ja ein andermal. Also widmen wir uns erst einmal dem Loki. Einen Moment bitte.«
Professor Weissinger wendete sich ab, um in dem Stapel neben sich nach etwas zu wühlen.
Mann, stell ich mich grad blöd an!, schimpfte Mara sich selbst in Gedanken. Trotzdem konnte sie einfach nicht anders, sagte weiterhin kein Wort und zog dabei ihren Mund zusammen, als hätte sie in eine Zitrone gebissen.
Als der Professor mit einem abgegriffenen Buch in der Hand wieder auftauchte, blickte er verwundert in Maras verkniffenes Gesicht.
»Hast du jetzt doch den Kakao probiert?«, fragte er, während er in dem Buch blätterte und recht schnell fand, was er suchte. Der Professor hielt Mara das Buch aufgeklappt entgegen. »Kommt dir hier etwas bekannt vor?«, sagte er und versuchte dabei besonders beiläufig zu klingen, was ihm gerade deswegen nicht einmal ansatzweise gelang.
Mara sah eine Doppelseite mit einem Bild vor sich, auf dem die Zeichnung eines grinsenden Mannes zu sehen war.
Das Bild war in Braun und Rottönen gehalten und wirkte irgendwie sehr alt. In der linken oberen Ecke stand irgendetwas in einer seltsamen Schrift und in einer Sprache, die Mara nicht verstand. Um den Text war ein Rahmen gezogen. Der Mann auf dem Bild schien auf die Schrift zu blicken, denn obwohl sein Körper nach rechts gedreht wirkte, war der Kopf rückwärts gewandt. In der erhobenen Hand hielt er eine Art Seil mit einer Schleife oder einem Knoten am oberen Ende. Das Seil hing herab und endete an einem Gitter oder eher einem grobmaschigen Netz, das hinter dem Mann ausgebreitet war.
Mara betrachtete die Figur genauer. Der Kopf war nur von der Seite zu sehen. Mara erkannte einen hellen Bart, der zu mehreren Spitzen zusammengedreht war, und eine ziemlich lange Nase, die fast wirkte wie die einer Kasperlpuppe. Die Mütze, die weite Kleidung mit den gelb-roten Streifen, das Grinsen … alles irgendwie kasperlhaft. Doch da blickte sie dem Mann in das eine sichtbare und tiefschwarze Auge und wusste sofort, wen sie da vor sich hatte! Und bevor sie seinen Namen aussprechen konnte, verlor sich Mara auch schon in der äußerst unkasperlhaften Schwärze der Pupille …
Mara sah sich um und erschrak nicht, als sie das Wasser sah, das sich vor ihr im Nebel verlor. Sie wunderte sich auch nicht besonders über den hölzernen Steg, auf dem sie lag. Unter dem Steg zog ein Fluss vorbei und Mara hörte das Plätschern des Wassers, das die roh behauenen, dicken Pfähle umspülte, auf denen der Steg im Flussbett stand.
Es ist nur eine Vision, murmelte Mara sich selbst zu. Nur eine Vision. Ich bin nicht wirklich hier. Und gleich, wenn ich wieder die Augen aufschlage, werde ich im Büro des Professors sein. Wo ich die ganze Zeit war. Und immer noch bin. Das ist einfach wie im 3-D-Kino, nur ohne die doofe Brille!
Oje, vermutlich war sie inzwischen wieder umgekippt wie die beiden Male zuvor. Hoffentlich würde Professor Weissinger keinen Arzt rufen oder so etwas.
Wenigstens falle ich auf dem Papierkram weicher als vorhin auf den Pflastersteinen vor der Uni, dachte sich Mara und fand sich dabei sogar fast ein bisschen … na ja … cool.
Doch als sie plötzlich merkte, dass sie nicht allein war auf dem Steg, schmolz ihre Coolness dahin wie Scheibletten-Käse auf einem Toaster: Direkt vor ihr am Ende des Stegs stand ein Mann. Er hatte den Rücken zu ihr gedreht und raffte mit ausladenden Bewegungen ein Fischernetz zusammen. Mara hatte keine Zweifel, wer der Mann vor ihr war, und sofort ging ihr Atem schneller.
Er kann mich nicht sehen, auch wenn er sich umdreht. Die anderen Male hat mich auch keiner gesehen, oder? Also ganz ruhig, er kann mir nichts tun, weil er gar nicht weiß, dass ich da bin, dachte Mara. Trotzdem stand sie nicht auf, sondern blieb erst mal auf den Planken sitzen. Nur zur Sicherheit.
Der Mann trug eine Art Kleid aus grober Wolle oder vielleicht Leinen. Es war dunkelrot gefärbt, aber viel unregelmäßiger, als Mara es von ihren Klamotten kannte. Das eher schmucklose Kleidungsstück reichte ihm bis über die Knie und war über der Hüfte gerafft mit einem Gürtel, an dem ein auffallend verzierter Dolch in einer Scheide befestigt war. Seine Beine waren mit einem ähnlich groben Stoff umwickelt, der von Lederbändern an den Waden gehalten wurde.
Mara konnte nicht umhin, sich kurz vorzustellen, wie fürchterlich das jucken musste! Ihr selbst waren ja schon gestrickte Mützen unerträglich. Vor allem, wenn ihre Mutter sie gestrickt hatte, denn dann kratzten sie nicht nur – sie sahen auch noch doof aus.
Der Mann sah das vielleicht genauso, denn eine Mütze trug er nicht. Dafür war sein langes blondes Haar zu einem kunstvollen Knoten geformt. Seltsamerweise trug er ihn aber nicht am Hinterkopf, sondern an der Seite, knapp über dem rechten Ohr. Käme Mara mit einem solchen Haarknoten über dem Ohr in die Schule, wären sogar noch in Australien die Leute auf die Straße gelaufen, um nachzusehen, woher das Gelächter kam.
Der Mann warf nun sein riesiges Fischernetz hinaus in den nebligen Fluss. Mara runzelte die Stirn. Sie wusste zwar nicht genau, wie man als Fischer ein Netz auszuwerfen hatte, aber das sah irgendwie anders aus. Der Mann wirkte nämlich überhaupt nicht wie jemand, der diese Bewegungen schon Hunderte von Malen gemacht hatte, sondern eher wie … Mara überlegte. Irgendwo hatte sie dieses komische Gehabe doch schon mal gesehen …
Und da fiel es ihr plötzlich ein: Im Fernsehen! Genau, der Mann erinnerte sie an die aufgedonnerten Grinsebacken aus den Dauerwerbesendungen. Er wirkte, als wolle er sich selbst und der Welt besonders eindrucksvoll die Vorzüge dieses großartigen Profi-Fischernetzes demonstrieren, um dann zu verkünden, dass man dazu noch diese Hochleistungs-Präzisions-Angel und diesen titaniumverstärkten Power-Kescher mit Beschichtung aus der Raumfahrt umsonst bekommen würde – vorausgesetzt, man riefe sofort an!
Mit spielerischen, fast tänzelnden Bewegungen holte der Mann das Netz wieder ein. Dabei schien es ihn nicht im Geringsten anzustrengen, ein mehrere Meter langes Netz mitsamt einem wild wuselnden Haufen armlanger Fische auf den Steg zu wuchten. Und jedes Mal, wenn er nachgreifen musste, ließ er vorher den Arm durch die Luft sausen wie ein schlechter Straßenpantomime, bevor er zum imaginären Treppengeländer griff.
Dieser Mann tat ja gerade so, als wäre dieses simple Fischernetz die größte Sache seit Erfindung des Rades. Nein, er benahm sich, als hätte er das Fischernetz höchstpersönlich erfunden!
»Das hab ich auch, und zwar erst gestern«, sagte der Mann, drehte sich herum und sah Mara an. Mit seinen schwarz glänzenden Augäpfeln, leuchtend wie ein schwarzer Mond in einer weißen Nacht. Mit den Augen des Mannes, den Mara eben noch auf dem Bild gesehen hatte. Mit den Augen des Mannes, den die Götter auf den Felsen gebunden hatten.
»So erstaunt über die eigene Gabe, Litilvölva?«, fragte Loki. Dabei grinste er breit und seine dünnen Lippen umrahmten perlmuttweiß blitzende Zähne.
Und Mara schrie so laut, wie sie noch nie zuvor geschrien hatte. Sie wich unwillkürlich einen Schritt zurück und bemerkte im gleichen Moment den Fehler, als sie plötzlich keinen Boden mehr unter sich spürte. Gerade noch konnte sie sich an einer der dicken Bohlen des Stegs festhalten und hing nun hilflos im eiskalten Wasser des Flusses. Der riss mit erstaunlicher Kraft an ihren Beinen, als wolle er sie zu sich hinunterziehen!
»Hilfe!«, rief Mara: »Bitte helfen Sie mir!« Und tatsächlich sah es für einen Moment so aus, als würde Loki sich zu ihr hinunterbeugen.
Doch da erstarrte das spöttische Lächeln im Gesicht des Mannes. Er musste irgendetwas entdeckt haben, das ihm einen fürchterlichen Schrecken einjagte, denn sofort wandte er sich von Mara ab und verschwand vom Rand des Stegs.
Gleichzeitig spürte Mara, wie etwas Schweres über den Steg rumpelte und dabei die Holzbohlen immer stärker vibrieren ließ!
Sie konnte aus den Augenwinkeln sehen, wie Loki mit einem weiten Satz vom Ende des Stegs sprang … und doch nicht im Wasser aufschlug. Stattdessen tauchte ein rötlich glänzender Fisch in die Wellen, sprang noch einmal übermütig in die Luft, bevor er dann endgültig in den Fluten verschwand.
Für eine Sekunde vergaß Mara ihre missliche Lage, als sie begriff, dass sich dieser Mann gerade vor ihren Augen in einen Fisch verwandelt hatte.
Da donnerte der geheimnisvolle Verfolger auch schon an ihr vorbei und das Letzte, was Mara erkennen konnte, waren das Geweih und die Hufe eines Geißbocks und das Rad eines riesigen Streitwagens. Der wackelige Steg ächzte noch ein letztes Mal unter dem Gewicht des mächtigen Gespanns, doch dann gab er endgültig nach. Seile platzten, armdicke Bohlen wurden in die Luft geschleudert, überall krachte und dröhnte es, als der Steg sich in seine Einzelteile auflöste und Mara unbarmherzig mit sich riss.
»Nein!«, schrie sie und wusste nicht, ob sie es laut geschrien hatte oder nur in ihrem Kopf. Doch da umschloss sie der reißende Fluss auch schon mit seinen eisigen Armen …
Mara versank wie ein Stein und die Kälte schnürte ihr den Hals zu. Ein schwerer Balken verfehlte sie nur um Haaresbreite und schwebte für einen Moment neben ihr, als würden sie zusammen eine Art Unterwasserballett aufführen. Mara brauchte einen Moment, bis sie die Chance erkannt hatte, doch dann griff sie endlich zu und umklammerte das Holz mit beiden Armen.
Als sie nach ein paar weiteren endlosen Sekunden tatsächlich wieder die Wasseroberfläche durchbrach, war sie schon viele Meter von den Resten des Stegs entfernt. Immer weiter riss sie die Strömung fort und jede Hoffnung, wieder zum Steg zurückzugelangen, schwand ebenso schnell wie Maras Kräfte. Trotz der Kleider, die sie nach unten zogen, versuchte sie, den Kopf über Wasser zu halten, und klammerte sich mit dem Mut der Verzweiflung an dem glitschigen Balken fest.
Mit verschwommenem Blick nahm Mara noch wahr, dass der weit entfernte Wagen mit den Böcken mitten im Fluss mühelos der Strömung trotzte. Eine riesenhafte Gestalt hielt die Zügel mit einer Hand und schwang mit der anderen ein Fischernetz in weitem Bogen um sich. Lokis Fischernetz?
Doch da wurde die Gestalt auch schon vom Nebel verschluckt und Mara sah gar nichts mehr außer Wasser und milchigem Weiß …
Das dumpfe Brausen des Wasserfalls nahm Mara einfach nur noch hin. Sie hatte nicht mehr die Kraft zu schreien. Es wäre auch völlig sinnlos gewesen, sich gegen die Strömung zu wehren. Und als sie schließlich zusammen mit den Wassermassen in die Tiefe stürzte, spürte Mara nur noch, dass sie nicht mehr Wasser treten musste …
Mara erinnerte sich nicht an den Aufschlag. Eben war sie noch gefallen und nun umschloss sie eine eiskalte Dunkelheit. Die Wucht des stürzenden Flusses schlug unaufhörlich auf sie ein, ließ sie sich immer und immer wieder überschlagen. Nirgendwo war oben, irgendwo war unten und überall war nichts als eiskaltes Wasser.
Aufwachen!, war das Vorletzte, an das Mara dachte. Das Letzte waren ihre Eltern. Sie saßen zu dritt am Frühstückstisch, Mara wollte kein Müsli, Papa lachte und Mama auch, und dann lachte auch Mara.