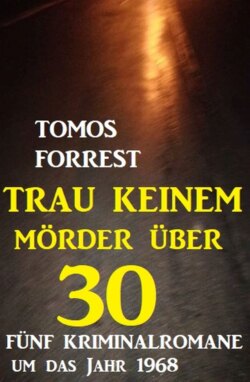Читать книгу Trau keinem Mörder über 30: Fünf Kriminalromane um das Jahr 1968 - Tomos Forrest - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Engel mit dem goldenen Revolver
ОглавлениеBerlin 1968 Kriminalroman Band 6
von Tomos Forrest
Ganz Berlin scheint einen Verbrecher zu feiern, einen Mann, der sich auf den am Tatort zurückgelassenen Visitenkarten als „Engel“ bezeichnet. In Selbstjustiz verfolgt er Verbrecher und ermordet sie. Das ist natürlich Stoff für die Boulevard-Presse, die ihn in den höchsten Tönen für seine Taten lobt. Privatdetektiv Bernd Schuster setzt sich auf seine Spur, auch ohne sich mit seinem Auftraggeber detailliert abzustimmen. Dann aber begegnet er Beatrice Wilde, dem einzigen Menschen, der den Mann mit dem goldenen Revolver gesehen hat und – diese Begegnung überlebte. Doch der ‚Engel‘ hat mit ihr ganz eigene Pläne...
––––––––
1
Franziska schreckte aus dem Tiefschlaf hoch und benötigte einen Moment, um zur Besinnung zu kommen. Weshalb sie aufgewacht war, wusste sie nicht sofort. Dann fiel ihr ein, dass sie etwas berührt hatte, ganz sanft. Für einen kurzen Moment hoffte sie, Bernd an ihrer Seite zu finden. Aber die Doppelbetthälfte neben ihr war leer.
Ein leises Scharren jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken.
Jemand bewegte sich in dem Sessel gegenüber am Fenster.
Das fahle Licht eines kalten Novembermondes fiel zwischen den nur halb zugezogenen Gardinen auf die Silhouette eines Menschen.
Ihre Finger glitten zur Nachttischlampe, fanden den Schalter, aber nichts geschah.
„Keine Sorge, Fräulein Markworth. Ich bin es, Frank Todd.“
Jetzt reagierte Franziska blitzschnell. Ihre Hand fuhr seitlich an den kleinen Nachttisch. Als sie wieder hervorkam, schimmerte das Mondlicht matt auf dem Lauf einer Pistole.
„Wie kommen Sie dazu, hier einzubrechen? Verschwinden Sie sofort aus meiner Wohnung!“
„Wir müssen reden, Fräulein Markworth!“
„Jahn! Ich heiße Franziska Jahn. Auch, wenn ich geschieden bin, habe ich meinen Mädchennamen nicht wieder angenommen!“
„Das ist sehr schade!“, antwortete der nächtliche Besucher, von dem Franziska bei der schlechten Beleuchtung nur die Umrisse erkannte. „Ich finde ihn viel schöner. Er passt zu Ihnen.“
„Hören Sie auf, mitten in der Nacht einen solchen Blödsinn zu reden und verschwinden Sie endlich aus meiner Wohnung, oder ich rufe die Polizei!“
Ein Geräusch wie von einem unterdrückten Lachen drang an ihr Ohr.
Neben der Lampe stand auch ihr Zweitapparat auf dem Tischchen.
Franziska nahm den Hörer ab und drückte rasch hintereinander die 110.
Jetzt war das Lachen ihres Besuchers laut geworden.
„Legen Sie wieder auf, Fräulein Markworth. Das Telefon funktioniert heute nicht. Und ehe Sie auf dumme Gedanken kommen: Bevor ich mir erlaubt habe, Sie zu wecken, habe ich das Magazin aus ihrer Pistole genommen.“
„Was? Sie verdammter Scheisskerl – was soll das? Ich schreie das ganze Haus zusammen, wenn Sie...“
„Werden Sie doch bitte nicht hysterisch, Fräulein. Wir haben eine Vereinbarung, und an die wollte ich Sie erinnern. Ich nehme an, Sie haben das Geld gut angelegt?“
Franziska hatte die nutzlose Waffe neben sich gelegt und spürte, wie ihr Herz bis hoch in den Hals hinauf schlug.
„Sie waren im Mai im Büro in der Kurfürstenstraße und wollten Informationen von mir haben. Der Umschlag, den Sie mir damals gegeben haben, befindet sich unangetastet dort drüben in der ersten Schublade der Kommode. Nehmen Sie ihn und verschwinden Sie! Ich will Sie nie wiedersehen, Herr Todd!“
Erneutes Gelächter des nächtlichen Besuchers, aber gedämpft.
„Fräulein, Seien Sie doch nicht albern! Haben Sie Ihrem Chef von unserem kleinen Handel erzählt?“
„Ich wüsste nicht, was Sie das angeht!“, fauchte Franziska.
„Nun gut, ist ja auch egal und vielleicht auch viel besser so. Ich hatte vor, Sie schon viel früher aufzusuchen, hatte aber zwischenzeitlich sehr viel außerhalb von Berlin zu tun. Nun bin ich zurück und möchte von Ihnen alles erfahren, was Ihr Chef Bernd Schuster über Luigi Espasito herausgefunden hat.“
„Espasito? Warum fragen Sie ihn nicht selbst?“
„Ich möchte es von Ihnen erfahren, weil ich nicht glaube, dass Herr Schuster ehrlich zu mir wäre. Also, Fräulein, Sie haben jetzt nach so vielen Monaten die Gelegenheit, etwas für die Tausend Mark für mich zu machen. Ich melde mich in einer Woche wieder bei Ihnen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Vielleicht sogar wieder in dieser traulichen Zweisamkeit?“
„Verschwinden Sie endlich! Informationen gibt es von mir nicht, nehmen Sie den verdammten Umschlag mit und lassen Sie sich nie wieder bei mir blicken, sonst...“
Der Besucher hatte sich erhoben und beugte sich etwas vor.
Selbst bei den schlechten Lichtverhältnissen erkannte Franziska sein höhnisch grinsendes Gesicht. Es jagte ihr einen erneuten Schauer über den Rücken.
„Also – bis bald, Fräulein Markworth!“
Frank Todd war nahezu geräuschlos aus dem Schlafzimmer verschwunden, und für einen Augenblick musste Franziska sich beherrschen, um nicht laut herauszuschreiben. Sie atmete kräftig ein und aus, dann hatte sie sich so weit unter Kontrolle, dass sie von ihrem Bett aufsprang und auf den Flur hinauslief.
Der kalte Fußboden brachte sie wieder zurück in die Wirklichkeit.
Als sie den Lichtschalter im Flur betätigte, flammte die Deckenbeleuchtung auf. Ihre Wohnungstür war wieder geschlossen, aber die Sicherheitskette schwang noch leicht hin und her.
Was Franziska einen weiteren Schauer über den Rücken laufen ließ, war die Tatsache, dass die Kette durchgetrennt war. Ein Stück hing noch in der Halterung an der Tür, das andere baumelte im Türrahmen.
„Verdammt, verdammt, verdammt!“, schrie Franziska und starrte auf die Sicherheitskette.
Die Kälte auf dem Flur und den Fliesen trieb sie schließlich ins Schlafzimmer zurück.
Hier kleidete sie sich hastig an, entdeckte im Licht der Flurbeleuchtung das Magazin ihrer Beretta auf der Kommode und schob es wieder in die Waffe. Eine dicke Jacke vom Flur, dazu die Wollmütze. Dann war sie bereit, ihre Wohnung zu verlassen, die für sie bis zu dieser Stunde ein sicherer Hort war.
Die italienische Pistole vom Typ Beretta 81 war eigentlich für eine Frau etwas zu klobig. Aber als sie nun in ihre Außentasche der dicken Wolljacke geschoben wurde, behielt Franziska den Griff in der Hand, bereit, sich kein weiteres Mal unterwegs im nächtlichen Berlin überrumpeln zu lassen. Sie hatte keinen weiten Weg von ihrer Wohnung in der Bayreuther Straße zum Büro in der Kurfürstenstraße, und darüber war sie heute besonders froh.
Kurz überlegte sie, ob sie einfach zu Bernd Schuster in den 14. Stock hinauffahren sollte, denn einen Wohnungsschlüssel hatte sie schon länger. Aber dann entschied sie sich doch für das Sofa in Bernds Büro, weil sie Rücksicht auf seine Tochter Lucy nehmen wollte. Es war unnötig, die Siebzehnjährige aus dem Schlaf zu schrecken, schließlich musste sie morgen wieder früh raus.
Das Büro der Detektei befand sich in einer kleinen Ladenzeile direkt vor dem Wohnhaus. Franziska atmete erleichtert auf, als sie die Tür hinter sich abschloss und die vertraute Atmosphäre des Büros aufnahm. Es war zum Glück durchgehend geheizt, und wie durchfroren sie nach dem kurzen Gang bis hierher war, spürte sie erst, als sie sich unter der warmen Mohairdecke auf dem Sofa ausstreckte. Langsam kehrte die Wärme in ihren Körper zurück und sie spürte, dass sie müde wurde.
‚Diese Decke war mal die beste Anschaffung für das Büro!‘, dachte sie noch, dann sank sie in den Schlaf.
*
Zunächst war Bert erstaunt, zu so später Stunde noch eine junge Frau allein zu unterwegs zu sehen. Doch rasch wurde ihm klar, dass hier keineswegs ein wehrloses Opfer vor ihm ging. Sie war groß und ging mit federndem, elastischen Schritt vor ihm her. Was Bert überhaupt nicht gefiel, war die rechte Hand der Frau. Sie steckte in ihrer Jackentasche und schien dort etwas bereit zu halten.
Was es genau war, konnte er natürlich nicht erkennen. Wahrscheinlich eine von diesen Sprühdosen. Nein, das gab keinen Sinn. Er würde ein anderes Opfer finden, nicht gleich und sofort, aber dafür gut ausgewählt und völlig risikolos.
Bert kicherte leise vor sich hin, als die junge Frau die Straße überquerte und auf eines der Hochhäuser zusteuerte.
‚Nein, Mädchen, du bist mir etwas zu forsch in deinem Auftritt. Mein Ding ist mehr eine alte, hilflose Frau. Vielleicht gerade auf dem Rückweg von einer Bankfiliale. So etwas findet man heute noch immer, obwohl bei der ansteigenden Kriminalität es ja auch für unsereinen immer schwieriger wird!‘
*
Bert folgte seinem Opfer, er fühlte sich prächtig dabei. Das war immer so, bevor er zuschlug. Er brauchte dieses Gefühl kribbelnder Hochspannung, das Wissen um den baldigen Triumph. Die Alte war eine leichte Beute für ihn, sie bewegte sich rasch und gebückt vorwärts, sie hatte Angst, das war zu sehen und zu spüren.
Eine alte Frau. Bert schätzte sie auf etwa Mitte der Sechzig. Wahrscheinlich kam sie von einem Kaffeeklatsch, auf dem sie sich das Schandmaul über andere Leute zerrissen halte, über das Anwachsen der Kriminalität, über die Verrohung der Sitten, den Terror auf den Straßen. Die Studenten, die nicht zu den Vorlesungen gingen, sondern auf der Straße demonstrierten. Gegen den Krieg in Vietnam. Gegen irgendwelche Notstandsgesetze, von denen sie nichts verstand. Hauptsache, man war dagegen!
Eine Vogelscheuche, eine schlampige Heuchlerin. Bert fand es leicht, die Alte zu hassen, es tat ihm geradezu gut, sich in eine kalte Wut hineinzusteigern.
Die Alte hatte vergeblich nach einem Taxi Ausschau gehalten, jetzt befand sie sich auf dem Wege zur nächsten U-Bahn-Station. Sie hatte es eilig, Menschen und Licht zu finden, die schmalen, dunklen Straßen beunruhigten sie.
Bert grinste in sich hinein, er kam seinem Opfer langsam näher. Wenn die Alte das nächste Mal über die bösen Menschen sprach, würde sie ein Erlebnis aus dem eigenen Erfahrungsschatz zum Besten geben können.
Es nieselte. Ein scharfer Nordostwind trieb beißende Kälte in die tristen Häuserschluchten. Bert, der eigentlich Berthold Fischer hieß, wusste genau, wo er handeln würde. Gegenüber von dem türkischen Imbiss lag das kleine Stück Grünfläche beim Moritzplatz. Da entlang und Richtung Oranienplatz, und man war schnell zwischen den Leuten verschwunden, die hier ihrer Beschäftigung nachgingen und vielleicht noch rasch beim nächsten Bolle ihre Einkäufe erledigten.
Die alte Frau kam von der Stallschreiberstraße herüber und schien zur U-Bahn-Station am Moritzplatz zu wollen. Er würde ihr blitzschnell die Handtasche entreißen und um die Ecke verschwunden sein, noch bevor sich die komische Alte von ihrem Schrecken erholt hatte und im Hilfe schreien konnte.
Es war schwer zu sagen, wie viel Geld die Alte bei sich führte. In diesen Zeiten riskierten es die wenigsten, größere Bargeldbeträge bei sich zu führen, aber vielleicht besaß sie einen Ring oder eine Kette, irgendein Schmuckstück, um das er sie erleichtern konnte. Es war kaum jemand auf der Straße zu sehen, alles würde so rasch gehen, dass niemand Zeit zum Eingreifen fand.
Bert verzog das Gesicht. Bis jetzt hatte es noch niemand gewagt, ihm ins Handwerk zu pfuschen. und er gehörte nicht zu den Leuten, die an dieses neue Schreckgespenst, an „Engel“ glaubten. Ein Verrückter! Nannte sich einfach Engel, weil er meinte, sei nun ein Engel, der gekommen sei, um mit dem Verbrechen in Berlin aufzuräumen. Möglicherweise war er nur eine Erfindung cleverer Pressefritzen, die sich einbildeten, damit die Szene verunsichern zu können.
Bert beschleunigte seine Schritte. Es war soweit. Jetzt würde er sich gleich sein Opfer krallen. Es wurde Zeit, dass diese alte Schlampe eine Lektion erteilt bekam. Sie hatte hier nichts verloren, sie sollte nach Einbruch der Dunkelheit gefälligst zu Hause bleiben und mit ihrem zahnlosen Mund von den guten, alten Zeiten brummeln, die Gott sei Dank endgültig vorüber waren.
Er hatte die Frau erreicht, seine Hand schnellte vor, er riss an der schäbigen, großen Tasche. Die Frau wurde buchstäblich herumgewirbelt, ihre weit aufgerissenen, schreckensstarren Augen hingen an seinem Gesicht. Sie war unfähig, ein Wort zu äußern, sie konnte nicht einmal schreien, aber sie hielt die Tasche fest, als hinge ihr Leben daran.
Bert war verdutzt. Er wandte den Kopf und zerrte immer noch an der Tasche. Er sah eine jüngere Frau, die sich von ihm fortbewegte und die nicht bemerkte, was hier geschah.
Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann. Er schaute rasch weg, als Berts Blick sich mit seinem kreuzte. Nichts sehen, nichts hören, so lautete die Devise in diesem Viertel. Wer sich nicht daran hielt, bekam Ärger. Oft genug war es sein letzter.
„Loslassen!“, keuchte Bert. Er war jetzt stocksauer. Er verstand nicht, weshalb die Frau die Tasche festhielt. Er riss die geballte Faust hoch, er schlug zu, zweimal hintereinander. Die Frau sank lautlos zu Boden. Er nahm ihr die Tasche ab. Der Mann auf der anderen Straßenseite hatte sich abgewandt, er studierte die Auslagen in einem Schaufenster.
Bert sah, dass die Frau einen Ring trug. Er riss und zerrte daran, er wollte ihn abstreifen, aber das verdammte Ding ging nicht über das gichtig angeschwollene Gelenk hinweg, er gab es auf und rannte mit der Tasche in das dunkle, nur von zwei, drei mickrigen Lampen notdürftig aufgehellte Stück der Grünanlage.
Er stoppte, als er das andere Ende der Gasse, öffnete die Tasche und blickte hinein. Es störte ihn nicht, dass er dabei direkt unter einer Lampe stand, er brauchte Licht, um zu sehen, was die Tasche enthielt.
Ein Päckchen mit Papiertüchern, eine alte, kleine Sprungdeckeluhr, eine Geldbörse. Bert grinste zufrieden. Die Uhr sah aus wie Gold, jedenfalls ließ sich so etwas leicht zu Geld machen. Er steckte die Uhr ein, dann öffnete er die Geldbörse.
Seine Augen quollen aus den Höhlungen, als er das dicke Banknotenbündel sah. Er hatte weder Zeit noch Lust, das Geld an Ort und Stelle nachzuzählen, aber es gab keinen Zweifel, dass er ein paar hundert Mark erbeutet hatte. Sein größter Fischzug seit Langem.
Er wischte die Tasche ab, um sie von seinen Fingerabdrücken zu befreien, steckte die Börse zu der Uhr, warf die Tasche über einen Zaun und bewegte sich pfeifend auf die Hochbahnbrücke zu. Es empfahl sich, der Gegend für zwei, drei Stunden den Rücken zu kehren, die Bullen würden sie verunsichern und nach dem Mann Ausschau halten, auf den die Beschreibung der komischen Alten passte.
Vor allem musste er die Uhr verstecken, sie konnte ihn verraten. Er erreichte seinen alten Opel und schloss ihn auf. Jemand tippte ihm auf die Schulter. Bert zuckte auf den Absätzen herum. Er war eher überrascht als erschrocken, er hatte niemand gesehen oder gehört, im ersten Moment war er der Meinung gewesen, eine der Tauben, die in dem Stahlträgerwerk der Brücke nisteten, habe ihn beschmutzt, aber jetzt sah er sich einem Fremden gegenüber, einem hochgewachsenen Mann mit markanten Gesichtszügen und tiefen, dunklen Augen.
„Ist was?“, fragte Bert. Er merkte, dass er die eigene Stimme und seine gewohnte Flapsigkeit einsetzen musste, um die plötzliche Furcht in den Griff zu bekommen.
Hatte der Mann etwas gesehen? Unsinn! Der Tatort lag mehr als dreihundert Meter von hier entfernt, der Überfall hatte sich vor dem Grünstück ereignet, er war praktisch lautlos vor sich gegangen, es hatte weder Schüsse noch Hilfeschreie gegeben, das Ganze war ein perfekter Job gewesen.
„Du bist Bert, nicht wahr?“, fragte der Mann. Seine Stimme war leise, aber sie war auf seltsame Weise kraftvoll, in ihr schwangen Spott und Selbstsicherheit, daneben aber noch etwas Anderes. Unwägbares, das Berts Furcht vertiefte. Ein Verdacht sprang ihn an, ein absurder, geradezu grotesker Verdacht, aber er wischte ihn beiseite, er wollte nicht wahrhaben, dass er, ausgerechnet er mit Engel zusammengetroffen sein könnte. Nein. Engel nahm sich nur die großen Fische vor, die Männer der Berliner Unterwelt, er gab sich nicht mit kleinen Taschendieben ab, das war unter seiner Würde.
„Ja, kennen wir uns?“, fragte Bert. Seine Stimme klang belegt. Plötzlich wurde er wütend. Sein Gegenüber war höchstens Mitte Dreißig und gut gekleidet. Bert kannte sich im Umgang mit Fäusten aus, er hatte ein Klappmesser in der Tasche und wusste es zu handhaben, es gab also keinen Grund, vor dem Unbekannten zu kneifen. Nicht vor einem feinen Pinkel!
‚Aus dem mache ich Kleinholz‘, dachte Bert. Ich nehm‘ ihm die Brieftasche ab und beende den Abend mit der hübschen, erhebenden Tätigkeit des Geldzählens.
„Ich kenne dich“, sagte der Mann. „Du gehörst zu denen, die die Straßen verpesten, die sie unsicher und gefährlich gemacht haben, und die glauben, vom Terror leben zu können.“
‚Ein Polyp‘, dachte Bert beklommen. ‚Irgendeiner von diesen beschissenen Typen, die aus einem anderen Revier kommen und meinen, als Zivilstreifen Ordnung schaffen zu können. Vielleicht ist er nicht mal allein, vielleicht lauert ganz in der Nähe sein Kollege und wartet darauf, dass du angreifst, dass du einen Fehler machst.‘
„Das soll wohl ‘n Witz sein“, sagte Bert und schob seine Daumen in den breiten Ledergürtel seiner abgewetzten, verbeulten Jeans. „Können Sie sich ausweisen?“
„Sicher“, sagte der Mann. „Ich bin Engel.“
Er hielt plötzlich einen Revolver in der Hand, eine ziemlich seltsame Waffe, wie Bert fand. Sie war vergoldet, und ihr matter Glanz bildete einen seltsamen, faszinierenden Kontrast zu dem dünnen, schwarzen Lederhandschuh, den der Mann trug.
Bert schluckte. Er konnte und wollte nicht begreifen, dass ausgerechnet er so viel Pech gehabt haben sollte, nach einem Superfischzug vom Engel gestellt zu werden, aber er wusste plötzlich mit quälender, schmerzhafter Deutlichkeit, dass es stimmte.
Bert hatte die Zeitungsberichte von dem Mann mit dem goldenen Revolver für Spinnereien gehalten, für eine Garnierung erfundener Schauergeschichten für die Springerpresse, aber jetzt zeigte es sich, dass das Ganze stimmte, sogar die Sache mit dem goldenen Revolver traf zu. Nur eines stimmte nicht. Es würde einen Mann geben, der den Engel überlistet und überwunden hatte, und dieser Mann würde er, Berthold Fischer, alias Bert, sein!
„Lass ihn“, sagte Bert und blickte über die Schulter des Mannes hinweg. Der Trick hatte schon hundertmal funktioniert, aber Engel fiel nicht darauf herein, er wandte sich nicht um, er schaute nur Bert an, unentwegt.
Bert bekam einen trockenen Mund. „Wenn Sie wirklich Engel sein sollten ...“, begann er. Er führte den Satz nicht zu Ende. Wenn Engel auftrat, blieb eine Leiche zurück. Die Leiche eines Kriminellen.
„Ich bin‘s, Junge, ich bin‘s“, sagte der Mann und hob kaum merklich das Kinn, als das Donnern eines heranbrausenden Zuges hörbar wurde.
Berts Herz hämmerte, seine Hände waren schweißfeucht. Das konnte doch nicht das Ende sein! Wegen eines Handtaschenraubes wurde man nicht umgelegt, das war absurd, das war einfach gegen die Spielregeln.
„Ich könnte Ihnen helfen“, stieß Bert hervor. Die Lippen seines Gegenübers bewegten sich, aber Bert konnte nicht verstehen, was der Mann sagte. Der Zug donnerte über sie hinweg, er erfüllte die Luft mit metallischem Hämmern, Stampfen und Kreischen.
Wenn Engel jetzt abdrückte, in diesem Moment, würde der Schuss untergehen, einfach verschluckt werden, aber Engel tat nichts dergleichen, er hatte den Finger zwar am Abzug liegen, aber dieser Finger rührte sich nicht. Bert stieß die Luft aus. Er fühlte sich wie befreit, er war gerettet. Wenn Engel jetzt nicht geschossen hatte, würde er es niemals tun, nicht bei ihm, nicht bei Berthold Fischer.
„Ich könnte Ihnen helfen“, wiederholte Bert, weil er nicht sicher war, ob Engel ihn verstanden hatte.
„Wie denn?“, fragte der Mann. Seine Stimme klang spöttisch.
„Ich könnte Ihnen Tipps geben ...“
„Tipps?“
„Ja. Ich kenne eine Menge Leute, die Sie interessieren würden“, stammelte Bert und hasste sich dafür, dass seine Stimme vor Eifer fast umzukippen drohte. Er sang. Er war bereit, andere in die Pfanne zu hauen, um die eigene Haut zu retten. Das war schäbig, er wusste es, aber hier ging es um sein Leben, um seinen Kopf, da hatte es keinen Zweck, pingelig zu sein.
„Welche Leute?“, fragte der Mann.
„Richtige Verbrecher, nicht so kleine, harmlose Burschen meines Kalibers ...“
„Du bist nicht harmlos. Du bist eine Ratte“, sagte Engel. „Ratten vernichtet man.“
Bert schluckte. Er starrte in die auf ihn gerichtete Waffenmündung, seine Angst, die vorübergehend kleiner geworden war, nahm wieder die alten, erschreckenden Dimensionen an. Engel, der Rächer!
„Ich weiß zum Beispiel, was nächsten Sonnabend steigen soll“, stieß Bert hervor. Der Nieselregen war stärker geworden. Der Nordost heulte, und aus der Gegenrichtung kam eine weitere S-Bahn heran. Die Gegend war trist, ein Alpdruck. Kein Wunder, dass weit und breit keine Menschenseele zu sehen war!
„Nächsten Sonnabend, morgen also?“, fragte Engel.
„Ja, morgen. Ganz will die Wildes ausnehmen.“
„Langsam, langsam“, sagte der Mann. „Wer ist Ganz?“
„Gernot Ganz, er arbeitet für die Italiener.“
„Ich weiß Bescheid. Und wer sind die Wildes?“
„Sie können von mir nicht erwarten, dass ich das einfach auspacke, ohne Garantien ...“
„Rede!“
„Hören Sie mal ...“
Der Zug war direkt über ihnen. Er schien noch lauter zu sein als derjenige, der vorher die Gegenrichtung passiert hatte. Bert zuckte zusammen, als er den grellen, kleinen Feuerblitz aus dem Revolverlauf springen sah, er spürte einen heftigen Schlag an der Schulter und brach in die Knie, eher infolge des plötzlichen Schocks als echter Schwäche.
Bert griff sich an die Schulter, er spürte das Loch in der Lederjacke und darunter die warme Klebrigkeit des austretenden Blutes. Ihm war auf einmal sterbensübel. Die S-Bahn donnerte vorüber, der Lärm verebbte.
„Sprich!“, sagte der Mann. Seine Stimme war hart und befehlend, sie drückte Ekel aus. Abgrundtiefe Verachtung, aber auch noch etwas Anderes, etwas, das Bert tiefer und nachhaltiger entsetzte als bloße Brutalität. Bert fand, dass diese Stimme von Sadismus getragen wurde, von der Lust am Leid des anderen, von einem abwegigen, irren Killerinstinkt.
Bert umklammerte die blutende Wunde, er zitterte am ganzen Körper, er konnte sich nicht erinnern, sich jemals miserabler gefühlt zu haben. War das das Ende? Er wehrte sich dagegen, er konnte und wollte nicht glauben, dass er, mit den Taschen voller Geld, an diesem tristen Ort ins Gras beißen sollte.
„Sing, Ratte, sing!“, sagte der Mann.
„Es handelt sich um das Ehepaar Wilde“, stieß Bert hervor. „Sie beschäftigen einen Leibwächter, aber der liegt nach einem Unfall im Krankenhaus.“
„Danke, das genügt“, sagte Engel.
„Nein!“, schrie Bert. „Nein ...“
Er wollte noch etwas sagen, aber die beiden kurzen, trockenen Schüsse aus dem goldenen Revolver fegten ihm die Worte von der Zunge, sie peitschten ihm ein Gefühl unter die Haut, das neu für ihn war, enervierend und betäubend zugleich. Er kippte vornüber, schlug mit der Stirn auf schmutziges Pflaster und hörte einen weiteren Knall, jedenfalls schien es ihm so, aber er spürte keinen Schmerz, er begriff nur, dass es aus war. Aus und vorbei.
Seine Lippen bewegten sich, und seine Finger wurden starr, dann rollte sein Kopf zur Seite, und er hörte auf, etwas zu denken oder zu fühlen.
Berthold Fischer war tot.
––––––––
2
Die Männer bauten die Scheinwerfer auf, sie rollten die Kabeltrommeln ab und fluchten, wenn ihnen irgendetwas in den Weg kam. Inspektor Südermann hatte den Mantel seines Trenchcoats hochgestellt und verzog das Gesicht, als eine S-Bahn die Luft mit ihrem stählernen Getöse erfüllte.
„Wissen Sie, was ich glaube?“, fragte Karl-Anton Flemming, einer der Ermittler aus Südermanns Team, der sich eine seiner scheußlich riechenden Zigaretten drehte. „Das war gar nicht Engel. Ein Nachahmer. Einer, der sich an Engels Ruhm hochrangeln will. Engel legt nur echte Verbrecher um. Wenn es stimmt, was wir wissen, war Fischer nur ‘n mieser, kleiner Strichjunge, ein Handtaschenräuber ...“
Ein Polizist kam heran und salutierte. „Die Presseleute möchten Sie sprechen, Herr Inspektor“, sagte er, „es ist beinahe unmöglich, sie jenseits der Absperrung zu halten.“
Inspektor Südermann sah zu, wie Flemming sich die Zigarette ansteckte, dann ging er zur anderen Straßenseite, blinzelnd und jäh geblendet von ein paar aufflammenden Blitzlichtern.
„Es ist zu früh für bindende Schlüsse, Leute“, sagte er mit hochgezogenen Schultern. Er kannte die meisten Reporter und Fotografen, es gab ein paar davon, die er schätzte und als seine Freunde betrachtete. aber es geschah nur selten, dass das Zusammentreffen mit ihnen seine Laune verbesserte.
Die Männer wollten immerzu Erfolgsmeldungen hören, Details, sie lebten von deren Auswertung, aber erstens war er nicht ihr Brötchengeber, und zweitens musste er sich hüten, durch eine zu offene Informationspolitik Porzellan zu zerschlagen oder dem Täter Hinweise auf den Ermittlungsstand zu geben.
Hier und heute war es freilich relativ leicht, etwas zu sagen. Engels übliche Visitenkarte machte das Geschehen zu einer runden Sache, und die Presseleute würden keine Mühe haben, ihrem gegenwärtigen Lieblingsthema ein paar neue Glanzlichter aufzusetzen.
„Er muss doch mal mehr als seine blöde Karte am Tatort zurücklassen“, sagte einer der Männer, der für die BZ schrieb. „Nach so vielen Morden muss auch ihm mal eine Panne passieren, muss er einen Knopf verlieren, einen Fußabdruck hinterlassen. Irgendetwas, womit man ihn festnageln kann ...“
„Du bist lustig, wirklich“, höhnte sein Kollege von der Morgenpost. „Wenn die Leute des Inspektors was finden würden, hätten sie gute Gründe, das zu verschweigen. Oder irre ich mich, Inspektor?“
„Ich wüsste gern, was Sie damit sagen wollen“, meinte Südermann. Aber natürlich hatte er sofort kapiert, worauf der Reporter hinauswollte. Die Spatzen pfiffen es schließlich schon von den Dächern, dass die Polizei verdächtigt wurde, in Engel einen willkommenen Helfer, einen uneigennützigen Helfer gegen das organisierte Verbrechen zu sehen.
„Sie können doch heilfroh sein, dass der Engel Ihnen die Dreckarbeit abnimmt“, sprach der Reporter aus, was die meisten Leute in der Stadt dachten. „Engel braucht keine Anklage aufzubauen, er muss sich nicht damit abrackern, Beweise zu finden, er kann es sich leisten, auf die sogenannte Rechtsstaatlichkeit zu pfeifen. Er pickt sich einen Verbrecher heraus und legt ihn um. So einfach ist das für ihn. Wie viele Opfer schreiben Sie ihm zu?“
„Neun“, sagte Horst Südermann. „aber unseres Wissens hat er erst nach dem dritten Mord die Masche mit der Visitenkarte entwickelt.“
„Benutzt er wirklich eine vergoldete Waffe?“, fragte einer der Männer.
„Er behauptet es. Am Telefon. Die Toten, die darüber Auskunft geben könnten, sind leider nicht imstande, uns aufzuklären“ sagte der Inspektor bitter. „Aber nun zu Ihnen, mein Freund. Sie können nicht im Ernst glauben, dass wir Engels Verbrechen gutheißen. Man kann Mord nicht mit Mord bekämpfen, das ist unsinnig, eine Kette ohne Ende. Und Sie dürfen mir glauben, dass ich in Engel alles andere als einen Freund und Kollegen sehe. Er macht die Stadt verrückt, vor allem aber uns. Wir bekommen kaum noch Schlaf, auf meinem Schreibtisch häufen sich die Akten, die Unterschriftentinte auf einem Protokoll ist noch nicht trocken, und schon erreichen uns die nächsten Alarmrufe, die nächsten Mordmeldungen. Nein, der Engel ist nicht unser Freund, und schon gar nicht unser Helfer. Eines Tages werden sich Nachahmer finden, die Selbstjustiz ist wie eine ansteckende Krankheit, sie weckt Killerinstinkte und gibt Leuten mit Aggressionszwängen den Vorwand, dem Recht zu dienen – aber in Wahrheit sind sie nicht besser als diejenigen, die sie töten oder auf andere Weise bekämpfen, sie sind eher noch schlimmer. Nehmen Sie einen Mann wie den ermordeten Berthold Fischer. Ein kleiner Ganove, zugegeben. Ein Mann aus Kreuzberg, der niemals Nestwärme genossen und von früher Jugend an gezwungen war, sich ...“
„Hören Sie bloß auf, mir bricht gleich das Herz“, warf der Reporter dazwischen. Er war Klaus Gunthermann, der Senior der Kriminalreporter, ein alter Haudegen mit verwitterten, wie gegerbt wirkenden Gesichtszügen, von dem behauptet wurde, dass er am Tage einen Liter Weinbrand trinken müsste, um einigermaßen fit zu bleiben. Sein Mundgeruch schien diese These zu untermauern, aber es gab niemanden, der ihn jemals hätte schwanken selten. „Immer diese blöden, alten Märchen von der harten, lieblosen Umgebung, von der Elternschuld, der Lehrerschuld, der Erwachsenenschuld. Nachkriegsgeneration, Vater im Krieg geblieben, Mutter mit neuem Macker. Oder Flüchtlingskind, möglichst mit ganz tragischer Geschichte. Mich kotzt das an. Ich kenne ‘ne Menge Waisenkinder, die es zu was gebracht haben und gar nicht wissen, was Liebe ist. Wer kriminell ist, darf sich nicht wundern, bekämpft zu werden, und der Engel weiß genau, dass gegen Härte nur mit noch größerer Härte angegangen werden kann.“
„Terror und Gegenterror, ein hübsches Rezept“, spottete Inspektor Südermann. „Unsere Stadt wird sich an eine reizende Zukunft gewöhnen müssen, an Ströme von Blut, was?“
„Blut“, sagte Gunthermann , „fließt jetzt schon genug. Hat die Mordkommission auch noch Zeit, sich mal bei den wöchentlichen Demos umzusehen, Inspektor? Ich habe Fotos von Menschen gemacht, die einen Ziegelstein mitten ins Gesicht bekommen haben! Das heizt die Stimmung auf. Und wenn nun auch noch so ein Mörder frei herumläuft, schlägt das dem Fass die Krone aus! Es liegt nicht zuletzt an Ihnen, Inspektor, diesen Trend aufzuhalten.“
„Ich kann nicht zaubern, Gunthermann. Vielleicht werfen Sie hin und wieder mal einen Blick auf die Statistiken, auf die Zahl der geklärten Mordfälle. Sie werden einsehen müssen, dass sich diese Zahlen sehen lassen können. Und die Demonstrationen gehen mir sehr auf den Wecker und ich bedaure die Kollegen der Bereitschaftspolizei, sich mit diesem Pöbel herumschlagen zu müssen. Studenten? Für mich sind das asoziale Kriminelle, die sich an die Demonstranten hängen, um sich mit den Polizisten zu prügeln und dann feige in der Menge unterzutauchen, wenn die Gegenseite versucht, sie zu fassen.“
„Ich kenne diese alte Litanei“, winkte Guntermann ab. „Das Lied vom Personalmangel, von Übermüdung und Überlastung. Diese Stadt hat genügend Männer, die tüchtig sind und durchaus bereit wären, die Polizei tatkräftig zu unterstützen. Leute wie Bernd Schuster zum Beispiel.“
„Bernd“, seufzte der Inspektor, „ist mein Freund. Ein guter Freund. Ich weiß, was er kann, er hat mir mehr als einmal aus der Klemme geholfen. Bernd ist Privatdetektiv. Er lebt recht gut von seinem Beruf. Er lebt von seinen Honoraren – und die zahlen ihm mehr oder weniger betuchte Klienten. Die Polizei jedenfalls hat keinen Etat für die Beschäftigung von Privatdetektiven – aber das wissen Sie so gut wie ich.“
„Warum“, spottete einer der Reporter, „gehst du nicht zu deiner Redaktion und bittest sie darum, Bernd Schuster auf Engels Fährte zu hetzen? Es wird euch ein paar Tausender kosten, fürchte ich, aber wenn Schuster Erfolg haben sollte, wäre das eine gute, eine blendende Investition, euch würden Zehntausende neuer Leser zufließen.“
Gunthermann starrte dem Sprecher in die Augen. „Gottfried, alter Junge“, sagte er dann. „Das ist eine Idee. Ich bringe dich um, wenn du versuchen solltest, sie deiner eigenen Redaktion zu verkaufen.“ Dann machte er kehrt und ging davon.
Einer der uniformierten Männer kam herangehetzt. Ihm war anzusehen, dass er soeben über Funk eine wichtige Durchsage erhalten hatte. Die Reporter spitzten die Ohren, aber Inspektor Südermann zog den Mann soweit zur Seite, dass kein Unbefugter hören konnte, was gesagt wurde.
„Ein Toter ist gefunden worden, in der Nähe vom Nollendorfplatz. Engels Visitenkarte liegt dabei.“
„Weiß man, wer der Mann ist?“
„Nein, noch nicht. Wilhelm Krone ist bereits unterwegs zum Tatort.“
„Armer Wilhelm“, sagte der Inspektor grimmig. „Er wird sich dort mit den gleichen Problemen und den gleichen Leuten herumschlagen müssen wie ich.“ Er wandte sich mit einem Anflug von Schadenfreude den Reportern zu. Er sagte ihnen, was geschehen war und grinste matt, als er beobachtete, wie die Meute davonstob, um den neuen Tatort zu erreichen. Dann ging er hinüber zu dem Toten, der jetzt im gleißenden Licht der Scheinwerfer lag und fragte sich, was Engel veranlasst haben mochte, einen Mann wie Berthold Fischer abzuservieren.
––––––––
3
Sie war nackt, als sie das Badezimmer verließ. Die Art, wie sie sich bewegte, graziös und herausfordernd kokett, machte klar, dass sie sich ihrer Jugend, ihrer Schönheit und ihrer Wirkung durchaus bewusst war, und dass sie gelernt hatte, daraus optimalen Nutzen zu ziehen. Sie blieb auf der Schwelle stehen, lächelnd, lehnte sich gegen den Türrahmen und fragte: „Musst du wirklich schon gehen?“
Gernot Ganz saß auf dem Bett. Er zog die Reißverschlüsse seiner schicken, halbhohen Stiefel aus rotbraunem Chevreauxleder zu und grinste matt, als er seine Blicke über Christas makellosen Körper wandern ließ. Sie war ein kleines Biest, sie konnte von der Liebe einfach nicht genug bekommen.
Er schaute auf die Uhr. „Ich muss mich trollen“, sagte er. „Sonst komme ich noch zu spät.“
„Nur noch ein Stündchen – bitte“, sagte Christa und formte ihren herzförmig geschnittenen, roten Mund zu einem schmollenden O. Sie kam auf ihn zu, ihre vollen, hübschen Brüste schwangen provozierend und ließen Gernot Ganz plötzlich bedauern, dass er gehen musste.
Er stand auf. „Es dauert nur ein paar Stunden“, sagte er. „Ich rufe dich an.“
„Kann ich hier auf dich warten?“
„Nein“, sagte er und gab ihr einen Klaps auf den Popo. „Das geht nicht.“
„Du vertraust mir nicht“, beklagte sie sich und legte ihre Arme um seinen Nacken. Sie presste ihren Unterleib gegen seinen Körper und rechnete mit seiner männlichen Reaktion, aber er zog ihre Arme herunter und sagte, diesmal schon weniger freundlich: „Anziehen, los!“
Christas Lächeln fiel in sich zusammen. Sie kannte diesen Ton und hatte gute Gründe zu spuren. Sie zog sich an, dann verließ sie mit Ganz die Wohnung. „Bleib zu Hause, bis ich dich anrufe“, sagte er, stieg in seinen Wagen und fuhr davon.
Christa Zelter war schließlich froh, dass sie ein paar Stunden allein sein konnte. Eigentlich konnte sie Gernot nicht leiden, sie hatte sogar Angst vor ihm, aber er bot ihr zwei Vorteile, die sie nicht aufzugeben wünschte: Er war ein guter Liebhaber, und er war großzügig. Er unterhielt ihre Wohnung, er hatte ihr erst kürzlich einen echten Nerz gekauft, und wenn nicht alles trog, würde er fortfahren, sie mit seinen Gunstbeweisen zu verwöhnen.
Dafür war sie gern bereit, seine speichelnde Aussprache, seinen trotz reichlich verwendeten Körpersprays immer wieder durchbrechenden Schweißgeruch und seine gelegentlichen Wutausbrüche hinzunehmen. Er war ein übler Bursche, sie wusste es. Aber wenn man, wie sie, aus dem Osten stammte und einen Vater hatte, der im Gefängnis saß, eine Mutter, die sich mit Pennern vergnügte, konnte man mehr als zufrieden sein, sich Gernot Ganzs Freundin nennen zu dürfen.
Sie fuhr nach Hause, stellte das Fernsehgerät ein, mixte sich einen Martini und fragte sich, was Gernot wohl an diesem Abend für ein Ding zu drehen gedachte. Sie war froh, keine Einzelheiten zu kennen, wünschte Gernot aber alles Gute, weil es vom Erfolg seines Fischzugs abhing, wie großzügig seine nächsten Geschenkgesten ausfallen würden.
Als es klingelte, ging sie neugierig zur Tür. Sie langweilte sich und freute sich auf eine Abwechslung, egal, wie sie auch beschaffen sein mochte.
Der Besucher, dem sie sich gegenübersah, war ein Mann Ende der Dreißig, groß und schlank, sehr gut angezogen, vielleicht um eine Note zu konservativ, um Christas Geschmack zu treffen, aber sie mochte sein Gesicht, es wirkte hart und melancholisch zugleich, es hatte, wie sie meinte, das gewisse Etwas.
„Sie wünschen?“
Sie erhielt keine Antwort und erschrak, als der Mann einfach über die Schwelle schritt, sie wich vor ihm zurück, prallte mit dem Rücken gegen den Garderobenschrank und fragte: „He, was soll das? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?“
Sie hatte keine Angst. Dazu bestand kein Grund. Erstens wusste sie mit Männern umzugehen, und zweitens glaubte sie nicht daran, dass es jemand darauf abgesehen haben könnte, sie zu berauben. Sie war Gernot Ganzs Freundin. Das wusste man in der Gegend, das verschaffte ihr Respekt und hielt gewisse Leute davon ab, sich an ihr zu vergreifen.
Der Mann drückte die Tür hinter sich ins Schloss. Er war frei von Nervosität, sein markantes Gesicht mit den dunklen, tiefliegenden Augen strahlte Ruhe und Besonnenheit aus. „Gehen Sie ins Wohnzimmer“, sagte er.
Christa gehorchte. Sie setzte sich und wusste nicht, was sie tun sollte. Schreien, toben, wilde Hysterie produzieren? Nein, das würde bei diesem Typ nicht ankommen, er beherrschte auf eine schweigende, unwiderstehliche Art die Szene. Christa konnte nichts Anderes tun, als schweigend darauf warten, was er ihr zu eröffnen gedachte.
„Ein hübsches Liebesnest“, sagte er. Seine Stimme klang verächtlich. Er schaute sich genau um, seine Mundwinkel zuckten dabei, es war Ekel in dieser Reaktion, aber auch ein Anflug von Amüsement, als fände er nur bestätigt, was er sich von diesem Besuch versprochen hatte.
„Wer sind Sie?“, wiederholte Christa fragend.
Er setzte sich ihr gegenüber in einen Sessel, sehr lässig, schlug ein Bein über das andere und musterte sie prüfend. Sein dunkler Regenmantel stand offen. Christa bemerkte unter seinem Jackett eine Ausbeulung, die ihr von Gernot Ganz nur allzu vertraut war. Der Fremde trug ein Schulterhalfter mit Schusswaffe. Das erschreckte und beruhigte sie zugleich, es fiel ihr nicht ganz leicht, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Wenn er ein Verbrecher war, einer von Gernots Zuschnitt, würde sie mit ihm klarkommen, davon war sie überzeugt. Der Bursche konnte ihre Reize nicht ignorieren, sie arbeitete oft genug als Fotomodell und wusste, was die Männer von ihr hielten und wünschten.
Natürlich gab es gewisse Gefahren.
Gernot hatte Feinde, mehr als genug.
Hatten sie vor, ihn zu treffen, indem sie sich seiner Freundin bemächtigten?
Nein, ausgeschlossen! Niemand würde so töricht sein, zu glauben, bei Gernot damit irgendwelche Ziele erreichen zu können. Gernot war scharf auf sie, vielleicht hatte er sich sogar in sie verliebt, aber wenn es ums Geschäft ging, um die Interessen der Bande, der er diente, oder gar um seine persönlichen Belange, würde er nicht die geringsten Skrupel haben, sie zu opfern, das wusste sie. Das wussten sicherlich auch andere.
Ein Polizist? Nein, dafür war er zu gut gekleidet, diese Möglichkeit schloss Christa aus. Sie hatte einen Riecher für Polizisten, der Fremde roch anders.
‚Wie ein Raubtier‘, dachte Christa plötzlich, aber sie verdrängte den Gedanken, es war nur ein dummer Impuls, denn tatsächlich roch der Fremde gar nicht, allenfalls sehr schwach nach einem teuren Rasierwasser ...
„Können Sie nicht sprechen?“, fragte Christa.
„Ich bin Engel“, sagte der Fremde.
Sie starrte ihn fassungslos an, dann lachte sie. Natürlich wusste sie, wer Engel war. Die ganze Stadt sprach davon, und die Zeitungen machten daraus ein Riesengeschäft. Engel hinten und Engel vorn, er dominierte in den Schlagzeilen, er geisterte durch Leitartikel und Fernsehsendungen, er war zu einem Markenartikel geworden, zum Mörder Nummer Eins.
Nur sahen ihn die Leute nicht so, für die meisten war er der einsame Held, der Prototyp des entschlossenen Kämpfers, der Mann, der das Verbrechertum bekämpfte, rücksichtslos, ohne fremde Hilfe, der Mörder mit dem Glorienschein.
„Sie machen Witze“, murmelte Christa.
Sie spürte ein seltsames Kribbeln auf ihrer Haut, aber noch immer keine Angst.
Er war ein Mann. Ein Mann besonderer Art. Dass er getötet hatte, schreckte sie nicht. Es hieß auch von Gernot, dass sein Weg mit ein paar Leichen gepflastert sei, damit musste man in solchen Kreisen fertig werden.
‚Wenn du es richtig anstellst, wird er dich begehren‘, dachte sie. ‚Vielleicht opfert er sogar Gernot, um dich zu bekommen ...‘
Sie war unsicher und leicht nervös. Was ging bloß in dem Burschen vor, was wollte er hier? Er sah gut aus, daran gab es nichts zu rütteln. Wenn seine Potenz mit seinem Äußeren Schritt hielt, bot sich die Perspektive eines aufregenden Abenteuers ...
„Ja, ich bin Engel“, sagte der Mann und lächelte zum ersten Male auf eine müde, düstere Weise, die ihn merkwürdigerweise recht anziehend erscheinen ließ. „Engel, der Rächer. Ich nehme an, Sie haben von mir gehört.“
„Die ganze Stadt spricht von Ihnen.“
„Das ist meine Absicht“, nickte er. „Ich will, dass die Verbrecher sich in die Hosen machen, dass sie endlich aufhören, Berlin zu terrorisieren.“
„Was – was hat das mit mir zu tun?“, fragte Christa mit bebender Stimme.
„Eine ganze Menge“, sagte er und schaute sie an. „Sie sind eine Gangsterbraut.“
Christa schoss die Röte ins Gesicht. Sie wusste selbst sehr gut, was sie war, aber die Worte des Besuchers machten ihr mit einem Schlag bewusst, in welcher Gefahr sie sich befand. Sie begriff, dass er vorhatte, seinen Krieg gegen die Unterwelt auszuweiten. Er übernahm den Begriff der Kollektivschuld, er bezog die unmittelbare Umgebung der Verbrecher in sein Feindbild ein.
„Ich bin nur ein Mädchen, das ...“, begann sie lahm, aber der Besucher fiel ihr barsch ins Wort.
„Sie sind ein mieses, kleines Flittchen. Mir wäre das egal, wenn Frauen wie Sie nicht diese Bastarde ermutigten, wenn Frauen wie Sie diesen Mistkerlen nicht noch Mut machen würden, ihr dreckiges Handwerk fortzusetzen. Sie kosten ihn eine Menge Geld, was? Ich brauch mich hier nur umzusehen, um zu wissen, wie Sie leben. Wie die Made im Speck.“ Er stand auf und öffnete die Tür des Einbauschrankes, er riss den Nerz heraus, warf ihn zu Boden und trat darauf. „Wer musste sterben, damit Sie dieses Scheißding tragen können – wer?“, stieß er hervor.
Christa war entsetzt. Ihre Furcht nahm zu. Sie begriff, dass es um ihr Leben ging. Engel machte nicht den Eindruck, als ob ihn weibliche Reize fesseln könnten. Seine Stimme war nicht sehr laut, aber schneidend, hasserfüllt und kalt. Es war die Stimme eines Mannes ohne Mitleid, ohne Gefühle, die Stimme eines Mörders.
„Gehen Sie zum Telefon“, sagte er.
Christa gehorchte. Sie hatte keine Ahnung, was Engel beabsichtigte, aber ihre Furcht blieb, das Wissen um ein schreckliches Ende.
„Wählen Sie die Nummer der Mordkommission“, forderte er. „verlangen Sie Inspektor Südermann. Ich sage Ihnen, was Sie ihm mitteilen werden.“
Er nannte ihr die Nummer, und Christa wählte mit zitterndem Finger, was er ihr auftrug. Sekunden später hatte sie den Inspektor an der Strippe.
„Sagen Sie ihm, dass Sie in meinem Auftrag handeln und sprechen“, zischte er und trat dicht hinter sie, „aber nennen Sie nicht Ihren Namen.“
Er zog seinen Revolver aus dem Schulterhalfter. Christa bekam schwache Knie, sie hätte sich am liebsten hingesetzt, aber sie wagte nichts zu tun, was den Unwillen ihres Besuchers erregen konnte. Er war auch so schon wütend genug, ein Bündel von Hass. Christa starrte auf die Waffe. Ihr Gold hatte einen rötlichen Glanz. Es war eine schreckliche Vorstellung zu wissen, dass damit schon viele Menschen getötet worden waren. Sollte sie die nächste sein?
„Engel ist bei Ihnen?“, fragte der Inspektor, nachdem Christa sich mit bebender Stimme ihres Auftrages entledigt hatte. Er war nicht versucht, das Ganze für einen Witz zu halten. Er hatte ein Ohr für Zwischentöne und spürte, dass die Angst in der Stimme der Anruferin nicht gespielt war.
„Ja“, sagte Christa, hörte sich an, was der Mann ihr zuflüsterte und wiederholte: „Ich soll Ihnen mitteilen, dass der Mord bei der Nolle nicht auf sein Konto geht. Das war jemand, der sich auf diese Weise ein Alibi verschaffen wollte. Engel hat nur Bert umgelegt – und das zu Recht.“
„Ich verstehe“, sagte der Inspektor. „Lassen Sie mich mit ihm reden, bitte.“
„Er will mit Ihnen reden“, sagte Christa und schaute Engel an.
Der drückte plötzlich ab, zweimal, ganz kurz hintereinander. Das Mädchen riss den Mund auf, hatte aber nicht mehr die Kraft zu schreien. Sie brach zusammen, versuchte noch einmal hochzukommen, aber die Reflexbewegung zerbrach am jähen, mitleidlosen Zugriff des Todes. Sie sackte zurück und rührte sich nicht mehr.
Der Mann steckte die Waffe zurück ins Schulterhalfter und griff nach dem in der Luft baumelnden Telefonhörer.
„Inspektor?“, fragte er leise. So sprach er immer, wenn er mit den Behörden telefonierte. Man hatte wiederholt seine Stimme auf Band geschnitten und mehr als hundertmal über alle Rundfunkstationen gesendet, aber keiner der zahlreichen Hinweise und Verdächtigungen hatte auf die Spur des Täters geführt.
„Sie haben sie getötet“, sagte Inspektor Südermann. „Dafür wird man Sie zur Verantwortung ziehen, für diesen und für alle anderen Morde!“
Er kam sich idiotisch vor. Warum sagte er das? Erstens war es sowieso selbstverständlich, und zweitens konnte er nicht erwarten, damit auf den Mörder irgendwelchen Eindruck zu machen.
Der Engel hatte seine eigenen Gesetze. Er fand immer mehr Geschmack an ihnen, er war offenbar schon so weit gekommen, dass er pro Woche mindestens einen Mord verübte.
„Nun halten Sie mal die Luft an, Inspektor“, meinte Engel. „Ich tue nur, was Sie gern tun würden – wenn das lasche, bürgerfeindliche Gesetz Sie nicht daran hinderte. Wir sitzen in einem Boot. Diese Stadt wird erst dann wieder zur Ruhe kommen, wenn das Verbrechen begriffen hat, dass ihm keine Chancen bleiben. Wir müssen härter sein als unsere Gegner, wir müssen sie ausrotten. Sie werden sich fragen, weshalb ich Bert erledigte. Sie werden behaupten, er sei nur ein kleiner Handtaschenräuber gewesen. Aber er hat eine alte Frau niedergeschlagen, mit den Fäusten. Morgen oder übermorgen würde er ein Messer, und in ein paar Wochen eine Pistole benutzt haben. Ich bin nicht bereit zu warten, bis aus kleinen Ganoven große Gangster werden. Und noch eins, Inspektor. Ich führe jetzt einen gnadenlosen Krieg gegen alle diejenigen, die das Verbrechertum auf ihre Weise, wenn auch nur auf Nebengleisen, ermuntern. Ich kämpfe gegen Gangsterbräute und Hehler, gegen alle, die das Verbrechen glorifizieren und von ihm profitieren. Sagen Sie das der Presse. Mädchen vom Schlage einer Christa Zelter müssen ab heute zur Kenntnis nehmen, dass ihre Verbindungen zur Unterwelt tödliche Folgen haben werden. Das wird die Gangster früher oder später isolieren. Ja, ich kämpfe jetzt auch an dieser Front.“
Er wartete die Antwort des Inspektors nicht ab, er legte auf. Die Telefonfahndung lief sicherlich bereits auf Hochtouren, es wurde Zeit, dass er verschwand.
––––––––
4
Der Chefredakteur hieß Boris Karger. Er war ein großer, gelehrtenhaft aussehender Mann, aber wenn man genau hinschaute, merkte man sehr rasch, dass sein Intellekt im Wesentlichen von Härte und Vitalität getragen wurde. Er war ein Ellbogenmensch, ein Mann aus Granit.
„Setzen Sie sich, Schuster“, sagte er und hielt Bernd eine offene Zigarrenkiste hin. „Neuester Import. Schmuggelware aus Kuba. So was rauchen dort nur die großen Bonzen. Probieren Sie mal.“
Bernd schüttelte den Kopf. Er saß Karger in dem bequemen Besucherstuhl gegenüber. Zwischen ihnen war der überdimensionale Schreibtisch mit vier Telefonen – eines davon rot –, und um sie herum war die englisch anmutende Eleganz eines riesigen, mahagonigetäfelten Privatbüros.
„Ich rauche auch nur Zigaretten“, meinte Karger, stellte die Kiste beiseite und fuhr fort: „Es geht um den Mann, den alle Welt nur Engel nennt. Ich möchte, dass Sie ihn für uns finden.“
„Für Sie?“, fragte Bernd. Es klang amüsiert. Er hatte geahnt, was ihn hier erwartete. Für die Presse war das Verbrechen in erster Linie ein Geschäft und erst in zweiter Linie ein Stück Informationspolitik.
„Genau, für die Zeitung, exklusiv für mein Blatt“, sagte Boris Karger. „Sie kennen unsere Devise. Den anderen immer um eine Nasenlänge voraus sein. Engel ist in. Er selbst beliefert uns täglich mit den neuesten Schlagzeilen, er kurbelt das Geschäft an, eigentlich müssten wir dem Burschen für jede Tat eine dicke Provision zahlen – aber natürlich haben wir auch ethische Aufgaben wahrzunehmen. Die Aufklärung des Publikums zum Beispiel. Es fängt an, Engel für einen Volkshelden zu halten. Das ist schlecht.“
„Sehr schlecht sogar“, meinte Bernd, „aber wenn das so ist, muss wohl der Presse die Schuld gegeben werden. Sie hat Engel zu einem einsamen Helden hochstilisiert, zu dem Einzelgänger, der es übernommen hat, jene Aufgabe zu lösen, die die Polizei anscheinend nicht mehr im Griff hat.“
„Anscheinend?“, höhnte Karger. „Sie machen mir Spaß. Seien wir ehrlich. Die Unterwelt Berlins tanzt den Bürgern auf der Nase herum. Mir kommt es vor wie in der Weimarer Republik, als die sogenannten Ringvereine die ganze Stadt in der Hand hielten. Wollen Sie meine private Meinung hören? Ich bin froh, dass es Engel gibt. Vor dem haben die Verbrecher Angst, er ist der einzige, der es schafft, ihnen schlaflose Nächte zu bereiten.“
„Übertreiben Sie da nicht ein wenig? Es gibt in dieser Stadt viele Kriminelle und es sieht so aus, als kämen immer mehr von Ost und West in die Stadt. Die kümmern sich einen feuchten Schmutz um Engel, die denken nicht mal im Traum daran, dass es eines Tages ausgerechnet sie erwischen könnte.“
„Nach zehn Morden werden sie daran denken, und nach zwanzig werden sie sogar zu überlegen beginnen, ob es nicht klüger sei, einfach auszusteigen.“
„Ich fürchte, Sie begehen eine grobe Fehleinschätzung dieser Kreise“, sagte Bernd Schuster.
„Mir geht es auch nicht um die Verbrecher dieser Stadt, ich möchte über Engel schreiben und schreiben lassen“, sagte Karger. „Dazu bedarf es Ihrer Hilfe. Sagen wir pro Tag hundert Mark plus Spesen – ist das ein Angebot?“
„Daraus könnte sich für mich unter Umständen eine Lebensstellung entwickeln“, spottete Bernd. „Sie kennen den Sachverhalt so gut wie ich. Diejenigen, die Engel bislang gesehen haben, sind tot. Seine Stimme bringt uns nicht weiter – eine leise, männliche Stimme ohne Akzent, ohne besondere Merkmale. Keine verwertbaren Spuren an den Tatorten, ausgenommen seine Visitenkarten mit dem goldenen Aufdruck ENGEL und diesem lächerlichen Flügel daneben. Die Polizei weiß, dass diese Karten vor neun Monaten in einer Druckerei in Nürnberg hergestellt wurden – nachts, als sich kein Betriebsangehöriger in den Räumen befand. Man schließt daraus, dass Engel sich früher in dieser Branche betätigte, dass er möglicherweise Drucker oder Druckereibesitzer war, aber eine Überprüfung aller Vorbestraften aus diesem Gewerbe hat ebenfalls keine verwertbaren Hinweise gebracht. Wo soll ich beginnen?“
„Das ist Ihre Sache“, meinte Karger. „Ich denke, Sie sind das Beste, was diese Stadt an Privatdetektiven zu bieten hat? Denken Sie bloß mal darüber nach, wie viel Eigenreklame für Sie bei dieser Aktion anfallen wird. Bernd Schuster jagt den Engel! Das ist doch was, oder?“
„Es könnte ein Reinfall werden. Für Sie und für mich.“
„Angst?“
„Sie scherzen.“
„Zu wenig Selbstvertrauen?“
„Mir gefallen Ihre Motive nicht“, sagte Bernd.
Karger hob erstaunt die Augenbrauen. „Das haut mich um“, sagte er. „Ich zahle Ihnen pro Tag hundert deutsche Mark, damit Sie den gefährlichsten Killer der Stadt jagen, und Sie beanstanden meine Motive?“
Bernd grinste unlustig. „Machen wir uns nichts vor“, sagte er. „Sie wollen gar nicht, dass ich den Engel finde. Sie brauchen ihn als Schlagzeilenfabrikant, als Mörder anderer Verbrecher, er ist lebend und frei für Sie sehr viel wertvoller als aktionsunfähig hinter Gittern.“
„Zugegeben, genauso ist es“, meinte Karger grinsend. „Aber Sie haben immerhin die Chance, mich aufs Kreuz zu legen und mir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wenn Sie den Engel schnappen sollten, kann meine Zeitung gleichfalls davon profitieren. Wir werden dann in alle Welt hinausposaunen, dass es unserem Detektiv gelungen sei, den Killer zu stellen – und nicht der Polizei.“
„Das ist Ihr gutes Recht“, sagte Bernd.
„Ihr Name würde dabei nicht zu kurz kommen.“
„Okay, ich akzeptiere den Auftrag“, sagte Bernd, „aber nicht, um den von Ihnen genannten Zielen und Möglichkeiten willen, sondern weil ich eine Eskalation des Terrors verhindern möchte. Sie hat bereits begonnen. Gestern Abend wurde am Nollendorfplatz ein Mann ermordet – angeblich von Engel, aber ich habe vor einer Viertelstunde vom Revierleiter erfahren, dass Engel dabei nur als Alibifunktion dienen sollte. So wird es weitergehen. Und es wird, fürchte ich, noch schlimmer kommen!“
„Noch schlimmer?“
„Sicher“, nickte Bernd grimmig. „Die kleinen Gauner werden um sich ballern, sobald ihnen ein Verdächtiger nur in die Nähe kommt. Wir gehen reizenden Zeiten entgegen.“
Karger grinste unlustig. „Es liegt an Ihnen, das zu ändern“, meinte er.
„Okay“, sagte Bernd und stand auf. „Ich fange am besten gleich damit an.“
„Sie haben schon einen Anhaltspunkt?“, staunte Karger beeindruckt.
Bernd Schuster schüttelte den Kopf. „Nur ein Ziel“, sagte er. „Das ist mein Freund Horst. Inspektor Südermann. Sie kennen ihn. Er leitet das eigens gebildete Sonderdezernat, bei ihm laufen alle Fäden jener Verbrechen zusammen, die Engel verübte oder die Engel zugeschrieben werden. Ich werde mich einen Tag lang in die Akten vertiefen und versuchen, irgendwo den kleinen, winzigen Anhaltspunkt zu finden, den andere bislang übersehen haben.“
„Viel Glück“, sagte Karger mit einem Anflug von Spott. „Sie werden es brauchen können.“
––––––––
5
Gernot Ganz streifte die Handschuhe über und musterte im Vorübergehen die alten, vornehmen Häuser des Viertels. Hier wohnte die Nobilität, hier lebten die Menschen, deren Namen man immer wieder in den Gesellschaftskolumnen der Zeitungen wiederfand, die Reichen und die Superreichen. Die wenigsten von ihnen leisteten es sich, diese Stadtwohnungen häufig zu nutzen, sie überließen die repräsentativen Bleiben ihrem Dienst- und Wachpersonal, von den teuren Einbruchssicherungen ganz zu schweigen.
Die Stadt war diesen prominenten Bürgern zu laut und zu unsicher geworden, sie zogen es vor, im Westen zu leben, auf kleinen und größeren Bevölkerungsinseln, die von privaten Sicherheitsleuten beschützt und gegen Außenseiter strengstens abgeschirmt wurden. Und am Wochenende nahm man sich den nächsten Flug nach Berlin, feierte ein wenig in der Villa und kehrte in die abgelegene Zuflucht im „Goldenen Westen“ zurück.
Aber hin und wieder übernachteten sie auch ein paar Tage länger hier, wenn sie eine Theateraufführung gesehen und danach in einem exklusiven Nachtklub getanzt hatten, oder wenn dringende Geschäfte sie in der Stadt festhielten. Sie brauchten ja nicht wirklich Angst zu haben, sie hatten ihr Personal, ihre Alarmvorrichtungen – und sie konnten sich mit dem Wissen trösten, dass kaum ein Verbrecher versuchen würde, in dieses gesicherte, zusammenhängende System einzubrechen.
Gernot Ganz grinste matt, als er den winzigen Vorgarten des Hauses passierte und die wenigen Stufen zu der weißgelackten Tür hochstieg. Er betätigte den Messing-Türklopfer und wartete.
Ein Hausdiener öffnete. Der Mann entsprach nicht der landläufigen Vorstellung eines solchen Domestiken, er wirkte eher wie ein Gorilla, und das war er sicherlich auch – ein in Karate und allen anderen Kampftechniken ausgebildeter Mann, der die Aufgabe halte, das Haus und seine Bewohner vor unerwartetem Ärger zu bewahren.
„Sie wünschen?“, fragte er. Die schwere Kette auf der Innenseite blieb vorgelegt.
„Hansen von der Firma Adler Sicherheitssysteme“, stellte Ganz sich vor. Adler war ein bekannter Hersteller von Alarmanlagen und Schlössern.
„Können Sie sich ausweisen?“, fragte der Butler.
Ganz nickte. Er hielt dem Mann einen in Zelluloid geschweißten Ausweis mit Foto unter die Nase.
„Warum so spät?“, fragte der Diener.
„Ich war den ganzen Tag unterwegs“, entschuldigte sich Ganz und steckte den Ausweis ein.
„Wo ist Ihr Werkzeug?“
„Im Auto. Erst mal sehen, was anliegt – dann hole ich mir, was ich brauche“, sagte Gernot Ganz.
Der Mann zögerte immer noch. Irgendetwas schien ihm zu missfallen.
„Was ist?“, murmelte Ganz und tat erstaunt. „Funktioniert die Anlage wieder? Sie haben uns doch angerufen und ausdrücklich um ihre Instandsetzung gebeten ...“
Der Diener nickte, hakte die Kette aus, ließ Gernot Ganz eintreten, schloss hinter ihm sorgfältig die Tür ab und sagte: „Gehen Sie voran, bitte. Die Sicherungskästen befinden sich im Keller, erste Tür links.“
„Können Sie mir mit einer Taschenlampe aushelfen?“, bat Ganz.
Der Diener runzelte die Augenbrauen. Er war groß, breitschultrig, dunkelblond. Das exakt gescheitelte Haar wollte nicht so recht zu seinem bulligen Boxergesicht passen. „Okay“, sagte er. „Ich hole sie aus der Küche.“
Er ging an Ganz vorbei und blieb abrupt stehen, als wüsste er plötzlich, mit wem er es zu tun hatte. Falls ihn eine solche Erkenntnis erhellte, fand er keine Möglichkeit mehr, daraus Profit zu schlagen. Gernot Ganz hatte blitzschnell seinen Revolver hervorgezogen, er rammte ihn mit schmerzhafter Wucht in den Rücken des Gorillas.
„Hoch mit den Händen. Freundchen“, zischte Ganz.
Der Hausdiener gehorchte schweigend. Sein Atmen war deutlich zu hören, es war schon eher ein Schnaufen.
„Du weißt Bescheid. was ich von dir will“, sagte Ganz. „Dreh dich mit dem Gesicht zur Wand, leg die Hände flach dagegen, hoch über den Kopf, und spreize die Beine. Na. bitte! Das klappt doch vorzüglich!“
Ganz klopfte den Mann nach Waffen ab und fand in dessen Gesäßtasche eine kleinkalibrige Pistole. „Du kannst dich wieder umdrehen, großer Mann“, spottete Ganz, steckte die Pistole ein und wies mit dem Revolverlauf in die Diele. „Vorwärts!“
Sie durchquerten die kleine, elegante Diele und betraten das gleichfalls nur mäßig große Wohnzimmer. Die Terrassentür war durch ein schweres, stählernes Scherengitter gesichert.
Der Diener drehte sich langsam um. „Was wollen Sie eigentlich?“, fragte er und ließ die Hände sinken. „Hier gibt es nichts für Sie zu holen!“
„Wetten, dass ...“, höhnte Gernot Ganz, dessen Mundwinkel belustigt zuckten.
„Ich verstehe das nicht“, sagte der Diener. „Wie sind Sie an die Anlage herangekommen? Woher haben Sie erfahren, dass wir um einen Servicemann gebeten haben?“
„Ganz einfach“, spottete Ganz. „An der Anlage selbst haben wir nichts lahmgelegt, die ist von allein ausgefallen. Aber wir sind schon vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, die Telefonleitung der Firma Adler anzuzapfen. Wir haben deren Ausweise gefälscht und nur darauf gewartet, dass sich ein Kunde meldet, der uns potent erscheint.“
„Es ist kein Geld im Hause“, murmelte der Hausdiener. „Nicht mehr als das, was ich in der Brieftasche habe – und das sind ganze neunzig Mark.“
„Aber, aber!“, höhnte Ganz. „Glaubst du im Ernst, ein Mann meines Formats würde sich mit dem mickrigen Taschengeld einer Gorillakopie zufriedengeben? Ich stehe auf Originale. Vor allem auf solche, wie sie dutzendweise im Hause herumhängen. Allerdings werde ich damit zufrieden sein, lediglich vier mitzunehmen. Den Rembrandt, den Tintoretto, den Gainsborough und den kleinen Tizian. Wie findest du das?“
Der Diener schluckte. Seine Augen huschten hin und her, wie kleine, gefangene Tiere im Käfig. Er suchte einen Ausweg, eine Lösung, aber er begriff, dass gegen Waffe und Eindringling nicht anzukommen war, es sei denn, er wäre versessen darauf gewesen, sein Leben zu riskieren.
„Die Bilder“, würgte er schließlich hervor, „sind nur Falsifikate. Die Originale liegen in einem Banksafe.“
„Was du nicht sagst!“, höhnte Ganz. „Dein Boss hat dich schlecht informiert, Freundchen. Ich jedenfalls weiß, was ich mitgehen lassen werde. Du wirst mir die Dinger zum Wagen tragen. Wenn uns jemand sehen sollte, wird deine Anwesenheit der Sache einen würdigen, offiziellen Anstrich geben. Ich bin der Restaurator, falls jemand fragen sollte, der Mann, der jährlich die Kostbarkeiten inspiziert und konserviert ...“
„Ich verstehe Sie nicht“, sagte der Diener und begann zu schwitzen. „Diese Bilder sind weltbekannt, sie sind in jedem Kunstregister aufgeführt und deshalb unverkäuflich ...“
„Ich will sie ja keinem Fremden andrehen, nicht mal einem Kunsthändler“, spottete Ganz. „Ich werde mich mit dem Besitzer einigen – oder mit seiner Versicherung. Ich schätze den Wert der vier Gemälde auf zehn Millionen Mark. Das muss die Versicherung berappen, nicht wahr? Sie kann fünf Millionen sparen, ich werde ihr die Bilder für diesen Preis überlassen.“
Plötzlich explodierte der Hausdiener. Seine Hand zuckte hoch, er versuchte mit ihrer Kante die Waffe aus Ganz‘ Hand zu fegen, aber Ganz war schneller, er drückte ab. Der Schuss weckte in dem Zimmer ein hartes Echo. Der Diener stolperte zurück, dann brach er zusammen. Er blieb liegen, ohne sieh zu rühren.
„Scheiße!“, sagte Ganz laut. Er huschte zur Tür, presste sich mit dem Rücken gegen die Wand und lauschte. Im oberen Stockwerk klappte eine Tür.
„Gerald?“, rief eine Stimme. Eine Mädchenstimme. Ganz biss sich auf die Unterlippe. Er hatte vor dem Unternehmen ein paar Informationen eingezogen. Die Familie machte Urlaub auf den Bahamas. Das Haus wurde nur vom Dienstpersonal betreut – von dem Hausmädchen, dem Diener und dem Chauffeur. Der Chauffeur hatte seinen freien Tag, er hatte das Haus schon am frühen Nachmittag verlassen, und das Mädchen wohnte außerhalb, aber möglicherweise unterhielt es zu Gerald, dem Diener, intime Beziehungen und war übers Wochenende hiergeblieben.
„Gerald?“ Die Mädchenstimme klang besorgt. Auf der Treppe ertönten Schritte, sie erreichten die Diele, sie kamen klickend heran.
Das Mädchen trat über die Schwelle, sah den Mann am Boden liegen und stieß einen halblauten Schreckensruf aus. Er wiederholte sich, als sie den vortretenden Ganz sah. Ganz hatte sich rasch das Taschentuch aus der Hose geholt, er hielt es mit der Linken vor sein Gesicht.
Er sah auf Anhieb, dass er nicht das Hausmädchen vor sich haben konnte. Die Zwanzigjährige, die ihm gegenüberstand, konnte nur die Tochter des Hauses sein. Das sah man am Gesichtsschnitt, an der modischen Aufmachung, aber auch an dem Brillantring, der ihre rechte Hand zierte.
Sie war also von den Bahamas zurückgekommen, aus irgendeinem Grund. Er wusste, dass sie Beatrice hieß. Beatrice Wilde. Ein schönes Mädchen mit schulterlangem leuchtend blondem Haar und großen, lang bewimperten Blauaugen. Die Augen waren sehr klar, beinahe leuchtend, aber in diesem Moment wurden sie von Angst und jähem Entsetzen deutlich verdunkelt.
„Nur keine Aufregung“, sagte Gernot Ganz. „Ihnen wird nichts passieren. Sie sind Beatrice, nicht wahr?“
Das Mädchen nickte und schluckte.
„Sind Sie allein zurückgekommen?“
„Ja.“
„Warum?“
„Ich bin gebeten worden, an der Hochzeit einer Freundin teilzunehmen.“
„Wie schön“, spottete Ganz, der in der Rechten die Waffe, und mit der Linken das Tuch hielt. „Wann findet das Ereignis statt?“
„Übermorgen.“
Er hatte eine Idee. Eine verrückte und möglicherweise gefährliche Idee, aber er konnte ihr nicht widerstehen, er musste sie in die Tat umsetzen. „Ich fürchte“, sagte er, „Sie werden an der Feier nicht teilnehmen können.“
Wieder das angstvolle Schlucken. „Warum?“, hauchte Beatrice.
„Weil ich Sie mitnehmen werde“, sagte er und fragte sich, ob Christa bereit sein würde, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Christas Wohnung eignete sich blendend für das geplante Kidnapping, und Beatrice würde weniger nervös oder hysterisch reagieren, wenn sie herausfand, dass sie durch ein etwa gleichaltriges Mädchen betreut wurde.
„Mitnehmen?“, fragte Beatrice nervös.
„Entführen - Kidnappen – falls Ihnen das Wort besser gefällt“, sagte er und versteckte sein breites Grinsen hinter dem vorgehaltenen Taschentuch. „Werden Sie nicht nervös. Ihnen geschieht nichts, wenn Ihr Alter zahlt – und zahlen wird er. Das ist mal sicher. Er kann und will sich weder den Verlust seiner Tochter noch den seiner Bilder leisten.“
Gernot Ganz begann zu rechnen.
Er beabsichtigte, fünf Millionen Mark für die Rückgabe der Bilder zu fordern und war bereit, in den zu erwartenden, langwierigen Verhandlungen auf drei Millionen herunterzugehen. Dazu würden zwei weitere Millionen für Beatrice kommen – insgesamt also doch fünf.
Der tote Gerald würde den Wildes deutlich machen, dass sie es mit einem Gegner zu tun hatten, der weder Skrupel noch Gnade kannte. Dieser Umstand würde sie gefügig machen, er würde den Verhandlungen den notwendigen Schwung geben.
Selbst wenn er abzog, was die anderen für ihre Teilnahme beanspruchten, konnte er davon ausgehen, den größten Coup seines Lebens gelandet zu haben. Natürlich gab es auch ein paar Schattenseiten, ein paar Negativposten, die noch der Klärung bedurften.
Der Chef hatte sich mit dem Bilderraub einverstanden erklärt, aber es war fraglich, ob ihm die Entführung schmecken würde. Egal! Die Situation war nun mal so. Er musste improvisieren, und der Chef würde einsehen, dass er angesichts der Lage richtig gehandelt hatte.
Jetzt kam es nur noch darauf an, die Bilder und Beatrice zu dem in der Nähe parkenden Auto zu bringen.
Beatrice schloss die Augen und war bemüht, das Zittern zu unterdrücken, dessen Opfer sie zu werden drohte. Sie glaubte zu wissen, dass es sinnlos sein würde, um Gnade zu betteln. Sie konnte nur hoffen, dass das Drama für sie weniger blutig als für den armen Gerald enden würde. Sie hatte den Hausdiener nie leiden können, er war ihr sogar zuwider gewesen, aber sein Tod entsetzte und schockierte sie.
Gernot Ganz schob den Revolver in den Hosenbund und steckte das Taschentuch ein. Er war sich über die Risiken seines Vorgehens klar, nahm sie jedoch bewusst in Kauf. Er trat an die Terrassentür und riss die seidenen Gardinenkordeln herab. „Setzen Sie sich“, befahl er.
Beatrice gab sich einen Ruck. Sie wirbelte herum und jagte in die Diele. „Hilfe!“, schrie sie. „Hilfe.“
Sie erreichte die Tür noch vor dem nachsetzenden Ganz, aber ihre zitternden Hände schafften es nicht, die Kette auszuhaken. Ganz packte sie am Arm und riss sie herum. Die flache Hand klatschte auf Beatrices Wange, ein zweiter Schlag traf ihre Nase. Sie torkelte wie betäubt zurück, ihre Augen wurden groß und rund, sie konnte sich nicht erinnern, jemals von einem Mann geschlagen worden zu sein.
„Wenn du noch mal solche Zicken machst“, versprach Ganz zähneknirschend, „feg ich dich unter den Teppich.“
Sie folgte ihm ins Wohnzimmer, ließ sich widerstandslos an einen Stuhl fesseln und sah dann zu, wie der Eindringling die Bilder von der Wand nahm. Er musste mit einer kleinen Zange, die er seiner Tasche entnommen hatte, die Drähte zerschneiden, die die Bilder mit der Alarmanlage verbanden, aber da die Anlage ausgefallen war, blieb diese Tätigkeit ungeahndet.
Ganz stellte die schweren, mit barocken, vergoldeten Rahmen versehenen Bilder in der Diele ab, dann kehrte er ins Wohnzimmer zurück.
Er knebelte das Mädchen. Er ging sehr gelassen dabei vor, er war sichtlich nicht in Eile und legte Wert darauf, sich als Mann von Ruhe und Übersicht darzustellen.
Danach besorgte er sich ein paar Wolldecken, wickelte die Gemälde damit ein, dann trug er sie einzeln zu dem in der Nähe parkenden Wagen.
Obwohl ihm viele Passanten begegneten, gab es keinen, der sich für ihn oder das transportierte Gut interessierte, jedenfalls registrierte Gernot Ganz nur ein paar flüchtige, zerstreute Blicke.
Er legte die Bilder behutsam in den kleinen, eigens für diesen Zweck gestohlenen Kastenwagen, kehrte in das Haus der Wildes zurück und befreite das Mädchen von Knebel und Fesseln.
„Aufstehen“, befahl er.
Beatrice erhob sich. Sie musste sich an der Stuhllehne festhalten. ihre Blutzirkulation kam nur mühsam in Gang, außerdem hatte ihre Angst einen Grad erreicht, der in eine Ohnmacht zu münden drohte.
„Wir gehen jetzt zum Wagen“, sagte er. „Sie halten sich dicht an meiner Seite. Mein Finger bleibt am Abzug der Waffe. Falls Sie auch nur den geringsten Versuch machen sollten zu fliehen oder zu schreien, drücke ich ab.“
„Ich – ich werde tun, was Sie mir befehlen“, stammelte Beatrice und hasste sich um dieser Schwäche willen. Weshalb hatte sie sich nicht besser in der Gewalt, warum schaffte sie es nicht, diesem brutalen Killer und Entführer zu sagen, was sie von ihm hielt?
Nein, es hatte keinen Sinn, sich in missverstandenem Heldentum zu üben, sie musste sich dem Mann unterordnen, sie hatte keine Wahl.
„Ziehen Sie den Mantel an und setzen Sie sich ein Kopftuch auf“, befahl Ganz. Das Mädchen war ihm einfach zu hübsch, die Nachbarn kannten es, er hatte keine Lust, mit ihr aufzufallen. Ein Kopftuch würde diese Gefahr zumindest mildern.
Beatrice tat, was er von ihr verlangte, dann verließen sie das Haus. „Wie alt sind Sie?“, fragte Ganz unterwegs. Es begann zu regnen. Das war gut, denn es zwang die Straßenpassanten zur Eile, sie hatten weder Zeit noch Lust, sich um Entgegenkommende zu kümmern.
„Einundzwanzig“, sagte Beatrice.
„Verlobt?
„Nein. – Wohin bringen Sie mich?“
„Zu einer Freundin. Es wird Ihnen gutgehen“, versicherte er.
„Haben Sie keine Angst vor dem, was Sie erwartet?“, fragte Beatrice.
„Mich erwarten ein paar Millionen“, spottete er. „Es gibt keinen Grund, sich davor zu fürchten.“
Beatrice schwieg. Es hatte keinen Sinn, mit dem Mann zu reden, zwischen ihnen lagen Welten, die nicht überbrückbar schienen.
Sie erreichten den Wagen. „Steigen Sie ein“, sagte er und half ihr auf den Beifahrersitz. Dann setzte er sich neben sie. Beatrice blickte aus dem Fenster, sie sah die Lichter, die Menschen, alles war greifbar nahe, und doch schien es ihr so, als befänden sich Menschen und Dinge auf einem anderen Stern, sie waren plötzlich unerreichbar geworden.
„Wir fahren jetzt ein Stück durch die Stadt“, sagte er. „Es könnte passieren, dass wir unterwegs gestoppt werden, in diesem Fall geben Sie sich als meine Freundin aus. Vergessen Sie nicht, dass ich bewaffnet bin und nichts zu verlieren habe.“
‚Oh doch, mein Lieber‘, dachte Beatrice. ‚Du hast sehr viel zu verlieren. Dein Leben zum Beispiel. Und ...‘
Weiter kam sie nicht. Ihr Gedankenkarussell stoppte.
Auf der Fahrerseite wurde die Tür aufgerissen. Gernot Ganzs Kopf zuckte herum. Er starrte in die dunklen, tiefliegenden Augen eines Fremden.
„He, was soll das?“, fragte Ganz. Seine Hände lagen am Lenkrad, aber er war bereit, schnellstens nach dem Revolver zu greifen, falls die Umstände es erfordern sollten.
„Herr Ganz, nicht wahr?“, fragte der Fremde. Er trug einen dunklen Regenmantel im Raglanschnitt und hatte ein kleines Sporthütchen auf dem Kopf. Pepitamuster.
Ganz schluckte. Ihn durchzuckte die Erkenntnis, dass etwas schiefgegangen war. Es musste mit Bert zusammenhängen, eine andere Erklärung gab es nicht. Gernot Ganz erstarrte. Bert war vom Engel erschossen worden. Bert musste vorher gesungen haben. Das konnte nur bedeuten ...
Die Schrecksekunde hatte Ganz gelähmt, und sie wurde durch eine weitere Reaktion dieser Art verdoppelt, als plötzlich ein Revolver in der Hand des Fremden auftauchte – eine goldene Waffe.
„Engel!“, murmelte Ganz. Er starrte in die Waffenmündung und wusste, dass seine Uhr abgelaufen war. Er spürte den Druck seines Revolvers und hatte doch keine Chance, sich der Waffe zu bedienen. Engel würde in jedem Fall schneller sein, das stand außer Frage.
„Ja, ich bin es“, sagte der Mann. „Steigen Sie aus, Ganz – oder halt! Warten Sie. Fräulein Wilde, bitte?“
Das Mädchen beugte sich gehorsam nach vorn, atemlos und verwirrt, es hatte mitbekommen, was gesprochen worden war und wusste, was sich hinter dem Pseudonym Engel verbarg, aber es wollte einfach nicht in seinen Kopf hinein, dass das Drama dieser Nacht um einen weiteren, blutigen Akzent bereichert zu werden drohte.
„Ja?“, fragte Beatrice.
Der Mann lächelte dünn. In seinen tiefliegenden, dunklen Augen zeigte sich Bewunderung. Es war zu merken, dass ihn die Schönheit des Mädchens faszinierte. Er sagte: „Nehmen Sie ihm die Waffe ab, bitte – aber Vorsicht, bitte! Er könnte versuchen, mich auszutricksen. Ich möchte Ihnen eine Verletzung ersparen, wenn ich gezwungen sein sollte, ihn jetzt und hier abzuservieren.“
Beatrice benetzte sich die trocken und spröde gewordenen Lippen mit der Zungenspitze, dann zog sie mit hämmernden Herz den Revolver aus Ganz‘ Schulterhalfter. Der Wagen stand zwischen zwei Straßenlaternen, keiner der wenigen Passanten nahm Notiz von den Dingen, die sich an und in ihm abspielten.
„Gut“, lobte der Mann, der an der offenen Fahrertür stand und mit seinem Rücken den goldenen Revolver abdeckte. „Wir gehen jetzt zurück, zurück in Ihr Haus, Fräulein Wilde. Sie gehen voran und öffnen die Tür, ich bleibe direkt hinter unserem Delinquenten.“
„Ich steige nicht aus“, sagte Ganz, der merkte, dass ihm kalter Schweiß ausbrach.
Engel grinste höhnisch. „Wollen Sie hier sterben?“, fragte er.
Beatrice war aus dem Wagen geklettert. Sie kam um das Fahrerhaus herum und hielt die Waffe in der Hand, sie war wie benommen. Das war also Engel, der gefürchtete Killer, das augenblickliche Thema Nummer eins in Westberlin?
Er sah gut aus, fand sie, gut und etwas düster. Er schien dezente Eleganz zu lieben, seinen Sachen war anzusehen, dass sie nicht von der Stange stammten. Der Mann faszinierte sie, aber er machte ihr auch Angst. Er war ein Mörder, er tötete Menschen, dafür gab es keine Entschuldigung, allenfalls eine Motivation.
„Stecken Sie die Waffe ein“, bat er, ohne Ganz aus den Augen zu lassen. „Wir wollen kein unliebsames Aufsehen erregen.“
„Lassen Sie ihn laufen“, hörte sich Beatrice plötzlich bitten. „Sie kennen ja seinen Namen, Sie können ihn verhaften lassen ...“
„Ich weiß etwas Besseres“, sagte der Mann. „Warum verteidigen Sie ihn?“
„Ich hasse ihn“, widersprach Beatrice, „aber das gibt mir kein Recht, ihn zu verurteilen.“
„Sie sind zu edel, zu schwach“, sagte der Mann. „Zum Glück gibt es Männer wie mich, die nichts von solchen Regungen wissen wollen. Ich sage Ihnen auch den Grund. Von derlei Gefühlen profitiert nur die Unterwelt, die Welt der Verbrecher. Es wird Zeit, damit aufzuräumen.“
Ganz mühte sich ab, ruhig zu bleiben. Er musste Zeit gewinnen, er musste es schaffen, seinen Gegner zu überlisten. Nur war es hier, eingeklemmt hinter dem Lenkrad, praktisch unmöglich, eine Basis zum Kontern zu finden, er musste schon aussteigen und den beiden zurück ins Haus folgen, vielleicht ergab sich unterwegs oder am Ziel eine Möglichkeit, mit diesem Wahnsinnigen fertig zu werden.
Der Fremde schob den goldenen Revolver in seine Manteltasche, der Lauf zeichnete sich deutlich unter dem dünnen Stoff ab, er wies geradewegs auf Ganz.
„Okay, gehen wir“, sagte Ganz. Er folgte Beatrice, die hastig voranschritt. Sie hoffte, schnell genug zu sein, um rasch die Polizei informieren zu können, aber Engel sagte plötzlich: „Laufen Sie uns nicht davon, Teuerste. Ich lege Wert darauf, dass Sie in meiner Nähe bleiben.“
Beatrice drosselte ihr Tempo. Sie hatte eine Waffe bei sich, sie konnte versuchen, dem tödlichen Spuk ein Ende zu machen, sie konnte die Stadt von einem Monster befreien, aber ihr fehlte die Kraft für eine solche Tat, sicherlich auch die Legitimation.
Sie war weder Richterin noch Rächerin, sie musste sich dem Geschehen beugen, sie war dem Unbekannten sogar zu tiefstem Dank verpflichtet, denn ohne sein Dazwischentreten wäre es zu der angedrohten Entführung gekommen, wenn nicht zu etwas noch Schlimmeren.
Sie öffnete die Haustür, hielt sie offen und sah zu, wie Ganz an ihr vorbeiging, gefolgt von dem Mann, der die ganze Stadt in Atem hielt.
Die Männer schritten ins Wohnzimmer, dort forderte Engel seinen Gefangenen auf, sich zu setzen. Ganz gehorchte. Er war nervös, er schwitzte stärker als vorher. Er spürte, dass es schwer, wenn nicht gar unmöglich sein würde, den Killer zu überlisten. Der Fremde bewegte sich geschmeidig, er verfügte offenkundig über ausgezeichnete Reflexe. Allein der Umstand, dass er rund zehn Menschen aus dem Weg geräumt hatte, ohne auch nur einen Kratzer davonzutragen, machte deutlich, was dieser Bursche darstellte.
„Wer ist dein Chef?“, fragte Engel. Er hatte den goldenen Revolver aus der Tasche geholt, sein Finger lag am Druckpunkt des Abzugs. Der Tote am Boden schien ihn nicht zu interessieren.
„Ich arbeite allein“, murmelte Ganz, dann raunzte er laut: „Was ist das? Ein Verhör? Das können Sie mit mir nicht machen!“
Der Fremde grinste verächtlich. Er kannte dieses Aufbäumen, diese kläglichen Versuche, Mut und Forschheit zu beweisen. Wenn es erst einmal geknallt hatte, wenn Schmerz und Schwäche kamen, war es mit diesen Demonstrationen männlicher Kraft vorbei, dann waren es schlotternde Wracks, denen nur noch der Fangschuss helfen konnte.
„Bert hat mir was Anderes berichtet“, sagte der Mann, der sich Engel nannte.
„Dieses Dreckschwein“, presste Ganz durch die Zähne, „ich war gleich dagegen, ihn zu beschäftigen. Aber er wollte partout für uns arbeiten, er wollte ‘ne Chance haben, wie er sich ausdrückte. Der Chef hat sie ihm gegeben, er hat ihn zum Abhören der Telefonleitungen herangezogen. Ich bin nicht überrascht, dass das mit Bert schiefgegangen ist.“
„Es geht mit euch allen schief, dafür sorge ich“, sagte der Fremde.
„Was habe ich Ihnen eigentlich getan, Mann?“, fragte Ganz und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. „Ich bin wie Sie. Ein harter Mann, ein Bursche, der der Welt ins Gesicht spuckt. Wir haben die gleiche Mentalität. Ich kann töten, genau wie Sie. Da liegt er, der Hausdiener. Er meinte, mir eins auswischen zu können. Ich habe ihm gezeigt, wie ich reagieren kann.“
Beatrice setzte sich. Da war sie wieder, die Schwäche in ihren Knien, die Unfähigkeit, das Geschehen zu begreifen. Sie fand das Gespräch, das die beiden Männer miteinander – oder gegeneinander – führten, schlechthin unfassbar, es war ein Stück aus der Horrorwelt, und doch war es Wirklichkeit.
„Da ist ein kleiner, nicht unwesentlicher Unterschied“, sagte der Fremde. „Ich töte, um das Verbrechen auszurotten. Sie töten, um sich zu bereichern. Ich bekämpfe das Übel. Sie bekämpfen das Gute.“
„Ist doch Quatsch, ausgemachter Käse“, sagte Gernot Ganz, der langsam wieder Mut fasste, zumindest Hoffnung. Dieser Engel redete zu viel, er hatte offenbar schwächere Nerven, als er zugeben wollte. Engel musste sich, wie es schien, vor dem eigenen Gewissen rechtfertigen, immer wieder, bis er eines Tages, vielleicht schon heute, durchdrehen und im Irrenhaus landen würde.
„Es ist die Wahrheit“, sagte der Fremde.
Beatrice schloss die Augen. Die Männer redeten und redeten, dabei standen beide unter Hochspannung, das fühlte sie deutlich. Der eine, Ganz, wollte Zeit gewinnen, der andere gewährte sie ihm. Warum? Beatrice hob die Lider. Ihr dämmerte, dass Engel die Situation genoss, dass es ihm nur darum ging, sein Opfer zu quälen, vielleicht auch darum, sich vor ihr, dem jungen Mädchen, aufzuspielen.
Aber da war noch ein Punkt. Sie konnte Engel beschreiben, sie würde die erste sein, die in der Lage war, ein präzises Bild des Gesuchten zu liefern. Der Fremde wusste das. Würde er bereit sein, diese Gefahr zu akzeptieren?
„Sie sind ein Mörder, ein Mörder wie ich“, sagte Ganz. „Sie haben nur nicht den Mut, sich das einzugestehen. Sie lieben den Geruch von Blut. Sie brauchen das. Insofern sind Sie schlimmer als ich. Ich töte nur, wenn ich angegriffen werde. Sie töten, weil es Ihnen Spaß macht.“
Der Fremde straffte sich, seine Backenmuskeln traten deutlich hervor. Ganz begriff, dass er zu weit gegangen war. Er hatte Engel die Wahrheit gesagt, aber Engel war nicht der Mann, der sie zu schlucken vermochte.
Der Fremde schoss.
Beatrice schrie. Ihr Schreien wurde von einem zweiten Schuss übertönt. Beatrice schwieg. Fassungslos schaute sie dem Geschehen zu. Der Fremde feuerte fast die ganze Trommel leer, er ließ nur eine Patrone darin zurück.
Ganz‘ Körper wurde von den Schüssen gepeitscht und geschüttelt, das Leben in ihm bäumte sich auf gegen die erbarmungslosen Treffer. Er stürzte zu Boden, ohne den Schmerz des Falles zu registrieren.
Er war tot.
„Dieses Schwein“, keuchte der Fremde. In seinen Augen irrlichterte es wild. „Von so einem lasse ich mich nicht beleidigen. Ich werde ...“ Er schaute Beatrice an und sah die lodernde Angst in ihrem Blick. Er zwang sich zu einem Lächeln. Es wurde nur eine Grimasse daraus, der missglückte Versuch, aus einem kurzen Blutrausch so etwas wie kalte, männliche Überlegenheit werden zu lassen.
„Er hat bekommen, was er verdiente“, sagte er schweratmend, dann ging er auf Beatrice zu, langsam und kaum merklich geduckt, als ziehe ihn die Spannung zusammen. „Und jetzt, meine Liebe, komme ich zu Ihnen ...“
Beatrice zitterte am ganzen Leibe.
Sie wollte aufspringen und davonlaufen, aber die Furcht lähmte sie. Außerdem: Wohin hätte sie fliehen sollen? Hinter ihr befand sich das geschlossene Gitter der Terrassentür, und vor ihr war der Mörder, der Mann mit dem blutrünstigen Blick und dem gnadenlosen Handeln.
Er lächelte immer noch. Allmählich gewann dieses Lächeln an Kraft, es normalisierte sich, es war kaum noch von demjenigen eines anderen Menschen zu unterscheiden, aber Beatrice schöpfte daraus keine Beruhigung. Der Tote lag im Raum, und die Erinnerung an den kurzen, wahnsinnigen Hassausbruch des Rächers lastete wie ein Tonnengewicht auf ihren Schultern.
Der Mann blieb stehen. „Eigentlich“, sagte er, „müsste ich Sie jetzt töten.“
Beatrice zitterte, sie schwieg, ihr Mund war pulvertrocken. Sie hing an den Lippen des Fremden, sie wusste, dass von dort ihr Urteil kommen würde – Tod oder Freispruch.
„Wie gesagt: eigentlich“, spottete der Mann und ließ die Hand mit dem Revolver sinken. „Aber ich töte keine Unschuldigen, es sei denn ...“ Er machte eine Atempause, fast wie ein Schauspieler, der sich der dramaturgischen Wirkung eines solchen Kunstgriffes gewiss ist. „Es sei denn“, fuhr er dann fort, „ich fühle mich gefährdet, bedroht, an der Fortführung meiner Aufgabe gehindert ...“
„Wie sollte ich Sie wohl gefährden?“, würgte Beatrice hervor.
„Sie könnten der Polizei meine Beschreibung liefern. Sie sind der erste Mensch, der dazu in der Lage wäre“, erklärte der Mann.
Beatrice schüttelte den Kopf. „Ich werde es nicht tun, bestimmt nicht“, versicherte sie.
„Man wird Sie durch die Mangel drehen“, sagte er langsam und ohne ihren angstvollen Blick loszulassen. „Man wird Sie mit albernen, aber überzeugend klingenden Argumenten bombardieren, man wird mit allen Mitteln versuchen, Sie zu einer Beschreibung meines Alters, meines Aussehens, meiner besonderen Merkmale veranlassen. Sie werden nichts sagen. Kein Wort. Nicht mal eine Andeutung werden Sie machen. Es genügt, wenn Sie den goldenen Revolver erwähnen.“
„Sie können sich auf mich verlassen“, murmelte Beatrice.
„Das hoffe ich“, sagte er sanft. In seiner Stimme lag ein drohender Unterton.
„Immerhin haben Sie mich aus seinem Zugriff befreit“, sagte Beatrice. „Aus der Macht eines Mörders!“
Er lächelte. „Stimmt. So müssen Sie es sehen. Ich bin froh, dass ich Sie retten konnte. Sie sind das schönste Mädchen, das mir jemals begegnet ist.“
Ein Frösteln kroch über Beatrices Haut. Sie war es gewohnt, männliche Bewunderung zu ernten, aber im Falle des blutrünstigen Unbekannten war ihr diese Reaktion zuwider, sie machte ihr Angst.
„Wirklich“, fuhr er leise fort, „Sie sind das erste und einzige Mädchen, mit dem ich mir ein Zusammenleben vorstellen könnte. Eine Ehe meinetwegen. Im Grunde sollte ich nicht heiraten, ich muss mich meiner Aufgabe widmen, ich muss diese Stadt von der Pest des Verbrechens befreien – andererseits wäre ein Eheschluss, eine Heirat, eine zusätzliche und ganz fabelhafte Tarnung.“
Seine Augen glitzerten, er atmete rascher. Es war zu merken, wie er sich in den neuen Gedanken hineinsteigerte und Gefallen daran fand. „Meine Frau, eine geborene Wilde – das würde sich gut machen, ausgezeichnet. Und zwischen uns gäbe es von Anbeginn klare Fronten. Sie wüssten, wofür ich stehe und kämpfe. Sie könnten mich unterstützen, wir würden ein perfektes Team bilden ...“
Sie starrte ihm in die Augen. Glaubte er, was er sagte? Ja, er glaubte es, man sah es ihm an. Ein Verrückter also, ein Wahnsinniger, den es schnellstens unschädlich zu machen galt?
Er lachte plötzlich, es schien, als habe er ihre Gedanken erraten. „Sie halten mich für verrückt, nicht wahr? Ich bin es nicht. Ich bin nur ein Mann, der seine Ziele kennt und keine Lust hat, Zeit mit romantischem Unsinn zu verschwenden. Ich weiß, dass ich Sie liebe, und ich weiß, dass ich Sie brauche. Sie werden meine Frau werden.“
„Aber ...“, begann Beatrice. Nahm der Alptraum kein Ende? Kamen nach dem Tod des Hausdieners, nach ihrer Entführung und nach dem Mord an dem Kidnapper noch schlimmere Dinge auf sie zu?
Der Mann winkte ab. „Ich bin kein Unmensch“, behauptete er. „Ich stelle in Rechnung, dass die Geschehnisse des Abends Sie verwirrt haben. Ich verlange jetzt von Ihnen keine Entscheidung. Ich fordere nur das Versprechen, dass Sie loyal zu mir halten und mich der Polizei gegenüber absichern. Das andere findet sich später.“
Er trat auf sie zu, beugte sich nach vorn und hätte sie auf den Mund geküsst, wenn Beatrices Reflexbewegung nicht dafür gesorgt hätte, dass seine Lippen lediglich mit ihrer Wange in Berührung kamen.
„Wir werden ein vollkommenes Gespann sein“, sagte er, steckte die Waffe ein, machte kehrt und verließ das Haus.
Beatrice eilte hinter ihm her und legte die Kette vor, dann lehnte sie sich gegen die Türfüllung und begann hemmungslos zu schluchzen.
Die erlösenden Tränen versiegten, als ihr klarwurde, dass sie die Polizei benachrichtigen musste. Sie hastete zurück ins Wohnzimmer und griff nach dem Telefonhörer. Mit bebender Hand wählte sie die Nummer der Polizei. Sie nannte ihren Namen und verlangte einen Beamten der Sonderkommission zu sprechen. Horst Südermann meldete sich. Er machte auch an diesem Abend Überstunden, er war total übermüdet, er wusste, dass er Schlaf brauchte und sich und der Sache keinen Gefallen tat, wenn seine Ruhe zu kurz kam, aber er musste am Ball bleiben, er musste versuchen, dem wachsenden Terror ein Ende zu bereiten.
Beatrice berichtete, was geschehen war. dann stoppte sie abrupt. Warum stellte der Mann am anderen Leitungsende keine Fragen? Es musste doch Dutzende davon geben. Hunderte!
„Rühren Sie nichts an“, sagte der Inspektor lapidar. „Wir kommen.“
Beatrice genehmigte sich einen Cognac, obwohl sie sich sonst nichts aus Alkohol machte, dann begab sie sich in das Arbeitszimmer ihres Vaters, sie hatte einfach nicht die Kraft, mit den Toten allein zu bleiben.
Fünf Minuten später klingelte es. Der erste Streifenwagen traf ein, dann ein zweiter. Zwanzig Minuten später stoppte der Kastenwagen der Mordkommission vor dem Haus. Inspektor Südermann begrüßte Beatrice Wilde, dann stellte er den Mann vor, der ihn begleitete: „Das ist Herr Schuster, ein Freund von mir. Er ist Privatdetektiv und arbeitet am gleichen Fall wie ich – im Auftrag einer Zeitung. Sie haben doch nichts dagegen, dass er sich an den Ermittlungen beteiligt?“
Beatrice schüttelte den Kopf. Sie hörte kaum auf das, was der Inspektor äußerte, sie beobachtete fasziniert, wie die Männer des Morddezernats an die Arbeit gingen, schweigend, sachlich, ohne eine Spur von Erregung. Die Fotografen, der Arzt, die Männer der Spurensicherung.
Der Inspektor, Bernd und Beatrice gingen in das angrenzende Arbeitszimmer, sie setzten sich. Beatrice wiederholte ihren Bericht, diesmal weniger überstürzt, sie war bemüht, sich an jede Einzelheit zu erinnern, sie präzisierte das Geschehen, aber sie machte am Schluss auch klar, dass sie nicht vorhatte, eine Beschreibung des Mörders zu liefern. Aus Gründen, die sie nicht zu definieren vermochte, nahm sie jedoch Abstand davon, das Liebeswerben des Unbekannten zu erwähnen.
„Sie tun sich und uns keinen Gefallen damit, wenn Sie uns seine Beschreibung vorenthalten“, sagte der Inspektor.
„Ich habe es ihm versprechen müssen. Ihnen in diesem Punkt meine Unterstützung zu versagen“, meinte Beatrice. „Ich fühle mich an das Versprechen gebunden.“
„Mördern gegenüber darf es keine ethischen Verpflichtungen geben“, sagte der Inspektor.
„Das kann nicht Ihr Ernst sein. Inspektor. Und wenn Sie so denken sollten, ist das Ihre Sache. Ich für meinen Teil nehme jedes Versprechen ernst.“
„Hm“, machte Horst Südermann und rieb sich das Kinn. „Wie Sie wollen. Ich kann verstehen, wie Ihnen zumute ist. Der Mann hat Sie bedroht. Er würde versuchen, sich zu rächen, wenn Sie ihm in den Rücken fielen. Aber gibt es nicht noch andere Gründe für Ihr Schweigen?“
Beatrice schluckte. „Nein“, sagte sie.
„Ich gehe mal rüber zu meinen Leuten“, meinte der Inspektor seufzend und erhob sich.
Bernd blieb mit dem Mädchen im Raum zurück. Er sagte: „Der Inspektor hat recht. Ich fühle, dass Sie ihm nicht die volle Wahrheit ...“ Er kam nicht weiter, er wurde vom Klingeln des Telefons unterbrochen.
Der Inspektor erschien auf der Schwelle. „Nehmen Sie das Gespräch entgegen, bitte“, wandte er sich an Beatrice.
Beatrice griff nach dem Hörer.
„Ich liebe dich“, tönte ihr eine männliche Stimme entgegen. Dann klickte es in der Leitung. Der Teilnehmer hatte aufgelegt. Beatrice warf den Hörer aus der Hand. Ihr Herz hämmerte lebhaft.
„Wer war es?“, fragte der Inspektor. „Der Engel?“
„Ja, ich glaube“, sagte sie. „Er hat sofort wieder eingehängt.“
„Was sagte er?“
Beatrice setzte sich, sie wich dem Blick des Inspektors aus. „Ich kann nicht darüber sprechen“, meinte sie.
Horst Südermann schien eine heftige Erwiderung auf der Zunge zu liegen, dann machte er abrupt kehrt und verließ den Raum. Bernd lehnte sich zurück. Er stellte keine Fragen, er wartete geduldig.
Beatrice schaute ihn an. „Was soll ich nur machen?“, fragte sie plötzlich hilflos. „Er will mich heiraten. Er muss den Verstand verloren haben. Heiraten! Ihn! Das ist einfach unvorstellbar ...“
Bernd zuckte mit den Schultern. „Nehmen Sie das nicht ernst“, empfahl er. „Er kann es sich nicht leisten, aus dem Untergrund aufzutauchen.“
„Wer sagt das? Dieser Mann hat einen unbändigen Willen. Er könnte mich zwingen, ihm in den Untergrund zu folgen – oder in ein anderes Land.“
„Hat er etwas in dieser Richtung geäußert?“
„Nein“, sagte sie und unterdrückte ein Zittern. Sie fürchtete sich vor dem Unbekannten. Der Gedanke, dass sich ein Massenmörder in sie verliebt hatte und entschlossen war, sie zu erobern, verursachte ihr eine Gänsehaut, ein Gefühl von Ekel, Abscheu und Terror.
„Ich behalte Sie im Auge“, versprach Bernd Schuster.
„Sie müssen mir versprechen, nichts von meinem Geständnis zu erwähnen“, bat sie flehend. „Wenn Engel aus den Zeitungen erführe, dass er mir einen Heiratsantrag gemacht hat, wäre mein Leben gefährdet. Er ist eitel. Er könnte es nicht verwinden, zur Zielscheibe journalistischen Spottes gemacht zu werden.“
„Keine Angst“, sagte Bernd. „Ich halte dicht.“
––––––––
6
Friedrich W. Carlson betrachtete sich im Spiegel. Er empfand sein Gesicht wie eine lebendige, faszinierende Landschaft, er konnte es täglich mehrere Male betrachten, prüfend und hingebungsvoll, er zeichnete mit seinen Blicken jede Linie und jedes Fältchen nach, es stimmte ihn geradezu feierlich, zu wissen, dass er Berlin in Atem hielt, und dass es ihm gelungen war, zum Mann des Jahres zu werden.
Ein großes Nachrichtenmagazin beabsichtigte, sein Konterfei auf der Titelseite zu bringen: Einen Mann ohne Gesicht, der einen goldenen Revolver in der schwarz behandschuhten Rechten trug.
Friedrich W. Carlson lächelte genüsslich. Er hatte es geschafft, er war jetzt ganz oben. Er litt zwar unter der erzwungenen Anonymität, es schmerzte ihn, sich niemand offenbaren zu können, andererseits war es ein erhebendes Gefühl, den Rhythmus der Stadt gestört und sich zu ihrem neuen Helden ernannt zu haben.
Denn ein Held war er für die meisten, das spürte er genau, das las er zwischen den Zeilen der Zeitungsartikel, das hörte er aus Radiokommentaren heraus, das erfuhr er, wenn es ihm gelang, den Mann auf der Straße zu belauschen.
Natürlich gab es Besserwisser. Moralapostel und Tugendwächter, natürlich gab es den Haufen der Studierten, die in ihm einen gemeinen Mörder sahen, aber die Meinung dieser Leute interessierte ihn nicht. Es war ihm gelungen, diese ewigen Studentendemonstrationen von den Titelseiten zu verdrängen. Auf allen Zeitungen führter er die Schlagzeilen an. Was hatten die anderen denn getan, um das Verbrechen in der Stadt zu stoppen? Sie hatten immerzu nur geredet und geschwätzt, sie hatten schlaue Theorien entwickelt, aber mit bloßer Klugscheißerei ließ sich das Verbrechen nicht eindämmen.
Er hatte als erster den Mut gefunden, den Verbrechern auf breiter Front Paroli zu bieten. Er hatte den Terror des Verbrechens mit Gegenterror beantwortet, er hatte es erreicht, Furcht und Unsicherheit in die Reihen der Kriminellen zu tragen.
Friedrich W. Carlson musterte sich ein letztes Mal im Spiegel, dann setzte er sich in die Küche seines großen, eleganten Apartments und säuberte seinen goldenen Revolver. Er öffnete dabei das zum Hof weisende Fenster, um den penetranten Geruch des Gewehröls abziehen zu lassen.
Als es klingelte, zuckte er kaum merklich zusammen. Er schaute auf die Uhr. Zehn nach zehn. Er erwartete keinen Besuch. Es war Dienstag – oder Mittwoch? Mit seinem Zeitsinn stand er auf Kriegsfuß, seitdem seine Vermögensverhältnisse es ihm gestatteten, sich dem Müßiggang zu widmen. Er war wohlhabend, sogar reich. Bei kluger Einteilung seiner Erbmasse konnte er seinen Lebensabend als gesichert betrachten.
Er wickelte die goldene Waffe in ein Tuch, legte sie mitsamt dem Ölkanister in die Backröhre des Küchenherdes, schnupperte missmutig an seinen Fingern und ging dann in die Diele, um die Tür zu öffnen.
Vor ihm stand ein Fremder, ein schlanker, hochgewachsener Mann von geschätzt fünfundvierzig Jahren.
„Sie wünschen?“, fragte Friedrich Carlson knapp.
„Sie sprechen“, sagte der Mann und lächelte spöttisch. Carlson fand, dass die Stimme des Besuchers herausfordernd klang und spürte ein eigenartiges Ziehen in der Herzgegend.
Ein Polizist?
Ausgeschlossen! Wenn jemand darauf gekommen sein sollte, dass er, Friedrich W. Carlson, identisch mit Engel war, würde der Betreffende es schwerlich wagen, allein in der Höhle des Löwen aufzukreuzen.
Der Mann war gut gekleidet. Sein rundes, glattrasiertes Gesicht wurde von der schmalen Krempe eines weichen Filzhutes beschattet. Er trug einen knielangen, braunen Popelinemantel.
„In welcher Angelegenheit?“, fragte Carlson.
„Das“, meinte der Fremde und zog blitzschnell eine Pistole aus seiner Manteltasche, „sage ich Ihnen am besten in Ihrer Wohnung.“
Carlson starrte in die Waffenmündung und bedauerte, seinen Revolver nicht bei sich zu haben. Er war eher verblüfft als erschrocken, eher erstaunt als ängstlich. Der Fremde konnte unmöglich wissen, wen er vor sich hatte.
Friedrich W. Carlson biss die Zähne aufeinander. Hohn und Mordlust wallten in ihm auf. Der Mann würde seine Frechheit mit dem Leben bezahlen müssen, das stand jetzt schon fest ...
Carlson machte kehrt, er ging in die Küche. Er musste an seine Waffe herankommen, um jeden Preis.
„Stopp“, sagte der Mann, der ihm über die Schwelle gefolgt war. Carlson blieb stehen und wandte sich um. Der Fremde verzog das Gesicht, er bewegte schnuppernd die Nasenflügel. „Gewehröl. Das gute, alte Balistol“, stellte er fest.
„Ich habe nicht mehr als hundert Mark in der Wohnung“, erklärte Carlson, der nur zwei Schritte neben dem Küchenherd stand. „Die können Sie haben.“
Der Besucher lachte. „Hundert Mark!“, höhnte er.
„Sie wollen mehr?“, fragte Carlson stirnrunzelnd.
„Aber ja“, sagte der Mann. „Ich will Ihr Leben, Engel.“
––––––––
7
Friedrich W, Carlson war es zumute, als träfe ihn ein tonnenschwerer Rammbock im Zentrum seiner Magengrube. Er musste sich setzen, er blinzelte, plötzlich hatte er Atembeschwerden. Der Schwächeanfall ging vorüber, aber der Terror blieb. Wer war der Eindringling, und wie hatte er herausgefunden, wer sich hinter dem Pseudonym Engel verbarg.
„Sie sehen schlecht aus, Meister“, spottete der Mann. „Offenbar missfällt Ihnen die Erkenntnis, auf der falschen Seite einer Waffenmündung zu stehen.“
„Wer sind Sie?“
„Nennen Sie mich Horst. Das ist zufällig mein richtiger Name. Wo steckt Ihre Waffe?“
„Ich habe keine“, behauptete Friedrich W. Carlson mit trocken gewordenen Lippen. „Wie, zum Teufel, kommen Sie darauf, dass ich Engel sein könnte? Das ist ein Witz – und kein sehr guter, wie ich hinzufügen darf.“
Der Mann grinste höhnisch. Carlsons Herz klopfte hoch oben im Hals. Er hatte gemeint, die Stadt und deren Kriminelle wie Marionetten an Drähten zappeln zu lassen und musste plötzlich entdecken, dass es kein Monopol auf den Terror gibt.
„Dass die anderen noch nicht dahintergekommen sind – kaum zu glauben!“, seufzte der Mann.
„Was meinen Sie damit?“
„Ich meine damit, dass es leicht war, Sie aufzuspüren. Wissen Sie, wie lange ich dazu benötigte? Genau drei Wochen. Wie Sie sehen, bin ich ein Profi.“
Carlsons Gedanken wirbelten durcheinander. Er zwang sich dazu, nicht auf den Herd zu blicken. Er musste jetzt die Dinge in den Griff bekommen, rasch und zielstrebig, sonst lief er Gefahr, aus dem Helden des Jahres zur Leiche des Jahres zu werden.
„Sie sind nicht hergekommen, um mich zu töten“, murmelte er mit schmalen Augen.
„Nein, wirklich nicht?“
„Ein Mörder redet nicht, er handelt.“
„Sie müssen‘s ja wissen.“
„Sie wollen Geld!“
„Kann schon sein“, spottete der Mann. „Was können Sie lockermachen?“
„Eins vorab“, sagte Carlson. „Sie können mir nicht beweisen, dass ich Engel bin ...“
„Wetten, dass?“
Die Männer maßen sich mit Blicken. Carlson kapitulierte plötzlich, er senkte die Lider. „Wie viel?“, fragte er.
„Eine Million.“
Die Forderung traf Carlson wie ein Faustschlag, er zuckte heftig zusammen. „Eine Million? Sie machen Witze. Soviel besitze ich nicht.“
„Sie haben den Laden Ihres Onkels geerbt und verscheuert“, sagte der Mann. „Der Erlös dürfte bei zweieinhalb Millionen Mark gelegen haben.“
„Ich habe dafür die Wohnung gekauft, ich musste einige Schulden ablösen, alles in allem habe ich für das Geschäft noch nicht mal zwei Millionen bekommen.“
„Wunderbar“, sagte der Mann, „dann dürfte es für Sie kein Problem sein, die Million für mich lockerzumachen.“
„Wie stellen Sie sich das vor?“, fragte Carlson. „Glauben Sie, ich hätte das Geld bar herumliegen? Es steckt in vielerlei Anlagen, ich würde mindestens einen Monat benötigen, um es flüssig zu machen.“
„Okay, ich bin kein Unmensch“, sagte der Mann. „Sagen wir Hunderttausend bis morgen, den Rest in drei Wochen.“
„Kommen Sie morgen zu mir?“
„Das weiß ich noch nicht. Ich rufe Sie an. Aber ehe wir uns weiter unterhalten, hätte ich gern Ihren Revolver“, sagte der Mann.
„Ich brauche ihn noch“, erklärte Carlson.
Der Mann grinste. „Das haut mich um. Sie wollen wirklich weitermachen?“
„Ja“, sagte Carlson. „Ich will die Ratten dieser Stadt vertilgen ...“
‚Ratten wie dich‘, dachte er und schaute dem Eindringling hart in die Augen, aber er hütete sich, seinen Gedanken laut werden zu lassen.
„Macht mir nichts, im Gegenteil“, spottete der Besucher. „Ich liebe diesen Rummel. In gewisser Hinsicht gefällt mir, was Sie tun – aber ich möchte auf meine Weise davon profitieren. Für eine Million kaufen Sie sich frei, das ist die Summe, die Ihnen der Job wert sein sollte.“
„Wer sind Sie?“
Der Mann grinste breit. „Sie erwarten doch wohl nicht im Ernst, dass ich meine Karten auf den Tisch lege – oder?“
„Wie sind Sie mir auf die Schliche gekommen?“, fragte Carlson. „Ich muss es wissen!“
„Sehen Sie“, sagte der Mann genüsslich, „ich habe das getan, was alle Schlaumeier dieser Stadt bislang versäumten – ich habe an das Naheliegendste gedacht. Zunächst einmal habe ich mir fein säuberlich die Morddaten aufgeschrieben und dabei herausgefunden, dass die Verbrechen zu praktisch allen Tages- und Nachtzeiten passierten – am Vormittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht. Was lag da näher, als sich zu sagen, dass Sie ein Mann ohne festen Beruf sein müssen? Das war noch nicht viel, ich gebe es zu. Diese Stadt wimmelt von reichen Müßiggängern, auch von Arbeitslosen, die meinen könnten, sich in die Schlagzeilen zu schießen. Ich brauchte also andere Anhaltspunkte, aber da waren keine. Niemand hatte Sie gesehen. Es gab nur Ihre Stimme, ich habe sie wiederholt im Radio gehört, aber die brachte mich nicht weiter, sie gab nichts her. Was war da sonst noch? Ihr goldener Revolver! Goldene Revolver gibt‘s nicht zu kaufen, höchstens als Feuerzeug – oder als Spezialanfertigung. Solche Kunden werden jedoch registriert, sie wurden, nehme ich an, längst von der Polizei erfasst und überprüft. Sicherlich hat man auch alle Goldschmiede und Juweliere befragt, um herauszufinden, ob und welcher Privatkunde einen solchen Auftrag erteilte – aber auch das scheint eine Ermittlungsaktion ohne greifbaren Erfolg gewesen zu sein. Trotzdem brachte mich das auf eine Idee. Auf eine gute Idee, wie ich jetzt weiß.“
„Kommen Sie endlich zur Sache“, knurrte Carlson, aber er wusste bereits, was kommen würde, er sah den Fehler, den er gemacht hatte, mit fast schmerzhafter Deutlichkeit vor sich.
„Revolver vergolden – das ist Goldschmiedearbeit, das kann nur ein Fachmann erledigen, es sei denn, jemand hat sich den Spaß gemacht, seine Waffe mit einfacher Bronze zu bepinseln. Aber das schloss ich aus. Ich nahm die Geschichte mit der goldenen Waffe ernst, ich ging ihr nach. Ich will Sie nicht damit langweilen, was ich unternahm, um Ihre Fährte zu finden. Aber Sie werden sich auch ohne langatmige Erklärungen denken können, was passierte. Ich erfuhr, dass Sie das Juweliergeschäft Ihres Onkels, in dem Sie gearbeitet hatten, geerbt und verkauft hatten. Damit waren Sie für mich interessant geworden. Sie waren ein Mann, der Waffen vergolden konnte, und Sie verfügten über die freie Zeit, von der Engel offenkundig mehr als genug besaß. Okay?“
„Okay“, sagte Carlson schwach und fragte sich, weshalb die Polizei nicht schon die gleichen Überlegungen angestellt und den gleichen Weg verfolgt hatte. Früher oder später würden sie es tun, das stand fest. Damit war ebenfalls klar, dass er untertauchen musste, er hatte einen kapitalen Fehler begangen und musste versuchen, ihn auszubügeln.
„Offen gestanden gab es drei ähnlich gelagerte Fälle“, sagte der Fremde. „Verkaufte Geschäfte, Frührentner. Ich ging den Fällen nach, aber ich brauchte mir nur die Männer anzusehen, um auf Anhieb zu wissen, dass sie für die Morde nicht in Frage kamen. Erst als ich Sie sah, wusste ich, dass ich fündig geworden war – und ich wusste es noch genauer, als ich in Ihrer Küche das Gewehröl roch.“
„Rufen Sie mich morgen an“, sagte Carlson und stand auf. „Ich beschaffe das Geld.“
„Versuchen Sie nicht zu türmen“, warnte ihn der Mann. „Ich kann die Polizei auf Sie hetzen, ich kann Sie zum meistgesuchten Mann der Erde machen.“
„In welchem Lager stehen Sie eigentlich?“, fragte Carlson mit hämmerndem Herzen. „In dem der Verbrecher – oder in dem ihrer Feinde?“
„Ich habe mein eigenes Lager, wie jeder Mensch“, sagte der Besucher. „Reden Sie sich bloß nicht ein, der Gerechtigkeit zu dienen. Sie sind ein Mörder. Ihnen macht das Töten Spaß. Da Sie reich sind und nicht killen müssen, um Ihren Lebensunterhalt zu fristen, spielen Sie den großen Rächer, den einsamen Helden. Aber Sie sind ein Mörder, nicht besser und nicht schlechter als jene, die Sie meinen ausrotten zu müssen.“
„Gehen Sie jetzt!“
„Hunderttausend bis morgen, vergessen Sie es nicht“, sagte der Mann. „Ach, da wäre noch etwas. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht. Sie wollen mich aus dem Wege räumen, Sie bersten geradezu vor Mordlust. Vergessen Sie diesen Unsinn. Ich habe bei einem Notar mein Testament hinterlegt. Wenn ich verschwinden sollte, oder wenn jemand meine Leiche entdeckt, wird der Inhalt des Testamentes klarmachen, wem ich diese ärgerliche Entwicklung zu verdanken habe. Es wäre Ihr sicheres Ende, Carlson. Ab heute müssen Sie also um mein Leben zittern, Sie müssen es sogar beschützen – sonst folgen Sie mir prompt ins Jenseits.“
Er schob die Pistole zurück in die Manteltasche. hob grüßend eine Hand und verließ die Küche. Friedrich W. Carlson blieb wie betäubt darin zurück. Er sank auf einen Stuhl und starrte ins Leere. Er hatte sich für den Größten gehalten, für die Nummer Eins der Stadt, und musste nun erkennen, dass er sich getäuscht hatte. Seine Renommiersucht hatte ihm ein Bein gestellt, ab sofort musste er bei jedem Klingeln an seiner Tür befürchten, dass ein anderer herausgefunden hatte, was hinter dem goldenen Revolver stand.
Er gab sich einen Ruck, sprang auf, rannte ins Wohnzimmer und blickte aus dem Fenster. Er sah noch, wie sich ein hellblauer Volkswagen aus einer Parklücke löste und in den fließenden Verkehr einordnete. Carlson erkannte mit einiger Mühe die Nummer, er schrieb sie sich auf.
Dann suchte er eine Privatdetektei auf. „Ich habe Ärger mit meiner Freundin“, erklärte er dem Besitzer der Agentur. „Sie betrügt mich. Ich wüsste gern, wer der Kerl ist. Das ist seine Wagennummer ...“
„Mehr wollen Sie nicht wissen?“
„Das genügt mir.“
„Die Auskunft können Sie gleich haben“, sagte der Mann. „Aber sie kostet fünfzig Mark ...“
„Bitte“, sagte Carlson und legte den geforderten Betrag auf den Tisch. Der Mann ging hinaus, eine Minute später kehrte er zurück. „Sie werden überrascht sein“, sagte er, „aber der Wagen gehört einem Kollegen von mir. Daniel Lochter.“
„Kennen Sie ihn?“
Der Detektiv nahm wieder hinter seinem Schreibtisch Platz. „Ja, flüchtig. Ich kann Ihnen sagen, was ich von ihm weiß – aber das kostet weitere fünfzig Mark.“
„Sie verstehen Ihr Geschäft, was?“, fragte Carlson spöttisch und holte weitere Banknoten aus seiner Brieftasche.
„Quittung?“, fragte der Detektiv.
„Nicht nötig, danke. Überhaupt wäre es mir lieb, wenn Sie mich nach diesem Besuch vergessen. Kein Mann schätzt es, als betrogener oder eifersüchtiger Liebhaber eingestuft zu werden.“
„Ach, du meine Güte!“, grinste der Detektiv. „Mit solchen Sachen haben wir täglich zu tun, davon leben wir. Ich könnte Ihnen da Sachen erzählen ...“
„Bleiben wir bei Dennis Lochter“, empfahl Friedrich W. Carlson kühl.
„Ach ja, der Dennis. Er ist schon lange im Geschäft, aber alle, die ihn kennen, wundern sich, wie er es geschafft hat, sein Leben zu fristen. Aufträge bekommt er kaum und steht bei seinen Kollegen in Verdacht, krumme Dinger zu drehen, ihm ist Gewinn wichtiger als beruflicher Erfolg. Ein etwas zwielichtiger Typ, würde ich sagen. Aber ungemein clever. Zwischen vierzig und fünfzig, arbeitet praktisch allein, beschäftigt aber in seinem Büro ein Mädchen, das ihm die Post erledigt und die eingehenden Anrufe entgegennimmt.“
Carlson ließ sich die Adresse geben, bedankte sich und ging. Er fuhr geradewegs dorthin und parkte seinen Wagen schräg gegenüber von dem Haus. Es dauerte fast zwei Stunden, ehe der blaue Volkswagen auftauchte und in der Hauseinfahrt verschwand. Carlson grinste zufrieden, als er den Fahrer erkannte. Es war Dennis Lochter, sein nächstes Opfer.
––––––––
8
„Beschatte sie, möglichst unauffällig“, riet Bernd Schuster dem Inspektor. „Es sieht so aus, als habe Engel sich in sie verknallt. Er wird versuchen, sie wiederzusehen. Niemand darf etwas davon erfahren, versteht sich.“
Südermann nickte mürrisch. Er saß an seinem Schreibtisch und beobachtete, wie Bernd sich durch einen Stapel von Akten fraß. „Irgendwo da drin steht der Hinweis, den wir suchen“, knurrte der Inspektor. „Die goldene Wahrheit. Wir haben sie nur noch nicht erkannt, sie ist im Wust von Protokollen und Ermittlungsergebnissen buchstäblich untergegangen, man wird betriebsblind, wenn man sich unentwegt mit einem solchen Wust von Informationen herumschlägt. Am schlimmsten sind die sogenannten Zeugenaussagen, die Angaben von Leuten, die seine Stimme erkannt oder ihn in der Nähe eines Tatortes gesehen haben wollen. Diese Hinweise machen das Treiben erst verrückt. Sie komplettieren die allgemeine Konfusion, sie arbeiten dem Gangster in die Tasche. Was das Schlimmste ist: Sie rauben uns kostbare Zeit, sie pumpen uns am Ende so nachhaltig aus, dass kaum noch Reserven für vernünftige Gedanken bleiben.“
„Immerhin“, spottete Bernd, „bleibt dir noch genügend Puste für langatmige Erklärungen. Die goldene Wahrheit, sagst du. Ich glaube, sie hängt mit dem goldenen Revolver zusammen. Er ist ein Anhaltspunkt. Dort musst du einhaken.“
„Das war das erste, was wir taten“, erklärte der Inspektor. „Wir haben uns an alle Goldschmiede und Waffenlieferanten in der Bundesrepublik gewandt, die für einen solchen Auftrag in Frage kämen, aber niemand konnte uns den Namen eines Kunden nennen, der eine solche Bestellung aufgegeben oder eine derartige Waffe erhalten hat. Es gibt keinen Goldschmied im ganzen Land, der nicht zumindest schriftlich von uns angesprochen worden wäre – aber die Aktion brachte keine greifbaren Ergebnisse. Zwar kennen wir jetzt ein paar Leute, die eine solche Waffe besitzen, aber sie sind integer, sie haben für die Taten einwandfreie Alibis.“
„Jemand“, sagte Bernd. „könnte euch den Namen eines Kunden verschwiegen haben.“
„Ich weiß, aber wie sollen wir dahinterkommen? Wir haben uns sogar ein Register aller vorbestraften Juweliere anfertigen lassen. Die Branche ist erstaunlich sauber, es gibt nur wenige schwarze Schafe darunter – und diese wenigen gingen aus unserer Untersuchung gleichsam in strahlendem Weiß hervor. Keiner kommt für die von Engel begangenen Verbrechen in Frage. Übrigens haben wir das gleiche Verfahren auch bei allen Druckern zur Anwendung gebracht. Wir meinten, dass die von Engel gedruckten Visitenkarten uns weiterhelfen müssten, aber auch das führte zu keinem Erfolg.“
Bernd nickte, er stand auf und streckte sich. Der Inspektor grinste matt. „Was macht der Zeitungsjob? Ist dein Brötchengeber zufrieden mit dir?“
„Im Augenblick schlachtet er die Geschichte mit der versuchten Entführung von Beatrice Wilde aus. Das ist für ihn und seine Kollegen ein gefundenes Fressen. Millionärstochter muss miterleben, wie ihr Hausdiener ermordet wird. Kurz darauf wird der Mörder des Dieners – ihr Entführer – von Engel gestellt und erschossen. Es scheint fast so, als führte da jemand Regie, als wüsste jemand mit Gespür für Dramatik, wie die Dinge zu arrangieren seien.“
„Willst du damit sagen, dass die Presse eine geheime Komplizenschaft mit Engel eingegangen ist?“
„So etwas Ähnliches, auch wenn sie nicht bereit wäre, das einzugestehen“, meinte Bernd. „Wir wissen, dass der Engel durch Bert von der geplanten Entführung erfahren hat, mehr nicht. Es ist ein ziemlich miserables Gefühl für dich, dass der Engel offenbar über bessere Informationsquellen als die Polizei verfügt – oder irre ich mich?“
„Er hat Kontakte zur Unterwelt, vielleicht ist er aus ihr hervorgegangen“, meinte der Inspektor. „Ich könnte dir jetzt und hier ein Dutzend plausibler Engel-Theorien entwickeln, aber das wäre verlorene Zeit. Ich kann den Mist weder hören noch äußern, ich muss mir etwas Neues einfallen lassen, sonst bin ich unten durch.“
„Wir haben Beatrice“, sagte Bernd. „Er wird sich an sie heranmachen, davon bin ich überzeugt.“
Das Telefon klingelte. Der Inspektor griff nach dem Hörer und meldete sich. Ein Schatten fiel über sein Gesicht, es wurde hart und grimmig. Er nickte einige Male, dann schmetterte er den Hörer auf die Gabel zurück und sagte: „Da haben wir den Salat. Beatrice Wilde ist verschwunden, ganz plötzlich. Sie hat unseren Mann abgeschüttelt und ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Entweder ist sie auf der Flucht vor dem Engel, oder der Engel hat sie gezwungen, zu ihm zu ziehen.“
––––––––
9
Friedrich W. Carlson wartete, bis sich die Dämmerung über die Stadt senkte. Es regnete leicht. Ihm gefiel das Wetter, es erleichterte ihm seine Aufgabe. Er betrat den Hof des Hauses und blickte an der Rückfront empor. In den zum Hof weisenden Büroräumen im zweiten Stock der Detektei brannte Licht.
Friedrich W. Carlson schaute sich um, dann ergriff er das Fallrohr, zog sich daran hoch und fluchte verhalten, als er spürte, wie rostige Feuchtigkeit durch seine schwarzen Baumwollhandschuhe drang.
Er begann den Aufstieg, passierte erleuchtete Fenster in der ersten Etage, aber niemand nahm von ihm Notiz. Er erreichte die zweite Etage. Lochters Fenster lag etwas abseits vom Regenrohr. Um es zu erreichen, musste man es auf sich nehmen, den regenglatten, etwa fußbreiten Haussims zu betreten.
Carlson warf einen Blick in die Tiefe und fröstelte. Er war schwindelfrei, aber er war kein Fassadenkletterer und wusste nicht, inwieweit Alter und Festigkeit des Simses geeignet waren, die von ihm beabsichtigte Klettertour zu rechtfertigen. Er erstarrte, als er einen Schatten an Lochters Fenster auftauchen sah. Das Fenster wurde aufgestoßen.
„Ah, das tut gut“, ließ Dennis Lochter sich vernehmen. „Frische Luft. Ich liebe diesen Regen. Er putscht mich auf, wirklich. Wie denkst du darüber?“
Carlson konnte nicht hören, was das Mädchen antwortete, aber es schien etwas Erheiterndes zu sein, jedenfalls lachte Lochter laut. Er zog sich vom Fenster zurück, ohne es zu schließen.
Carlson schluckte, er hatte Mühe, seine Erregung unter Kontrolle zu halten. Das offene Fenster war wie ein Köder, es schien ihm zuzuwinken, es war eine Verlockung, der er nicht widerstehen konnte.
Er holte tief Luft, trat auf den Sims, presste sich mit dem Rücken flach gegen die Wand, hielt sich mit einer Hand an der Feuerleiter fest und erprobte mit federnden Beinen, was der Sims aushielt.
Unter ihm rührte und regte sich nichts. Carlson schloss die Augen. Wenn er das Fallrohr losließ und sich Zoll um Zoll auf das offene Fenster vorarbeitete, hing sein Leben an einem seidenen Faden, wenn er die Balance verlor, gab es keinen Halt, dann war er verloren.
Er ließ los, arbeitete sich auf das Fenster zu, Schritt um Schritt, mit ausgestreckten Armen und flach gegen die Wand gepressten Händen und Rücken. Sein Herz hämmerte wild, beinahe schmerzhaft, er schwankte zwischen Triumph und Furcht, zwischen Hass und körperlicher Schwäche, aber er kam unentwegt voran, er näherte sich seinem Ziel, dem nächsten Mord, mit eisernem Willen.
Er freute sich auf Lochters Gesicht, auf das Staunen in dessen Augen, und auf das nachfolgende, blanke Entsetzen, wenn das Wissen um sein sicheres, unabwendbares Ende ihn packen würde.
Carlson hielt sein Gesicht dem dünnen, feinen Regen entgegen. Er machte eine Pause. Er vergaß fast, dass er hier oben auf einem schmalen Sims stand, zwischen Himmel und Erde, er dachte nur noch an das, was er vorhatte und was hinter ihm lag.
Nicht nur Dennis Lochter konnte seine Gegner durch deren Fehler ermitteln, auch er, Friedrich Carlson, beherrschte dieses Spiel ...
Er holte tief Luft, schob sich weiter, spürte die Nässe der Wand, die Glitschigkeit des Simses, aber er hatte keine Angst mehr. Er wusste, dass er es schaffen würde, er spürte das Gewicht des geladenen Revolvers in seinem Schulterhalfter, er hätte ihn in diesem Augenblick am liebsten geküsst, denn es stand außer Frage, dass der Tag, der so furchterregend begonnen hatte, mit einem Triumph enden würde.
Er erreichte das Fenster, drehte den Kopf zur Seite, blickte in den Raum. Niemand war darin. Das Zimmer war nicht groß, es bestand praktisch nur aus zwei Aktenregalen, die dicht gefüllt waren und bis unter die Decke reichten, sowie aus einem alten, ausrangierten Schreibtisch, auf dem schmutziges Kaffeegeschirr stand. Ein kleiner Kocher, der von einem Hocker getragen wurde, und ein Waschbecken vervollständigten die karge Einrichtung. Die Tür zum Nebenraum war nur angelehnt. Lochters Lachen ertönte, es klang amüsiert und sinnlich zugleich. „Sei keine Spielverderberin“, sagte er. „Bleib noch ein bisschen.“
„Ich bin angemeldet“, sagte eine Mädchenstimme. „Ich muss den Termin einhalten.“
„Dein Zahnarzt kann warten. Meine Liebe nicht“, sagte Dennis Lochter.
Danach war es ruhig. Carlson hörte nur das monotone Fallen der Regentropfen. Er schob sich bis zum Fensterrahmen vor, dann kletterte er über das Brett ins Innere des Raumes. Er zog seinen Revolver aus dem Schulterhalfter und bewegte sich mit der Konzentration und Lautlosigkeit eines professionellen Einbrechers.
Er atmete auf, als er im Zimmer stand, als Nässe und Gefahr hinter ihm lagen. Auf Zehenspitzen pirschte er sich an die Tür heran und peilte durch einen schmalen Schlitz in das angrenzende Büro. Er sah niemand. Lochter und das Mädchen befanden sich außerhalb seines Blickfeldes.
Plötzlich ertönte ein Kichern. „Nein“, sagte das Mädchen. „Nein ...“
Die Stimme klang dunkel, ein wenig belegt, sie wurde von erotischer Lust verfärbt. Carlson hörte Geräusche, die er mühelos zu deuten vermochte. Er grinste breit. Er hatte sich einen wundervollen Moment ausgesucht. Ungelegener konnte er für die beiden schwerlich kommen – und sicherlich befand sich Lochter in einer Lage, die ihn außerstande setzte, an seine Schusswaffe heranzukommen.
Er kickte die Tür mit dem Fuß auf, sprang über die Schwelle und richtete seine Waffe auf das Paar, das halbnackt auf einer ledernen Couch lag.
Die Couch gehörte zu einer für Besucher gedachten Sitzgruppe, sie war die einzige Möblierung von repräsentativem Schick, der Rest der Einrichtung wirkte eher trist und ließ erkennen, dass die Detektei von Dennis Lochter niemals in den Genuss gekommen war, mit hohen Überschüssen zu arbeiten.
Friedrich W. Carlson sah auf einen Blick das Wichtigste: Sakko und Schulterhalfter des Detektivs waren achtlos über einen Sessel geworfen worden, beides befand sich außerhalb von Lochters Reichweite.
Das Mädchen erstarrte vor Schreck, ihr Oberkörper war nackt, und ihr Rock war von dem Mann bis zur Hüfte hochgeschoben worden.
Dennis Lochter hatte sein rotes, erhitztes Gesicht dem Eindringling zugewandt, er sah genau so aus, wie Carlson es erwartet hatte: Schockiert, entsetzt, fassungslos. Friedrich W. Carlson holte tief Luft. Er bereute seine Kletterpartie nicht, sie hatte sich gelohnt, Schritt für Schritt, mit all ihren Ängsten und Risiken.
„Hallo, Chef“, höhnte Carlson. „Störe ich?“
Dennis Lochter richtete sich auf. Sein Hemd war ihm aus der Hose gerutscht, und der Schlipsknoten hatte sich unter eine Ecke des geöffneten Kragens geflüchtet. Er starrte Carlson in die Augen, schweigend.
„Keine falsche Bewegung, Schnüffler“, sagte Carlson. Er war in seinem Element, er sprach wieder halblaut und spöttisch, er hatte seine Sicherheit wiedergefunden.
„Was haben Sie vor?“, murmelte Lochter und schielte unwillkürlich nach der auf dem Sessel liegenden Waffe. „Denken Sie an mein Testament ...“
„Bluff. Ich glaube nicht an diese Story“, sagte Friedrich Carlson und musterte das Mädchen aus schmalen, harten Augen. Er schätzte die Blondine auf Ende Zwanzig. Sie verdeckte ihre Blöße mit beiden Händen. Carlson stellte fest, dass sie mit ungewöhnlich gut entwickelten weiblichen Reizen aufwartete. Ihr Gesicht war hübsch, wenn auch auf eine billige, wenig anziehende Weise. Es mochte Männer geben, die sie attraktiv fanden. Er gehörte nicht zu dieser Gruppe. Bei ihm mussten Mädchen echte Klasse haben, so wie Beatrice Wilde.
„Fragen Sie doch Karin“, meinte Lochter. Er hatte den Kopf zur Seite gelegt und sah lauernd aus, als wartete er nur auf eine Chance.
„Na los, reden Sie“, höhnte Friedrich Carlson. „Halten wir eine Märchenstunde ab ...“
„Kann ich mich anziehen, bitte?“, flüsterte das Mädchen mit hochrotem Kopf.
„Nein“, sagte Carlson barsch. „Ihre nackte Haut stört mich nicht. Oder finden Sie es passender und pietätvoller, mit Bluse und BH zu sterben?“
Das Mädchen starrte ihm in die Augen, blass vor Angst und Entsetzen. Er konnte sie doch nicht töten wollen, das war doch wider alle Vernunft!
„Oh Gott ...“, wimmerte sie. Ihre Kinnlade klappte herab, sie begann zu zittern.
Der Detektiv schnellte plötzlich von der Couch hoch, es schien, als würde er buchstäblich abgeschossen. Seine Hand zuckte nach der auf dem Sessel liegenden Waffe, aber noch er sie erreichte, zog Carlson durch.
Der Schuss weckte in dem hohen, weiß getünchten Raum ein donnerndes Echo.
Dennis Lochter taumelte zurück, er krümmte sich, als litte er unter Magenkrämpfen, sein Mund bildete ein großes, rundes O.
Friedrich W. Carlson zielte sorgfältig, dann schoss er ein zweites Mal.
Dennis Lochter brach zusammen und blieb liegen, ohne sich zu rühren.
„Nein“, schluchzte das Mädchen und blickte fassungslos auf den Mann, dessen körperliche Wärme und Küsse sie eben noch erregt hatten, und der jetzt steif auf dem Boden lag, wie eine zerbrochene Puppe, „nein ...“
Friedrich Carlson lauschte mit einem Ohr nach draußen. Der Regen war immer noch zu hören. In den Büroräumen oberhalb der Detektei hatte kein Licht gebrannt, auch die Nachbarbüros waren um diese Zeit offenbar nicht besetzt. Vieles sprach dafür, dass die beiden Schüsse verhallt waren, ohne außerhalb von Lochters Büro gehört worden zu sein.
„Was ist mit dem Testament?“, fragte er das Mädchen. Sie konnte nicht antworten, es schien, als würde sie vor Angst durchdrehen. Er setzte sich. Er widmete dem Toten keinen Blick. Lochter hatte verdientermaßen seine Strafe bekommen, mehr gab es dazu nicht zu sagen.
„Es gibt keines – glaube ich“, hauchte sie endlich.
„Sie schreiben seine Briefe, Sie sind ganztags für ihn beschäftigt?“
„Ja.“
„Sie wussten, dass er mir auf die Schliche gekommen war?“, fragte er.
„Ja und nein ...“ Sie rang um Worte, sie suchte nach einem Ausweg, aber ihre aufgescheuchten, vom Terror gequälten Gedanken wollten einfach nicht wie sonst funktionieren, die Angst vor dem Mörder verdrängte alles andere.
„Reißen Sie sich zusammen“, fauchte er sie an. „Reden Sie!“
„Er war in den letzten Tagen seltsam verändert“, stammelte sie. „Richtig vergnügt. Er redete immerzu davon, dass wir mit Engel unser Glück machen würden. Ich nahm das nicht ernst. Dennis war immer so euphorisch. Ihm konnte das Wasser bis zum Hals stehen, aber er fand immer wieder einen Ausweg, eine Geldquelle ...“
„Er muss Ihnen meinen Namen genannt haben“, sagte Friedrich W. Carlson.
„Ehrenwort, das hat er nicht getan!“
„Sie wussten, wohin er zu gehen beabsichtigte.“
„Nein!“
„Mir machen Sie nichts vor“, sagte er.
„Dennis wollte mich überraschen, glaube ich. Ich weiß nur, dass er darauf baute, morgen eine große Geldsumme in Empfang nehmen zu können.“
„Sie schwindeln miserabel“, sagte er.
„Es ist die Wahrheit!“ Sie schrie es ihm buchstäblich ins Gesicht, dann erschrak sie. Es hatte keinen Sinn, sich so hysterisch aufzuführen, ihr Gegner war unberechenbar, er hatte bei Dennis bewiesen, wie wenig ihm ein Menschenleben bedeutete und wie leicht es ihm fiel, eines auszulöschen.
„Ich werde die Bude abbrennen“, sagte er und schaute sich um. „Das erspart mir die lästige Sucherei. Lochter hat mich bespitzelt, er hat Material über mich und ein paar Kollegen zusammengetragen, ich kann es mir nicht leisten, dass dieses Material den Bullen in die Hände fällt.“
„Den Bullen?“, echote das Mädchen. „Ich denke, Sie stehen auf der Seite des Rechtes?“
„Bullen sind selbst größtenteils Rechtsbrecher“, behauptete er. „Wenn sie nicht korrupt und bestechlich wären, hätten die Verbrecher keine Überlebenschance, aber so, wie die Dinge nun mal liegen, gibt es immer wieder heimliche Kumpaneien zwischen Kriminellen und Uniformierten. Wissen Sie, wer mein nächstes Opfer sein wird?“
Das Mädchen schüttelte den Kopf. Die Angst hatte ihre Augen groß und rund werden lassen.
„Ein Polizist“, sagte Carlson langsam. „Einer, der sich von Verbrechern schmieren lässt, wissen Sie. Auch das gehört zu meinem Programm. Krieg an allen Fronten. Krieg gegen die, die Verbrecher unterstützen. Krieg gegen jene, die mit ihnen paktieren, und Krieg gegen alle, die das Gangstertum verkörpern.“
„Aber Dennis war kein Gangster“, murmelte sie.
‚Es ist zwecklos,‘ schoss es ihr durch den Kopf. ‚Es hat keinen Sinn, einen Toten zu verteidigen. Dennis war nicht harmlos, das hast du gewusst. Und der Engel weiß es auch. Du musst versuchen, dich von Dennis zu distanzieren, sonst endest du wie er, als seine Komplizin.‘
„Nein? Was denn sonst?“, höhnte Carlson. „Er hat versucht, mich zu erpressen.“
„Er hätte Sie nicht ans Messer geliefert, bestimmt nicht“, sagte das Mädchen hastig. „Er hat Ihr Handeln begrüßt, ihm war es nur recht, dass die Gangster dieser Stadt dezimiert wurden.“
Er schaute sie an.
‚Du musst sie töten‘, sagte er sich. ‚Sie ist jung und clever, sie bildet sich ein, dich abschütteln zu können, aber sobald du ihr den Rücken kehrst, wird sie versuchen, mit deiner Beschreibung Geld zu verdienen.‘
Er drückte ohne Warnung ab. Ein Herzschuss. Das Mädchen sank lautlos zurück, das aus der Wunde quellende Blut überzog ihre weiße Haut mit einem leuchtend roten Film.
Carlson schob die goldene Waffe zurück in sein Schulterhalfter. Er beugte sich über Lochter, tastete ihn ab und zog ihm dann ein Schlüsselbund aus der Hosentasche.
Carlson richtete sich auf. Er machte das Licht in allen Räumen aus und ging zur Tür. Er lauschte, ehe er sie öffnete, zog sie hinter sich ins Schloss und eilte zum Treppenhaus.
Während er auf den Fahrstuhl wartete, wurde ihm bewusst, dass sein Mantel auffällig nass und verschmutzt war. Er zog ihn rasch aus und legte ihn zusammengerollt über seine Schulter. Der Fahrstuhl stoppte, die automatisch funktionierenden Türen glitten zur Seite.
Eine alte Frau stand im Fahrstuhl. Sie trug unter ihrem verrückt garnierten Hut eine dicke Brille und schaute ihn kaum an. Er fuhr mit ihr ins Erdgeschoss, durchquerte die Halle, verließ das Gebäude und ging ohne Eile zu seinem Wagen. Es regnete immer noch, er streifte seinen Mantel über. Er setzte sich hinter das Lenkrad, steckte sich eine Zigarette an und wartete, bis nur noch hinter wenigen Bürofenstern Licht brannte, dann kletterte er ins Freie und holte seine beiden Reservekanister aus dem Kofferraum.
Er trug sie in das Gebäude. Ihm war klar, dass er leichtsinnig handelte. Ein Mann mit zwei Benzinkanistern musste einfach auffallen und zu gewissen Fragen und Überlegungen animieren, aber niemand schenkte ihm einen Blick. Er gelangte mühelos in das zweite Stockwerk, diesmal war der Lift leer. Er holte Lochters Schlüsselbund aus der Tasche, betrat das Büro, drückte die Tür hinter sich ins Schloss, stellte die Kanister ab und stieß erleichtert die Luft aus.
Es war noch einmal gutgegangen, der Schock vom Morgen war vergessen, die Stadt war um zwei Gauner ärmer geworden. Er knipste das Licht in den Räumen an und fuhr zusammen, als das Telefon klingelte. ‚Ruhig klingeln lassen‘, dachte er. ‚Nur nicht nervös werden!‘ Aber dann trat er an den Schreibtisch und griff nach dem Hörer. Er trug immer noch die schwarzen, durchnässten Handschuhe, er brauchte sich wegen eventueller Fingerabdrücke keine Sorgen zu machen.
„Ja?“, fragte er.
„Bist du allein, Dennis?“ tönte ihm eine heiser und bärbeißig klingende Stimme entgegen. Es war die Stimme eines einfachen Mannes mit Autorität.
„Ja, ich bin allein.“
„Gut. ich bin‘s, Hans Grosser“, sagte der Anrufer. „Du hast Glück, alter Junge, ich kann die Sache für dich niederschlagen. Ich lasse den Vorgang einfach unter den Tisch fallen. Aber das kostet dich eine Kleinigkeit, hundert Märker musst du dafür schon berappen.“
„Geht in Ordnung“, sagte Carlson.
„Ich brauche das Geld heute Abend, in zwei Stunden“, erklärte der Anrufer. „Um zehn geht mein Dienst zu Ende. Wie wäre es, wenn wir uns in unserer Eckkneipe träfen?“
„Ist das auch keine Falle?“, fragte Carlson.
„Du spinnst wohl, was?“, empörte sich Grosser. „Ich riskiere dabei mehr als du!“
„Du meinst doch die Kneipe ...“
„... an der Kreuzung Ritterstraße und Alexandrinenstraße, ganz richtig“, sagte der Anrufer. „Halte dich an die Zeit, ich habe vom Streifengehen schon runde Füße bekommen und bin nicht in der Stimmung, auf dich zu warten.“
Es klickte in der Leitung. Der Teilnehmer hatte aufgelegt. Carlson warf den Hörer auf die Gabel. Seine Mundwinkel zuckten grimmig, und in seinen Augen entzündete sich ein düsteres Funkeln.
Der Zufall war ihm zu Hilfe gekommen, jetzt hatte er auch einen korrupten Polizisten an der Hand. Grosser hatte keine Chance, diese Nacht zu überleben. Der Terror würde einen neuen Höhepunkt erreichen.
Friedrich W. Carlson leerte die Benzinkanister, er schüttete ihren Inhalt über die Sitzgarnitur, die abgetretenen Teppiche, die Aktenstöße. Dann riss er eine lange Kordel von der Übergardine und befeuchtete sie mit Benzin. Er legte die Kordel in den Waschraum und steckte sie an. Er überzeugte sich davon, dass sich die kleine Flamme wie an einer Zündschnur vorwärts fraß, dem benzingetränkten Teppich entgegen, und hastete aus dem Büro.
Er wartete nicht auf den Lift, sondern stürmte die Treppe hinab. Niemand kam ihm entgegen. Noch ehe er das Erdgeschoss erreicht hatte, vernahm er einen dumpfen Knall. Er betrat die Straße und sah, dass einige Passanten stehengeblieben waren und an der Hausfront emporblickten. Er hob den Kopf und sah den lodernden Feuerschein hinter den zur Straße weisenden Büroräumen von Dennis Lochters Detektei. Im nächsten Moment platzte eine der Scheiben. Ein paar Passanten stoben zur Seite. Carlson schloss sich ihnen an. Er schaute sich um. Niemand beachtete ihn, er überquerte die Straße, überzeugte sich nochmals von seiner erfolgreichen Tätigkeit, kletterte kurz darauf in seinen Wagen und fuhr davon.
––––––––
10
Inspektor Südermann gab Bernd ein Zeichen. Der griff nach dem Zweithörer, um das Gespräch mitzuverfolgen. Vorab hatte der Inspektor den Signalknopf betätigt, der die Telefonfahndung und das Bandgerät einschaltete.
„Die beiden“, sagte der Anrufer, „haben bekommen, was sie verdienten. Ein korrupter Privatdetektiv und seine Helferin. Ein Erpresser, ein Miesling! Sie hat davon gewusst, sie hat ihn gedeckt. Mein Kampf geht weiter, noch in dieser Nacht. Diesmal wird es einen Polizisten erwischen. Einen, der mit Lochter gemeinsame Sache machte ...“
Es klickte in der Leitung. Der Inspektor ließ den Hörer sinken und spulte das Band zurück. Er hörte sich ein zweites Mal an, was der Anrufer, gesagt hatte. Bernd hängte den Zweithörer ein.
Gleich darauf klingelte erneut das Telefon. Der Inspektor nahm das Gespräch entgegen und sagte müde: „Ich weiß schon Bescheid. Lochter und seine Sekretärin sind erschossen worden. Ja, von Engel. Wie bitte?“ Er nickte einige Male, dann legte er auf.
„Kanntest du ihn?“, fragte er dann. „Er war immerhin dein Kollege.“
„Flüchtig“, sagte Bernd. „Er gehörte nicht zu den Leuten, dessen Zusammenarbeit man suchte oder dessen Hilfe ich geschätzt haben würde.“
Der Inspektor erhob sich. „Der Engel hält uns in Trab. Wir jagen von einem Tatort zum anderen und kommen kaum noch dazu, eine richtige Spurensicherung vorzunehmen. Es ist, als steckte dahinter eine teuflische Methode. Er lässt uns nicht zu Atem kommen. Oh, Mann – der Polizist!“ Er griff nach dem Telefonhörer und gab einen Rundspruch durch, der für alle Reviere bestimmt war und diejenigen Beamten warnte, die sich von der Drohung des Unbekannten angesprochen fühlen mussten.
Sie verließen gemeinsam das Büro und fuhren durch die Stadt.
„Wie ist er dahintergekommen?“, fragte Bernd unterwegs. „Wie hat er erfahren, dass Lochter jemand erpresste?“
„Keine Ahnung.“
„Es gibt nur eine Erklärung dafür“, sagte Bernd. „Der Erpresste war der Engel.“
Südermanns, Kopf flog herum. Da in diesem Moment vor ihnen ein Wagen an einer auf Rot springenden Ampel stoppte, entgingen sie nur um Haaresbreite einem Auffahrunfall. „Du meinst, Lochter könnte hinter Engels Geheimnis gekommen sein?“, fragte Horst Südermann.
„Es wäre möglich“, sagte Bernd. „Er war ein Tüftler, ein Mann, der zweifellos begabt war – der diese Begabung aber zu oft für seine persönlichen und nicht immer sehr lauteren Zwecke nutzte.“
„Hör auf! Er war sicherlich kein Wunderknabe“, winkte der Inspektor ab und fuhr an. „Er kann nicht mehr erreicht haben als wir, er hat weder unseren Apparat noch unsere Einsicht.“
„Das ist eher ein Plus“, meinte Bernd. „Er ist nicht betriebsblind geworden, er konnte sich auf einen Punkt konzentrieren und ist, wie es aussieht, dabei fündig geworden.“
„Fündig für sein Grab“, sagte der Inspektor bitter.
Sie erreichten den Brandort, passierten die Absperrung und sprachen zunächst mit ein paar Feuerwehrleuten, die zuerst am Tatort gewesen waren und den Brand schnell gelöscht hatten. Sie hatten die Toten entdeckt und sofort die Polizei benachrichtigt, aber noch vor diesem Anruf hatte sich der Mann gemeldet, dem die Ereignisse zugeschrieben werden mussten.
Der Kastenwagen der Mordkommission traf gleich hinter dem Inspektor und Bernd ein, man fuhr gemeinsam mit dem Lift nach oben Etage und verzog die Gesichter, als man durch hohe Löschwasserpfützen steigen und mit einem intensiven Brand- und Benzingeruch fertig werden musste.
Der Polizeiarzt war noch unterwegs. Die Fotografen machten sich sofort an die Arbeit.
„Einschüsse aus nächster Nähe“, stellte der Inspektor fest.
Lochters Leiche war angekohlt, bei seiner Mitarbeiterin waren lediglich die Haare versengt. Das Feuer hatte vor allem im angrenzenden Registraturraum gewütet. Das Büro selbst war relativ glimpflich davongekommen. Verbrannt waren der Teppich, zwei kleine, hölzerne Aktenschränke, ein Teil des Schreibtisches und die Übergardinen.
Bernd trat an den Schreibtisch und klappte den Telefonblock auf. Die Blätter waren angesengt, aber die einzelnen Rufnummern waren deutlich zu erkennen. Bernd zählte mehr als drei Dutzend, die dicht untereinander standen.
Inspektor Südermann warf einen Blick über Bernds Schultern. „Seltsam“, sagte er. „Die Nummern kenne ich. Lass mich nachdenken. Jetzt hab ich‘s! Das sind Juweliere, Goldschmiede, ich habe die gleichen Nummern vor wenigen Wochen nacheinander angewählt.“
„Der goldene Revolver“, sagte Bernd und klappte den Block zu. „Er muss fündig geworden sein.“
„Weshalb hätte man Lochter mehr sagen sollen, als man mir mitteilte?“
„Du wirst das noch einmal überprüfen müssen“, meinte Bernd.
Der Inspektor wandte sich ab. Der Polizeiarzt hatte den Raum betreten. Horst Südermann und der Mediziner begrüßten sich, dann ging der Arzt sofort an die Arbeit.
Bernd klappte nochmals den Telefonblock auf. Er entdeckte, dass eine der letzten Nummern durchkreuzt worden war. Er wählte sie. Eine vom Band gesprochene Stimme tönte ihm entgegen: „Kein Anschluss unter dieser Nummer, kein Anschluss unter dieser Nummer.“
Bernd legte auf. Das war die Erklärung.
Der Inspektor kam auf ihm zu. „Die Kanister liegen im Waschraum, die übliche Standardware. Wir werden sie untersuchen lassen, aber ich bezweifle, dass sie uns weiterbringen. Der Engel ist kein Mann, der über derlei Dinge stolpern würde.“
„Er ist aber gestolpert“, sagte Bernd, „über Lochter.“
„Ich sehe das eher umgekehrt.“
„Lochter hat einen Fehler gemacht, ohne Zweifel – aber den ersten Fehler muss der Engel gemacht haben“, meinte Bernd. Er hatte eine Idee. Er rief das Fernsprechamt an und bat um Auskunft, wem die Nummer gehört hatte, deren Anschluss aufgehoben war.
„Der Firma Köhler“, erfuhr er wenig später. „Ein Juweliergeschäft in Steglitz. Es hat den Besitzer gewechselt.“
Bernd ließ sich den Namen des neuen Besitzers geben und rief ihn zu Hause an. Der Mann hieß Mommert. „Guten Abend, Herr Mommert“, sagte Bernd. „Mein Name ist Schuster, ich bin Privatdetektiv und ermittle in einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse. Können Sie mir sagen, von wem Sie das Geschäft erworben haben – und zu welchem Preis?“
Der Mann am anderen Leitungsende zögerte. „Das ist ein etwas ungewöhnliches Ansinnen“, meinte er dann. „Es ist kein Geheimnis, dass ich den Laden von Herrn Carlson erworben habe – aber es dürfte weder in seinem noch in meinem Sinne sein, wenn ich am Telefon den Preis nenne. Das ist eine vertrauliche Sache, wissen Sie – und im Übrigen kann ja jeder behaupten, eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu vertreten.“
„Wie und wo kann ich diesen Carlson erreichen, bitte?“, fragte Bernd, der für Mommerts Verhalten durchaus Verständnis zeigte. Er notierte sich die Adresse und die Telefonnummer, die der Juwelier ihm nannte, dann fragte er noch: „Warum hat Carlson verkauft, Herr Mommert?“
„Er hatte keine Lust mehr, nach dem Tod seines Onkels das Geschäft weiterzuführen, glaube ich. Herr Carlson ist Goldschmied – kein Kaufmann.“
„Danke“, sagte Bernd und legte auf.
„Was Neues?“, fragte der Inspektor.
„Ich denke schon“, sagte Bernd nachdenklich. „Kommst du mit? Da ist ein Mann, den ich mir gern mal aus der Nähe betrachten würde.“
„Spaßvogel! Ich muss hierbleiben, hier gibt es noch eine Menge zu tun.“
„Okay, wir sehen uns später“, meinte Bernd und ging.
Er hatte seinen Wagen beim Kommissariat gelassen und musste sich von einem Taxi dorthin bringen lassen. Dort stieg er in seinen Wagen um, fuhr zu der genannten Adresse, betrat das elegante Apartmenthaus und klingelte an Friedrich W. Carlsons Wohnungstür, aber niemand öffnete.
Bernd Schuster machte kehrt. Er setzte sich in seinen Wagen und wartete. Plötzlich entdeckte er, dass er nicht der einzige war, der eine Wartestellung bezogen hatte. Ihm schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite, leuchtete in einem flachen, italienischen Sportcoupé in kurzen, regelmäßigen Abständen eine Zigarette auf. Der hastige Rhythmus zeigte, wie nervös der Raucher war.
Bernd stieg aus und bummelte die Straße hinab, dann überquerte er die Fahrbahn und näherte sich dem italienischen Flitzer von hinten. Er sah, dass in dem Coupé eine Frau saß, beugte sich zu dem herabgekurbelten Fenster hinab und erkannte sie auf Anhieb. Ihr Bild war in den Zeitungen, es überschwemmte die Stadt als Illustration zu einem Entführungsversuch, der zwei Menschen das Leben gekostet hatte.
„Hallo“, sagte Bernd. „Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein, Fräulein Wilde?“
Der Kopf des Mädchens zuckte herum. Sie wirkte atemlos. „Herr Schuster!“, sagte sie.
Er ging um den Wagen herum und stieg ein. Beatrice Wilde hatte sich gefangen, sie starrte geradeaus durch die Windschutzscheibe.
„Wir waren Ihretwegen in Sorge“, sagte Bernd.
„Dazu bestand kein Grund.“
„Sie waren plötzlich verschwunden.“
„Verschwunden? Lächerlich! Ich wollte allein sein, ich hatte keine Lust, mich den Fragen jedes Reporters zu stellen, ich habe mich zurückgezogen – das ist alles.“
„Zurückgezogen in diese Straße?“, fragte er mit mildem Spott.
„Was dagegen?“, fragte sie herausfordernd.
„Aber nein, Sie sind eine freie Bürgerin in einem freien Land – aber zufällig sind Sie auch das Mädchen, das den Engel kennt, das Mädchen, das von ihm geliebt wird. Inspektor Südermann hatte den verständlichen Wunsch, Sie vor Engels Nachstellungen zu beschützen, aber Sie haben sich dieser Fürsorge sehr nachhaltig entzogen.“
„Ich fand sie lästig.“
„Darf ich erfahren, auf wen Sie hier warten?“
„Nein“, sagte sie barsch.
„Ich will es Ihnen sagen“, meinte er und schaute sie an. „Sie sollen Carlson treffen.“
Sie erwiderte seinen Blick, und er erkannte, dass das darin gezeigte Erstaunen nicht geheuchelt war. „Carlson?“, echote sie. „Wer ist das?“
„Friedrich W. Carlson, Goldschmied. Er wohnt in dem weißen Haus da vorn – aber das wissen Sie doch gewiss!“
„Nein. Ich bin von ihm herbestellt worden – vom Engel“, sagte sie. „Er hat mir gedroht – nun, es ist egal, was er mir für den Fall androhte, dass ich nicht komme, ich hielt es jedenfalls für eine gute Idee, seine Warnung zu beherzigen. Der Mann ist verrückt, ich weiß, aber er ist auch formbar, wenn er nur spürt, dass man ihm zu helfen versucht. Ich habe Einfluss auf ihn. Vielleicht bin ich der einzige Mensch, auf den er hört. Ich muss versuchen, ihn zur Räson zu bringen. Deshalb bin ich hier.“
„Wie und wo hat er Sie erreicht?“
„In einem Lokal, er muss gesehen haben, wie ich es betrat. Mein Name wurde plötzlich ausgerufen, ich ging in die genannte Telefonkabine und hatte Engel an der Strippe.“
„Wann sollten Sie hier hier sein?“
„Gegen neun. Ich warte jetzt schon mehr als zwanzig Minuten auf ihn. Es ist besser, wenn Sie verschwinden, er könnte sonst glauben, ich stecke mit Ihnen unter einer Decke.“ Sie schaute ihn an, plötzliche Angst in den Augen. „Sie dürfen mich nicht verraten, Sie dürfen auch nicht die Polizei alarmieren. Was ich Ihnen mitteilte, ist streng vertraulich, für keinen anderen bestimmt ...“
„Schon gut“, sagte er und stieg aus. „Wir sehen uns noch.“
Er betrat das elegante weiße Haus. Der Verwalter wohnte im Erdgeschoss. Bernd Schuster klingelte ihn heraus, Der Verwalter erwies sich als freundlicher Endvierziger, er hatte im Krieg einen Arm verloren und trug eine Prothese.
Bernd wies sich aus. „Herr Carlson hat mich angerufen“, behauptete er. „Sie sollen mich in seine Wohnung lassen, er rechnet mit einem Einbrecher, den ich abfangen soll.“
Das Lächeln des Verwalters erlosch. „Warum hat Herr Carlson nicht die Polizei eingeschaltet?“
Bernd lachte leise. „Wenn jeder gleich zur Polizei liefe, könnten Leute wie ich ihren Laden dichtmachen. Sie haben nichts zu befürchten. Schauen Sie sich nochmals meine Karte an – und erkundigen Sie sich meinetwegen telefonisch bei der Polizei. Man wird Ihnen bestätigen, dass ich ein wohl bekannter Privatdetektiv bin.“
„Warten Sie hier“, sagte Mann. „Sie werden verstehen, dass ich diese Auskunft einholen muss.“ Er ging zurück in die Wohnung. Bernd lehnte sich an die Wand. Er wusste, dass er im Augenblick Hasard spielte, aber er glaubte auch zu wissen, dass seine Gewinnchancen auf Grün standen. Wenn er sich irrte, wurde er unter Umständen eine Menge Ärger bekommen, aber das Auftauchen von Beatrice Wilde in unmittelbarer Nähe von Carlsons Haus berechtigte ihn zu der Hoffnung, dass er auf der richtigen Fährte war.
Der Verwalter kehrte zurück, er lächelte schon wieder und hatte ein großes Schlüsselbund bei sich. „Offenbar sind Sie ein berühmter Mann, Herr Schuster. Die Auskunft war entsprechend. Lassen Sie uns gehen.“
Er ließ Bernd in Carlsons Wohnung ein und fragte: „Brauchen Sie mich noch?“
„Danke, das wär‘s“, sagte Bernd.
Der Mann blieb unschlüssig stehen. „Was ist, wenn der Einbrecher tatsächlich aufkreuzen sollte?“
„Er wird sein blaues Wunder erleben“, versprach Bernd.
„Ich bin trotz meiner Prothese noch immer ein kräftiger, wendiger Bursche“, sagte der Verwalter. „Rufen Sie mich, wenn Sie mich brauchen – ich hasse das Verbrechen und bin mehr als gern bereit, Ihnen bei seiner Bekämpfung zu helfen.“
Er ging. Bernd knipste in der Wohnung das Licht an, ganz kurz nur. Er musste damit rechnen, dass Carlson schon in den nächsten Minuten nach Hause zurückkehren und das Licht in seiner Wohnung bemerken würde.
Bernd schaute sich um, er prägte sich ein, was er sah, dann knipste er die Lampen aus und trat ans Fenster. Von seinem Standort war gerade noch der italienische Flitzer zu sehen. Hinter der Windschutzscheibe glühte Beatrice Wildes Zigarette auf, immer wieder, im gleichen, von Angst und Nervosität bestimmten Rhythmus.
Bernd verließ die Wohnung, ohne die Tür zu schließen. Er eilte auf die Straße, öffnete den Wagenschlag des Coupés und sagte: „Kommen Sie, bitte!“
„Wohin?“
„Das erfahren Sie gleich. Es ist gleich zehn. Engel kann nicht von Ihnen erwarten, dass Sie sich seinetwegen die Zeit um die Ohren schlagen.“
„Was haben Sie vor?“
Er schaute sich um, jetzt ebenso nervös wie das Mädchen. Wenn der Engel in diesem Moment aufkreuzte, war die Vorarbeit umsonst gewesen. Bernd ergriff Beatrice am Unterarm, er zerrte sie buchstäblich aus dem Wagen. Dann hastete er mit ihr in das weiße Haus. Aufatmend schloss er Carlsons Wohnungstür hinter sich und dem Mädchen.
„Wo sind wir hier?“, fragte Beatrice Wilde erregt. „Warum machen Sie kein Licht?“
Er zog sie ins Wohnzimmer. „Das ist Carlsons Wohnung“, sagte er. „Friedrich W. Carlson, Goldschmied. Ich würde gern Licht machen, in der Hoffnung, ein Bild von ihm zu finden – aber das können wir uns im Augenblick nicht leisten. Das Licht könnte ihn verprellen. Wir müssen warten, bis er nach Hause kommt.“
„Sie verdächtigen Carlson, mit dem Engel identisch zu sein, und ich soll ihn identifizieren, nicht wahr?“
„Genauso ist es“, sagte er. „Ich bin bewaffnet. Wenn er eintritt, wird er in den Lauf meines Revolvers blicken und keine Chance haben zu kontern. Sie brauchen mir nur zu sagen, ob es der richtige Mann ist.“
„Okay, aber was ist, wenn Sie sich irren?“
„Dann“, seufzte Bernd, „kann ich mich nach einem anderen Job umsehen.“
––––––––
11
„Jetzt!“, flüsterte Beatrice und begann unwillkürlich zu zittern. Die Spannung zerrte an ihren Nerven. Sie hatte sich während der letzten zehn oder fünfzehn Minuten leise und angeregt mit Bernd unterhalten, sie hatte geglaubt, dass es unnötig sei, in seiner Nähe Furcht zu empfinden, aber jetzt, im Augenblick der Entscheidung, war die alte Angst wieder da – dieses enervierende Gefühl der Hilflosigkeit, der Gefährdung.
„Pst“, machte Bernd. Er hielt den Revolver griffbereit in der Hand. Die Straßenlampen schickten genügend Licht in den großen Raum, um jedes wichtige Detail darin erkennen zu können. Bernd hatte sich mit dem Mädchen so gesetzt, dass seine Konturen von dem eintretenden Carlson nicht vor dem hellen Fenster gesehen werden konnten. Umgekehrt hatten er und Beatrice keine Mühe, den Heimkehrer beim Öffnen der Tür auf Anhieb wahrzunehmen.
Ein Schlüssel drehte sich im Schloss der Wohnungstür, die Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen. Das Knacken eines Lichtschalters wurde laut. Unterhalb der Wohnzimmertür erschien ein schmaler Lichtstreifen.
Beatrice drängte sich zitternd gegen Bernd. Der war ganz ruhig. Er richtete den Revolverlauf auf die Tür und wartete. Schritte durchquerten die Diele und stoppten plötzlich. Bernd hielt die Luft an. Hatte Carlson bemerkt, dass etwas nicht stimmte? Warum ging er nicht weiter? Dann klappte eine andere Tür.
„Die Küche“, flüsterte Bernd.
„Was ist, wenn er gar nicht hereinkommt?“
Bernd antwortete nicht. Wieder ein Türklappen, jetzt kamen die Schritte geradewegs auf die Wohnzimmertür zu, sie wurde geöffnet. In dem hellen Dielenlicht zeigte sich die kräftige, breitschultrige Gestalt eines Mannes, der nach dem Lichtschalter tastete.
„Das ist er nicht“, sagte Beatrice.
Die Deckenlampe flammte auf. Der Mann, der den Schalter betätigt hatte, erstarrte förmlich, als er Bernd und das Mädchen auf der Couch sitzen sah. Er schluckte. „Wer sind Sie, zum Teufel?“, knurrte er dann.
„Das“, sagte Bernd und erhob sich, „wollte ich gerade Sie fragen.“
„Ich“, erklärte der Mann selbstbewusst und hob das kantige Kinn, „bin Polizist.“
„In Zivil?“
„Was dagegen? Ich kann mich ausweisen!“, knurrte der Mann. „Und wer sind Sie?“
„Privatdetektiv. Mein Name ist Bernd Schuster. und ich kann mich ebenfalls ausweisen.“
Der Eindringling war nicht älter als 40 Jahre, hatte ein markantes Gesicht mit großporiger Haut, die rings um das Kinn von einem Pickelkranz verunziert wurde. Seine Augenbrauen waren buschig, und das grauschwarze Haar machte einen drahtigen, borstigen Eindruck. Er trug eine Sportkombination aus braunem Tweed. Unter dem Sakko beulte sich ein Schulterhalfter.
„Was tun Sie hier?“, fragte der Neuankömmling.
„Ich warte noch auf Ihren Namen.“
„Grosser. Hans Grosser, um genau zu sein. Berlin-Steglitz, Revierabschnitt 46. Genügt das?“
„Das wird sich zeigen“, sagte Bernd. „Woher haben Sie den Schlüssel für Carlsons Wohnung?“
„Das“, sagte Grosser, „ist meine Sache.“
„Wo ist Carlson?“
„Keine Ahnung. Ich hoffte, ihn hier anzutreffen“, sagte Grosser.
„Er ist nicht zu Hause, wie Sie sehen.“
„Wer ist die junge Dame in Ihrer Begleitung, ist das nicht Fräulein Wilde?“
„Erraten“, sagte Bernd.
Grosser grinste plötzlich, er schob beide Daumen unter seinen breiten Ledergürtel, wippte kaum merklich auf seinen mit dicken Kreppsohlen ausgerüsteten Schuhen und meinte: „Sieh mal einer an, wir sind also auf der gleichen Fährte. Sie verdächtigen Carlson, genau wie ich. stimmt‘s?“
„Vielleicht“, sagte Bernd.
„Mir machen Sie nichts vor! Sie sind Privatdetektiv, halten sich in Carlsons Wohnung auf – und haben überdies Fräulein Wilde dabei, eine Person, die in der Lage ist, unseren großen Unbekannten zu identifizieren. Glauben Sie, ich könnte nicht zwei und zwei addieren?“
„Und was“, wollte Bernd wissen, „hat Sie auf Carlsons Fährte gebracht?“
„Darüber“, meinte Grosser, „möchte ich jetzt nicht sprechen. Er ist mir schon seit längerer Zeit suspekt, mehr kann ich dazu nicht sagen.“
„Sie sind privat hinter ihm her?“
„Ganz recht, privat. Oder halb dienstlich, wenn Sie so wollen, denn ich trage immerhin meine Dienstwaffe bei mir. Sie müssen das verstehen. Wenn ich von meinen Verdachtsmomenten gesprochen hätte, wäre mir vermutlich Spott und Gelächter beschieden gewesen – deshalb zog ich es vor, meine Ermittlungen auf eigene Faust zu betreiben.“
„Sehr erfolgreich, wie ich sehe“, meinte Bernd.
„Das will ich hoffen. Leider sieht es ganz so aus, als müsste ich meine Lorbeeren mit einem Privatmann teilen“, sagte Grosser und lächelte schief.
„Noch ist nicht bewiesen, dass es sich bei Friedrich W. Carlson um den Gesuchten handelt, um den Engel“, sagte Bernd.
„Zweifeln Sie denn noch daran?“
„Ich weiß nur, dass er kehrtmachen wird, wenn er sieht, dass in seiner Wohnung Licht brennt“, meinte Bernd.
„Oh, daran habe ich nicht gedacht“, räumte Grosser ein und griff nach dem Lichtschalter. „Knipsen wir es aus und warten, bis er aufkreuzt.“
„Kannten Sie Lochter?“, fragte Bernd, als sie im Dunkeln standen. Grosser bewegte sich auf das Fenster zu. Es war klar, dass er vorhatte, die Straße zu beobachten. Vielleicht wollte er auch nur seinen Gesprächspartnern nahe sein.
„Lochter? Warten Sie mal – der ist erst vorhin im Polizeifunk erwähnt worden. Daniel Lochter, Privatdetektiv. Ist das der Mann, von dem Sie sprechen?“
„Genau der“, sagte Bernd.
„Ich habe seinen Namen heute zum ersten Mal gehört“, erklärte Grosser.
„Er war Friedrich Carlson hart auf den Fersen, genau wie wir“, sagte Bernd.
„Musste Lochter deshalb sterben?“
„Das ist nicht auszuschließen.“
„Hoffen wirn dass uns nicht das gleiche Schicksal blüht“, spottete Grosser.
„Ich möchte gehen“, schaltete sich das Mädchen nervös ein. „Was soll ich hier? Er kommt ja doch nicht! Meine Nerven sind derartigen Strapazen nicht gewachsen.“
„Gut, wir brauchen Sie nicht mehr“, sagte Bernd. „Aber rufen Sie mich morgen an, in Ordnung?“
„Okay“, sagte das Mädchen.
„Gute Nacht“, meinte Grosser. „Mit Carlson werden wir schon allein fertig. Nur für den Fall, dass wir Sie noch heute Nacht benötigen – wo sind Sie zu erreichen?“
„In der Pension Gutenberg am Kurfürstendamm“‘, sagte Beatrice Wilde und huschte aus dem Zimmer.
„Eine tolle Frau, wirklich Extraklasse“, sagte Grosser, nachdem die Wohnungstür hinter dem Mädchen ins Schloss gefallen war. Er schielte auf die Waffe, die Bernd immer noch in der Hand hielt. „Angst?“
Bernd schüttelte den Kopf. Er schob den Revolver zurück ins Schulterhalfter. Beide Männer standen jetzt nebeneinander am Fenster und blickten hinaus. Sie sahen, wie Beatrice das Haus verließ, sich in ihren Flitzer klemmte und gleich darauf davonfuhr.
„So was kriegt unsereiner niemals ins Bett“, seufzte Grosser. „Wirklich ein Jammer!“
Er schob die Gardine beiseite und winkte, als der Flitzer unten vorbeirollte, aber Beatrice Wilde nahm sich nicht die Mühe, zu dem Fenster hochzuschauen.
„Das war ein Fehler“, sagte Bernd ruhig.
„Glauben Sie, Engel könnte das gesehen haben?“
„Das nicht“, meinte Bernd, „aber als Sie winkten, sah ich den Revolver in Ihrem Schulterhalfter blitzen, und nun wüsste ich gern, was einen Beamten veranlasst, sich mit goldenen Waffen zu schmücken.“
––––––––
12
Grosser zuckte herum, kam aber nicht mehr dazu, den Revolver aus dem Schulterhalfter zu reißen. Bernds Rechte flog hoch, die Handkante traf hart und genau.
Grosser stieß einen Schmerzensruf aus und sackte in die Knie. Bernd riss seinem Gegner den goldenen Revolver aus dem Halfter und schleuderte ihn hinter sich. Grosser kam auf die Beine, er schwankte leicht, wie betrunken, aber in seinen schmal gewordenen Augen standen wacher Hass und wilde Entschlossenheit.
Bernd trat einen halben Schritt zurück. Er zog seinen Revolver hervor, richtete den Lauf auf seinen Gegner und sagte: „Licht, bitte!“
Grosser zögerte, dann tappte er zur Tür. Er schien froh zu sein, sich fangen zu können. Die Nachwirkungen des Karatetreffers hielten länger an, als er es für möglich gehalten hätte. Er betätigte den Lichtschalter, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und fragte: „Was soll der Quatsch, was haben Sie vor?“
„Ich wüsste gern, was Sie mit Carlson angestellt haben“, sagte Bernd.
„Ich kenne ihn nicht“, behauptete Grosser. „Ich bin hergekommen, um ihn kennenzulernen, das wissen Sie doch!“
„Ein hübsches Märchen“, spottete Bernd.
„Beweisen Sie mir das Gegenteil“, gab Grosser im gleichen Tonfall zurück.
„Kein Problem“, sagte Bernd und ging auf Grosser zu. „Stellen Sie die Lauscher hoch und korrigieren Sie mich, wenn etwas nicht stimmen sollte. Carlson hat von Lochter erfahren, dass Sie korrupt sind. Carlson legte Lochter mitsamt Sekretärin um, informierte die Mordkommission und teilte mit, dass noch heute Nacht ein Polizist sterben müsse – ein korrupter Beamter, wie er hinzufügte. Inspektor Südermann schaltete prompt. Er gab einen Rundspruch durch, den Sie mitkriegten, aber nicht recht glauben konnten. Sie gingen zum verabredeten Treffpunkt. Als Sie dort statt Lochter einen Fremden antrafen, schalteten Sie prompt. Sie zogen ihn aus dem Verkehr. Ich bezweifle, dass Sie ihn töteten. Warum auch? Sie sind scharf auf sein Geld – und Carlson, das wissen Sie inzwischen, hat davon eine ganze Menge. Sie sagten gerade, Sie könnten zwei und zwei addieren. Wie gut Sie das verstehen, haben Sie bewiesen. Sie erkannten auf Anhieb, wer sich hinter Carlson verbarg, und als Sie ihm seinen goldenen Revolver abgenommen hatten, besaßen Sie auch den Beweis für Ihre cleveren Kombinationen.“
„Sie haben eine rege Phantasie“, sagte Grosser.
„Etwas daran auszusetzen?“
„Eine ganze Menge. Sie beschränkt sich auf Hypothesen“, sagte Grosser.
„Sie vergessen Carlsons goldene Waffe“, meinte Bernd.
„Wenn ich die Schnauze halte, kommen Sie keinen Schritt weiter“, sagte Grosser.
„Wetten, dass?“
Grosser machte einen Sprung nach vorn. Für einen Mann seiner Größe und seines Gewichts war er erstaunlich behände. Seine Faust zielte auf Bernds Kinnpartie, sauste aber ins Leere, Bernd warf den Revolver zur Seite, er war überzeugt davon, mit seinem Gegner auch ohne Waffe fertigzuwerden.
Grosser wirbelte herum, hochrot vor Wut und Erregung. Er hielt sich für einen perfekten Kämpfer, es passierte ihm nicht sehr häufig, dass es einem Gegner gelang, ihn ins Leere laufen zu lassen.
Er ging erneut auf Bernd los, mit beiden Fäusten. Bernd ließ ihn kommen, praktizierte einen Sidestep und zog die Rechte hoch, als er eine Lücke sah. Er traf hart, musste aber fast gleichzeitig einen Schwinger einstecken, der es gleichfalls in sich hatte.
Grosser war kein Anfänger, er hatte zwei Jahre lang einen Meisterschaftsgürtel seines Boxclubs getragen und wusste immer noch, was sich mit harten Fäusten machen lässt. Darüber hinaus hatte er keine Skrupel, mit Tricks und Fouls zu arbeiten, die in jedem regulären Kampf die sofortige Disqualifikation nach sich gezogen haben würden. Aber hier gab es keinen Ringrichter, hier gab es nur Erfolg oder Nichterfolg.
Das wusste auch Bernd. Ihm ging es ebenfalls nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen. Er stellte sich auf die raue Gangart seines Gegners ein, schoss gleichsam aus der Hüfte und teilte aus, was er für richtig hielt.
Grosser warf sich zu Boden und versuchte Bernds Beine wegzureißen.
Es gelang ihm. Bernd stürzte und konterte mit dem Knie, als Grosser eine hässliche Attacke startete, deren erklärtes Ziel Bernds empfindlichere Körperteile waren.
Kickend, tretend und schlagend rollten sie über den teppichbespannten Boden. Grosser erwischte eine Bodenvase und schleuderte sie gegen Bernds Kopf, traf aber nur dessen Schulter. Ein harter, scharfer Schmerz durchzuckte Bernds Knochengerüst, und für einen Moment lang glaubte er, sein Schlüsselbein sei gebrochen.
Er bereute, sich von seiner Waffe getrennt zu haben. Die wütende Verbissenheit seines Gegners machte klar, dass es sehr schwierig sein würde, ihn in den Griff zu bekommen. Andererseits liebte Bernd die harte Herausforderung, und im Übrigen blieb ihm gar keine andere Wahl, als sich der Auseinandersetzung zu stellen.
Sie kamen erneut auf die Beine. Bernd biss die Zähne zusammen, beschränkte sich eine volle Minute lang auf die Defensive und entging nur knapp einem Blackout, als Grosser seine Rechte zu einem wuchtigen Tiefschlag veranlasste.
Bernd wurde sauer, sogar stocksauer. Er marschierte nach vorn, schoss links und rechts ab, was ihm verwertbar erschien, spürte, dass Grossers Reserven nachließen und scheute sich nicht, diesen Umstand skrupellos auszunutzen. Grosser keuchte wie eine schadhafte Dampfmaschine, er schlug unentwegt, aber seine Schwinger wurden zusehends saft- und kraftloser, sie kamen ohne Kraft und Präzision.
Bernd kam mit der Linken voll durch und traf Grossers Kinn. Der flog über einen Stuhl, ging mitsamt dem Sitzmöbel zu Boden und blieb liegen.
Bernd sammelte die Revolver ein. Er wog den goldenen nachdenklich in seiner Hand, beschnupperte die Mündung, zählte die in der Trommel befindlichen Patronen, schob seine eigene Waffe zurück ins Schulterhalfter und die mutmaßliche Mordwaffe von Engel in seinen Hosenbund, dann setzte er sich und wartete, bis Grosser zu sich kam.
Es dauerte fast eine Minute, dann wälzte sich Grosser auf den Rücken und starrte blinzelnd an die Zimmerdecke. Danach schaute er Bernd an, erst Verblüffung, dann jähen Hass in den Augen.
Grosser quälte sich auf die Beine, ließ sich in einen Sessel fallen und sagte: „Meinen Respekt, Schnüffler. Du hast einen ordentlichen Bums.“
„Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich einer etwas distanzierteren Art bedienen würden“, sagte Bernd Schuster. „Mit Ganoven duze ich mich nicht.“
„Nun mal schön langsam“, sagte Grosser. „Wir sitzen doch im gleichen Boot, oder etwa nicht? Carlson ist für uns eine Goldmine. Du kommst ohne meine Hilfe nicht an ihn heran. Wir werden teilen, das ist ein Wort – oder?“
„Ein Wort, das mir nicht schmeckt“, sagte Bernd.
„Wie viel verlangst du?“
„Hier liegt ein kleines Missverständnis vor“, meinte Bernd. „Ich bin hinter dem Engel, aber nicht hinter seinem Geld her.“
„Der Engel muss am Leben und in Freiheit bleiben – Carlson, meine ich“, sagte Grosser. „Wir brauchen ihn. Er haut die Gangster in die Pfanne, er macht Kleinholz aus ihnen. Carlson ist mein Mann!“
„Dann“, spottete Bernd, „wüsste ich gern, weshalb Sie es für richtig fanden, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.“
„Ich habe ihn nur auf Eis gelegt“, sagte Grosser. „Das ist ein Unterschied.“
„Wo ist er jetzt?“
Grosser grinste. „Darauf erwarten Sie hoffentlich keine Antwort. Ich will Ihnen entgegenkommen. Ich gehe auf Distanz, wie Sie das wünschen, wir verzichten auf jegliche Vertraulichkeit, aber ich hoffe, wir werden trotzdem in eine profitable Partnerschaft einsteigen. Ich komme ohne Sie nicht weiter, und Sie können ohne mich nichts erreichen. Sie haben den Schlüssel zur Wahrheit und Carlsons goldene Waffe, und ich habe Carlson.“
„Es dürfte kein Problem sein, ihn zu finden“, sagte Bernd. „Das Dienstbuch ihres Reviers gibt Aufschluss darüber, wann Sie gegangen sind. Wir können davon ausgehen, dass Sie Carlson in der Nähe des Reviers getroffen und auch dort zur Strecke gebracht haben, wir können weiter zugrunde legen, dass Sie ein Versteck wählten, das ...“
„Hören Sie auf damit“, fiel Grosser ihm barsch ins Wort. „Das bringt doch nichts, Mann! Carlson ist unter Brüdern eine Million wert. Wir teilen uns das Geld und geben Carlson Rückendeckung. Er wird weitermachen, er wird mit dem Verbrechen aufräumen, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.“
„Einfälle haben Sie! Ich habe heute mit Inspektor Südermann gesprochen. Inzwischen haben sich ein paar Nachahmer dieses verrückten Carlson gefunden – und ein paar übernervöse Leute haben so reagiert, wie es nach Lage der Dinge zu erwarten war. Wir sind hier weder in Chicago noch in New York, auch wenn ich einräumen muss, dass es in Berlin eine starke Unterwelt gibt. Seit Beginn der Engel-Hysterie ist die Kurve der Gewaltverbrechen steil nach oben gegangen. Wollen Sie, dass dieser Trend sich fortsetzt?“
„Die Kurve entsteht durch die hohe Zahl der von Carlson erledigten Gangster“, behauptete Grosser. „Was das betrifft, so kann sie mir gar nicht steil genug werden. Diese Ratten müssen am eigenen Blut ersticken, und Carlson ist der Mann, der das zuwege bringt.‘‘
„Seltsam“, meinte Bernd kopfschüttelnd. „Sie treten selbst als Verbrecher auf, Sie wollen sich am Geld eines gesuchten Mörders bereichern, und meinen gleichzeitig, dem Recht dienen zu können. Wie vereinbart sich das miteinander?“
„Lassen Sie uns keine Haarspalterei betreiben“, sagte Grosser mürrisch. „Ich muss versuchen, meinen Vorteil zu wahren. Wissen Sie, was ein Polizist verdient? Das ist ein Trauerspiel, da darf sich niemand wundern, wenn wir uns gelegentlich selbst bedienen – natürlich nur dort, wo es den richtigen Leuten weh tut. Ich finde das ganz legal. Machen wir halbe-halbe?“
„Nein“, sagte Bernd.
„Sie sind ein Idiot!“
Bernd erhob sich. „Gehen wir.“
„Wohin?“
„Zum nächsten Revier. Es ist keine drei Minuten von hier entfernt. Ihre Kollegen werden beglückt sein, das Geschehen zu Protokoll nehmen zu dürfen. Wer von denen hätte sich schon träumen lassen, dass der gesuchte, gefürchtete Engel praktisch bei ihnen um die Ecke wohnte?“
„Witzbold“, knurrte Grosser und stand auf. Die Tatsache, dass er mitkam, ließ erkennen, dass er darauf baute, unterwegs einen gelungenen Übertölpelungsversuch inszenieren zu können. Bernd war darauf eingestellt, er fürchtete sich nicht davor.
„Gehen Sie voran“, sagte er, „und vergessen Sie nicht, dass ich mit meiner Waffe umzugehen verstehe.“
Sie verließen das Apartment. Inzwischen war es dreiundzwanzig Uhr fünfzig geworden. Die Straße war nur mäßig belebt. Grosser betrat sie als erster.
Bernd sah das Aufflammen eines Mündungsfeuers. Es kam von der anderen Straßenseite. Er warf sich in Deckung und hörte gleichzeitig das dumpfe Dröhnen des Schusses.
Grosser machte einen Schritt zur Seite, drehte sich ab und schien in den Knien einzusacken, fiel aber nicht zu Boden. Ein zweiter Schuss ertönte. Grosser stürzte auf die Steinplatten des Bürgersteigs.
Der Verkehr rollte weiter, unweit von Bernd blieb ein Fußgänger stehen, ziemlich verdutzt, er hatte die Schüsse gehört, er sah Bernd und Grosser am Boden liegen, hatte aber offenbar Mühe, das Geschehen in einen plausiblen Zusammenhang zu bringen.
Bernd Schuster sprang hoch, hastete hinter einem Wagen in Deckung und versuchte das Dunkel des Hauseingangs mit den Blicken zu durchdringen, aus dem das zweimalige Aufflammen des Mündungsfeuers gekommen war.
„Was ist passiert, was ist mit dem Mann?“, rief der stehengebliebene Fußgänger.
„Ein Überfall“, rief Bernd zurück. „Benachrichtigen Sie Polizei und Krankenwagen, rasch, die 110!“
Der Fußgänger reagierte seltsam. Er rannte plötzlich davon, als käme ihm erst jetzt zum Bewusstsein, in welcher Gefahrenzone er sich bewegt hatte.
Bernd starrte immer noch in den gegenüberliegenden Hauseingang. Er wusste, dass kostbare Sekunden verstrichen, hatte aber keine Lust, sich durch unbedachtes Vorgehen eine Blöße zu geben. Er hastete zu dem bäuchlings auf dem Bürgersteig liegenden Grosser, drehte ihn auf die Seite und war dabei bemüht, in kauernder Stellung ein möglichst kleines Ziel zu bieten. Bernds Mund wurde trocken, als er in die Augen des Polizisten starrte. Sie gehörten einem Toten.
––––––––
13
Bernd richtete sich auf.
„Was ist mit ihm?“, rief eine Stimme von oben herab. Er blickte hoch, eine Frau schaute aus dem Fenster.
„Mord“, brüllte er zurück. „Alarmieren Sie die Polizei.“
Dann sprintete er quer über die Fahrbahn. Ein scharf bremsendes Fahrzeug ließ erkennen, dass er sich dabei nicht übertriebener Vorsicht bediente. Er rannte weiter, ohne sich um das wütende Hupen des irritierten Verkehrsteilnehmers zu kümmern. Er hielt immer noch den Revolver in der Hand, schussbereit, aber im Augenblick sah es nicht so aus, als ob er für ihn Verwendung haben könnte.
Der Hauseingang endete an einer angelehnten Tür, die zum Hof führte. Der Hof war beleuchtet. Bernd erkannte ein paar Fahrzeuge, die auf der Hoffläche abgestellt waren, und eine etwa mannshohe Mauer, die das Grundstück begrenzte. Auf Anhieb erkannte er, dass der Schütze keine Mühe gehabt hatte, den Fluchtweg über die Mauer zu wählen – aber da es drei Möglichkeiten gab, sich von hier abzusetzen, musste er sich entscheiden, welche die wahrscheinlichste war. Er kam zu dem Schluss, dass der Mörder nur das Grundstück gewählt haben konnte, dessen Haus zur Parallelstraße gehörte, und schwang sich über die dazugehörige Mauer, um seine Suche fortzusetzen.
Der Hof, dessen Asphaltfläche er mit federnden Beinen nach seinem Absprung erreichte, war lang und schmal, an seinem vorderen Ende stand ein hohes, altes Haus auf pfeilerähnlichen Trägern. Die zwischen ihnen liegende Ausfahrt führte zur Straße. Bernd erreichte sie nach raschem Lauf, sah aber niemanden, der sein Interesse weckte.
Der Schütze hatte ein Gewehr verwendet, das stand außer Zweifel, wenn er es nicht weggeworfen hatte, musste er es in einem passenden Behälter bei sich tragen, vermutlich auseinandergenommen. In einem Karton, einem Koffer oder einer Instrumententasche.
Bernd schob den Revolver zurück ins Schulterhalfter, er hatte nicht vor, als Buhmann aufzufallen. Er machte kehrt, legte den Weg zum Tatort ohne Eile zurück und stoppte gelegentlich, um einem dunklen Winkel seine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Seine Mühe zahlte sich nicht aus, der Schütze blieb verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.
Um den Toten vor Carlsons Haus hatte sich eine dichte Menschentraube gebildet. Die Polizei war noch nicht eingetroffen, aber ferne, rasch lauter werdende Martinshörner zeigten an, dass sie sich auf dem Wege nach hier befand.
Bernd schob die Hände in die Hosentaschen und wartete. Er dachte an seinen Freund Horst Südermann und glaubte zu wissen, wie die Kommentare des Inspektors beschaffen sein würden. Trotzdem gab es keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Der entscheidende Durchbruch war gelungen. Man wusste endlich, wer der Engel war, schon am nächsten Morgen würden seine Fotos auf den Frontseiten der Zeitungen prangen und über die Bildschirme der Nation flimmern.
Friedrich W. Carlsons kurze, unrühmliche Karriere war beendet.
Das dachte jedenfalls Bernd, aber Friedrich W. Carlson dachte darüber ganz anders.
––––––––
14
Beatrice klingelte nach dem Etagenkellner. Er erschien prompt, ein devotes Lächeln auf seinem Gesicht. „Frau Bartels?“, fragte er.
Sie blickte ihn verblüfft an, dann schaltete sie. Sie vergaß immer wieder, dass sie sich unter einem Decknamen in dem Hotel eingemietet hatte. „Bringen Sie mir eine Karaffe Orangensaft mit Eis, bitte.“
Der Ober nickte und zog sich zurück, Beatrice stellte das Radio an. Vielleicht hörte sie in den Nachrichten, dass man Carlson zur Strecke gebracht hatte.
Die Tür öffnete sich ohne vorheriges Klopfen. Beatrice wandte den Kopf, ihr blieb der Atem weg, als sie sah, wer das Zimmer betrat.
„Hallo“, sagte Friedrich W. Carlson und zog die Tür hinter sich ins Schloss. „Es war wirklich nicht ganz leicht, ungesehen hereinzukommen.“
Er hatte einen länglichen Koffer bei sich, eine Art Instrumentenkasten. Beatrice wollte aufstehen, sie wollte etwas sagen, aber sie brachte weder das eine noch das andere zustande. Schließlich sagte sie: „Der Ober – er wird gleich kommen.“
„Macht nichts“, meinte Friedrich W. Carlson und schob den Koffer unter das Bett. „Ich drücke ihm ein Trinkgeld in die Hand, das wird sein Verständnis fördern.“
Er warf einen Blick ins angrenzende Badezimmer. „Nicht übel“, stellte er fest. „Ein gepflegtes Haus. Sie sehen blass aus, Beatrice. Fühlen Sie sich nicht wohl?“
‚Das darf einfach nicht wahr sein‘, dachte Beatrice mit hämmernden Herzen. ‚Du hast ein normales, sorgloses Leben geführt, aber es war nicht immer leicht, es gab ein paar Tiefs darin, Schwierigkeiten in der Schule, eine ernste Krankheit. Wenn du davon absiehst, dass du niemals finanzielle Sorgen hattest, und dass deine Eltern reich sind, wenn du weiter berücksichtigst, dass du an einer unglücklich verlaufenen Liebesaffäre fast zerbrochen wärest, war es ein Leben wie jedes andere auch. Jetzt ist das anders, ganz anders. Du bist in einen Strudel geraten, der dich zu verschlingen droht, du wirst mit einer Hochspannung konfrontiert, die kein Ende zu finden scheint und der du einfach nicht gewachsen bist.‘
Es klopfte. Der Ober brachte auf einem silbernen Tablett das Bestellte.
„Ich erledige das schon“, sagte Friedrich W. Carlson mit der gelassenen Selbstverständlichkeit eines Mannes, der in jeder Situation den Kopf oben behält. „Besorgen Sie uns noch ein Glas und eine halbe Flasche Bourbon. Hier, nehmen Sie das mit“, sagte er und holte eine größere Banknote aus seiner Tasche. „Der Rest ist für Sie.“
Der Ober warf einen Blick auf den Geldschein, lächelte strahlend und zog sich dienernd zurück. „Wird sofort erledigt, nur ein paar Minuten Geduld ...“
Friedrich W. Carlson wartete, bis sich die Tür hinter dem Ober geschlossen hatte, dann sagte er: „Ich konnte nicht kommen, nicht zur verabredeten Zeit – du warst dort, nicht wahr?“
Die Tatsache, dass er sie plötzlich duzte, steigerte Beatrices Furcht. Warum fand sie nicht die Kraft, ihn in die Schranken zu weisen?
„Ich fragte dich etwas“, sagte er, und plötzlich hatte seine Stimme wieder den alten, drohenden Klang, einen Tonfall, der Beatrice erschreckte.
„Ja, ich war dort“, sagte Beatrice.
Er lachte leise. „Ich weiß.“
„Sie haben mich gesehen?“
„Nur den Wagen. Du hast mir einiges zu berichten“, sagte er und verschränkte die Arme vor der Brust. „Ich warte.“
‚Er weiß alles‘, schoss es ihr durch den Kopf. ‚Er hat mich beobachtet, er wollte feststellen, ob mir zu trauen, ist. Er hat gesehen, wie Bernd Schuster zu mir in den Wagen kletterte, er hat auch verfolgt, wie dieser Grosser sich in seine Wohnung begab.‘
„Stimmt es, dass Sie Friedrich W. Carlson sind?“, trat sie die Flucht nach vorn an.
„Das stimmt“, sagte er. „Seit wann weißt du es?“
Sie erzählte ihm, was sie erlebt hatte. Sie ließ nichts aus. Es war besser so. Wenn sie etwas vergaß, wenn sie ihn wütend oder misstrauisch machte, würde er zu allem fähig sein, das wusste sie.
„Bernd Schuster und Grosser“, seufzte Carlson und setzte sich auf das in der Mitte des Raumes stehende Bett. Er klopfte mit der flachen Hand darauf, als müsste er sich von seinem Federungskomfort überzeugen, dann lächelte er breit und meinte: „Wir werden gut schlafen – aber vorher werde ich dir zeigen, wie groß meine Liebe zu dir ist.“
Beatrice fühlte sich wie paralysiert. Sie wusste, dass er sie begehrte, er hatte daraus keinen Hehl gemacht, aber die Selbstverständlichkeit, mit der er seine Wünsche in die Tat umzusetzen trachtete, schockierte und erschreckte sie. Sie nahm sich vor, ihn zu stoppen, egal wie, aber sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, wie das zu bewerkstelligen war.
Es klopfte. Der lächelnde Ober brachte ein weiteres Tablett mit Gläsern und einer flachen Whiskyflasche. Er zog sich sofort wieder zurück. Carlson füllte zwei Gläser mit Bourbon, Eis und Orangensaft. Er brachte eines davon Beatrice. „Ich mache mir nichts aus Alkohol“, murmelte sie.
„Er wird dir guttun“, sagte er, verzog plötzlich das Gesicht und meinte: „Dem Schwein hab‘s ich gegeben.“
„Bitte?“, fragte sie erschreckt.
„Grosser“, sagte er. „Ich habe ihn umgelegt.“
„Nein!“, hauchte Beatrice. Seltsamerweise hatte sie aufgehört zu leiden. Sie hatte einen Punkt erreicht, wo Schock und Entsetzen an ihr abglitten, einen Sättigungsgrad der Furcht und des Terrors.
„Oh doch“, sagte Carlson und genehmigte sich einen großen Schluck aus seinem Glas. „Ein korrupter Polizist. Ich wollte ihn abservieren, aber er trickste mich aus. Ich glaubte schon, das wäre mein Ende – aber dann fiel mir ein, dass dieser Geier nicht mein Leben, sondern mein Geld wollte. Er nahm mir die Wohnungsschlüssel ab, und ich erläuterte ihm, wo er den Safe findet. Er brachte mich in einen Keller, knebelte und fesselte mich, dann haute er ab. Er war so versessen darauf, möglichst schnell an mein Geld heranzukommen, dass er einen miserablen Job leistete, jedenfalls hatte ich keine Mühe, mich von den Fesseln und aus dem Keller zu befreien.“
Beatrice hörte kaum hin. Ihr war es egal, was außerhalb dieses Raumes geschehen war. Für sie kam es nur noch darauf an, mit diesem Carlson fertig zu werden. Sie zermarterte sich den Kopf nach einer Lösung, aber sie fand keine.
„Ich fuhr zu einem Versteck“, sagte er. „Zu einem Waffenversteck. Ich besorgte mir von dort ein Gewehr, fuhr nach Hause und wartete, bis Grosser aufkreuzte. Ich schoss, als ich ihn im Visier hatte. Er fiel nicht gleich um, da drückte ich nochmals ab ...“
„Ich habe die Schüsse gehört“, erinnerte sich Beatrice murmelnd. „Nachdem ich Ihre Wohnung verlassen hatte und losgefahren war, stoppte ich vor dem nächsten Lokal. Mir war flau im Magen, ich fühlte mich nicht verkehrstauglich, ich musste einen Kaffee trinken und eine Kleinigkeit essen. Ja, ich hörte das Knallen, aber ich versuchte mir einzureden, dass es die Fehlzündungen eines Wagens seien.“
Er schaute sie an. „Welch ein Glück, dass du vor der Kneipe deinen Flitzer geparkt hattest. Er machte mich darauf aufmerksam, dass du im Inneren anzutreffen bist, aber ich hielt es für klüger, draußen zu bleiben. Ich wartete, bis ein Taxifahrer auf mein Winken reagierte und war kaum eingestiegen, als du aufkreuztest und losfuhrst. Ich folgte dir hierher und ließ mir von dem Portier sagen, unter welchem Namen du abgestiegen bist. Warum das Versteckspiel? Doch nicht etwa meinethalben?“
„Ich habe mit ansehen müssen, wie zwei Menschen sterben mussten“, sagte sie. „Ich bin verwirrt, verängstigt, schockiert. Ich konnte und wollte nicht in dem Haus bleiben. wo das Furchtbare geschah.“
„Schon gut, ich mache dir keine Vorwürfe“, meinte er. „Du kannst alles wiedergutmachen. Deine Familie ist reich, ich wette, sie besitzt ein Dutzend Häuser. Vor allem Wochenendhäuser. Habe ich recht?“ Er wartete ihre Antwort nicht ab und sagte: „Mein Inkognito ist jetzt zum Teufel, ich kann nicht in meine Wohnung zurück. Ich muss untertauchen und mich einer Gesichtsoperation unterziehen. Ich brauche dazu Hilfe, ein sicheres Versteck. Du wirst mir beides geben – das und deine Liebe.“
Plötzlich waren ihr Ärger und ihre Abneigung gegen ihn stärker als jede Furcht. „Hören Sie endlich auf damit“, sagte sie scharf. „Ich kann keinen Mörder lieben. Und noch viel weniger bin ich bereit, Sie zu verstecken.“
Er blinzelte verwundert, dann lachte er. „Ich bin kein Mörder“, stellte er fest. „Ich bin ein Richter. Richter und Henker in einer Person. Ich halte die Stadt sauber. Ich befreie sie von Ratten und Ungeziefer. Dafür solltest du mir dankbar sein, du solltest es mir lohnen.“
‚Er hat den Verstand verloren‘, dachte sie verzweifelt. ‚Mit einem solchen Menschen kann man nicht reden‘.
„Wir gehen“, sagte er. „Sofort.“
„Wohin?“
„Das bestimmst du“, sagte er und fügte drohend hinzu: „Aber versuche nicht, mich in eine Falle zu locken. Es wäre dein Ende.“
Beatrices Gedanken wirbelten durcheinander. Was konnte, was musste sie tun, um sich von Carlson zu lösen? Wie konnte sie das Personal und die Polizei darauf hinweisen, dass sie sich in der Gewalt eines mehrfachen Mörders befand?
„Da ist ein Häuschen oben am kleinen See“, fiel es ihr ein, „nicht sehr weit von der Stadt entfernt. Es gehört meinen Eltern, der Schlüssel befindet sich in einem Versteck, das ich kenne.“
„Warum sagst du das nicht gleich?“, fragte Carlson, dessen Laune sich schlagartig besserte. Er bückte sich, zog den Koffer unter dem Bett hervor, steckte die flache Whiskyflasche ein und sagte: „Komm, lass uns verschwinden.“
„Ich muss die Rechnung noch bezahlen“, sagte sie und hatte plötzlich einen, wie sie glaubte, rettenden Einfall.
Sie fuhren gemeinsam mit dem Lift nach unten. Trotz der späten Stunde herrschte in der Halle noch viel Betrieb. Beatrice trat an den Rezeptionstresen, gab Schlüssel und Hotelausweis ab und sagte: „Ich reise ab. Meine Rechnung, bitte.“
Der Portier nickte und ließ den Ausweis mit einem Vermerk in das angrenzende Büro gehen. Die Rechnung kam knapp eine Minute später zurück. Carlson war diskret zur Seite getreten, er studierte interessiert die Auslagen des Zeitungsstandes. Beatrice holte ihr Scheckbuch aus der Handtasche und füllte ein Formular aus.
‚Ich bin in Engels Gewalt‘, schrieb sie. ‚Er heißt Friedrich Carlson und will mit mir zu unserem Wochenendhaus am Großen Wannsee, in Heckelshorn. Beatrice Wilde.‘ Sie wollte das Formular abreißen, aber in diesem Moment legte sich eine behandschuhte Hand auf ihre Rechte. Beatrice vereiste. Sie wandte den Kopf und blickte in Carlsons Augen. Sie sah darin nicht länger Schwärmerei und Bewunderung, sie erkannte darin nur jähen Hass.
„Aber nicht doch, Liebling“, sagte er mit seiner unerträglich sanften Stimme. „Du hast dich verschrieben.“
Beatrice schluckte. Carlson legte den Koffer auf den Rezeptionstresen. Beatrice verstand die stumme Drohung. Wenn sie schrie oder sich auf andere Weise bemerkbar machte, würde er mit einem Ruck den Koffer öffnen und mit seinem Gewehr ein Blutbad anrichten, dessen erstes Opfer vermutlich sie sein würde.
Sie nickte, zerknüllte das beschriebene Formular und warf es in den Papierkorb. Sie hatte Mühe, den Scheck auszustellen, sie fühlte sich verloren und wusste nicht, was sie noch tun konnte, um sich zu retten.
„Danke“, sagte der Portier und nahm den Scheck entgegen. „Ich hoffe, Sie beehren uns wieder.“
Beatrice nickte wie betäubt, dann verließ sie an Carlsons Seite die Hotelhalle. Der Lift brachte sie in die Tiefgarage, wenig später war sie mit Carlson unterwegs zum Großen Wannsee.
„Du wolltest mich verraten“, stellte er fest. Er hielt den Koffer mit dem Gewehr auf seinen Knien, er schaute sie beim Sprechen nicht an.
„Ich habe nur versucht, meine Pflicht zu tun“, sagte sie. Sie fasste wieder Mut, einen grimmigen, beinahe selbstmörderischen Mut. Wenn sie schon sterben musste, würde sie das erhobenen Hauptes tun und Carlson beweisen, dass er kein Held, sondern ein feiger Mörder war.
„Deine Pflicht?“, höhnte er. „Ist es deine Pflicht, den Verbrechern zu helfen?“
Sie schwieg. Wirklich, es war sinnlos, mit ihm zu reden.
„Ich werde dich besitzen“, sagte er und holte tief Luft. „Das wird dir eine letzte Gelegenheit geben, dich zu entscheiden. Wenn du mir mit Leidenschaft und Hingabe entgegenkommst, werde ich bereit sein, dir noch eine Chance zu geben – aber wenn du dich spröde und verklemmt anstellst, wenn du zeigen solltest, dass es zwischen uns nichts Gemeinsames geben kann, wirst du enden wie die anderen.“
––––––––
15
Bernd betrat die Hotelhalle und ging schnurstracks auf den Rezeptionstresen zu. „Welches Zimmer hat Fräulein Wilde, bitte?“
„Erna Wilde?“, fragte der Portier und warf einen Blick in sein Register.
„Nein, Beatrice Wilde“, sagte Bernd ungeduldig.
„Tut mir leid, aber eine Dame dieses Namens ist bei uns nicht abgestiegen.“
„Das“, sagte Bernd und zog ein Foto von Beatrice aus der Tasche, „ist sie.“
„Oh“, sagte der Portier. „Sie war bei uns als Frau Bartels eingetragen. Vor einer Stunde ist sie abgereist.“
„Wohin?“
Der Portier lächelte. „Danach pflegen wir unsere Gäste nicht zu fragen.“
„War sie allein?“
„Nein, in ihrer Begleitung befand sich ein Herr. Sind Sie Polizist?“
„Privatdetektiv“, sagte Bernd und wies sich aus. „Können Sie den Mann beschreiben?“
„Kein Problem. Er benahm sich irgendwie merkwürdig – und mir schien es so, als hätte die junge Dame Angst vor ihm. Ich habe sie mit den Blicken fixiert, wollte feststellen, ob meine Vermutung stimmt, aber sie war zu aufgeregt, um das zu bemerken. Sie hat sich beim Ausstellen des ersten Schecks verschrieben, so durcheinander war sie.“
„Wo ist der Scheck?“
„Bereits in der Buchhaltung, – der zweite war ja in Ordnung. Den ersten hat sie zusammengeknüllt und weggeworfen.“
„Wohin?“
„In den Papierkorb, wohin sonst?“
„In diesen?“, fragte Bernd.
„Ja, er müsste noch drin sein ...“
Bernd hatte sich bereits gebückt. Er fischte das Papierknäuel auf Anhieb heraus, strich es glatt und bekam schmale Augen, als er die Zeilen überflog. Dann zeigte er dem Portier, was darauf stand.
„Um Himmels willen“, entfuhr es dem Portier. „Das war der Engel? Er hat gelesen, was die junge Dame mir mitzuteilen versuchte! Jetzt verstehe ich ihre plötzliche Angst. Sie zitterte um ihr Leben! Ob er in diesem komischen, flachen Koffer seinen goldenen Revolver hatte?“
Bernd hörte kaum hin. Er biss sich auf die Unterlippe und dachte nach. Es war anzunehmen, dass Beatrice und ihr Entführer mit ihrem Wagen unterwegs waren. Da Abfahrtstermin und Ziel der beiden bekannt waren, war es leicht, zu errechnen, wo sich das Fahrzeug im Augenblick befand. Nicht sehr viel schwieriger würde es sein, den Wagen mit Hilfe von Straßensperren oder Polizeikontrollen zu stoppen.
Nur gefährdete eine solche Aktion Beatrices Leben. Carlson war alles zuzutrauen, auch eine Selbstzerstörung – nur würde er in einem solchen Fall, das stand für Bernd außer Zweifel, alle mit sich in den Abgrund reißen, die sich in seiner Nähe befanden – voran Beatrice, von der er jetzt wusste, wie sie zu ihm stand.
„Ich rufe die Polizei“, sagte der Portier und griff nach dem Hörer.
„Ich erledige das schon“, meinte Bernd und betrat eine der Telefonzellen. Einer von Inspektor Südermanns Beamten meldete sich, er holte seinen Chef ans Telefon. Bernd berichtete mit kurzen Worten, was sich ereignet hatte.
„Du musst sofort Beatrices Eltern anrufen und feststellen, wo sich das Wochenendhaus befindet“, entschied der Inspektor. „Ich fahre von hier weg, verständige von unterwegs das zuständige Revier und sorge mit den Beamten dafür, dass das Wochenendhaus umstellt wird.“
„Wo treffen wir uns?“, fragte Bernd Schuster.
„An Ort und Stelle“, erwiderte der Inspektor.
––––––––
16
Die Scheinwerfer fraßen sich beharrlich in das Dunkel der Nacht, sie huschten über weiße Markierungslinien, streiften Bäume, Kilometersteine und Hinweisschilder, der Motor brummte gleichmäßig, weder Carlson noch Beatrice äußerten ein Wort. Es hätte gemütlich sein können, wenn nicht die Angst und die lastende Spannung in Beatrice gewesen wären, die Furcht vor dem Ende.
Sie brach das Schweigen. Sie musste und wollte ein letztes Mal versuchen, den Menschen in Carlson anzusprechen, die Stille war zu viel für sie, sie zehrte an ihren geschundenen Nerven.
„Wie hat es begonnen?“, fragte sie.
Er blickte geradeaus. Der Koffer lag immer noch auf seinen Knien. Er hielt ihn fest, als wäre es ein Rettungsanker.
„Wie hat was begonnen?“, murmelte er.
„Sie wissen schon, Ihr Kampf gegen das Verbrechen“, sagte sie.
„Lesen Sie die Zeitungen“, spottete er. „Da steht es drin, fast täglich – meine Biographie.“
Er siezte sie zwischendurch, das machte ihr noch mehr Angst als das traute Du. Es bewies, dass er auch innerlich begonnen hatte, sich von ihr abzusetzen. Für ihn war sie so gut wie tot.
„Ich frage nicht, was man über Engel zu wissen meint“, erklärte sie, „mich interessiert Friedrich Carlson, der Mensch. Seine Kindheit, seine Eltern, seine Umgebung. Was hat Sie zu dem gemacht, was Sie heute verkörpern?“
„Ich hasse das Verbrechen“, sagte er.
„Das hassen andere auch, aber deshalb gehen sie nicht auf die Straße, um zu töten.“
„Wenn sie es tun würden, herrschte Ordnung in diesem Land, in dieser Stadt“, behauptete er.
„Ich fürchte eher, dann würden Mord und Totschlag dominieren“, meinte sie. „Jeder sieht das Recht auf seine Weise. So geht es einfach nicht, das wäre Anarchie.“
„Ich habe das Morden nicht erfunden“, verteidigte er sich. „Damit haben die anderen begonnen. Ich habe lediglich versucht, diesen Trend zu stoppen. Ich glaube, dass mir dies gelungen ist.“
„Die Presse“, meinte Beatrice, „ist darüber anderer Meinung.“
„Die Presse“, widersprach er wütend, „steht hinter mir. Sie hat es nicht leicht. Sie muss einerseits die Gesetze verteidigen, andererseits weiß und sieht sie genau, wie wichtig es ist, dass Leute meines Formats mit Verbrechen und Verbrechern abrechnen.“
„All das beantwortet nicht meine erste Frage“, sagte Beatrice. „Wie hat es begonnen?“
„Sie wissen es, mit Hass“, sagte er. „Und mit dem Willen, aus Hass Aktion werden zu lassen. Ich hasste nicht nur die Verbrecher, ich hasste auch die Leute, die nur mit Worten, nicht aber mit Taten gegen das Verbrechertum kämpften. Ich wollte ein Beispiel geben, das habe ich geschafft.“
‚An ihn ist nicht heranzukommen‘, dachte sie verzweifelt. ‚Er steckt voller Phrasen, er will mit seinen Rechtfertigungsversuchen davon ablenken, dass er nicht besser ist als jene, die er meint hassen zu müssen – und die ihm doch nur blutrünstige Vorbilder sind.‘
Sie schwieg.
Carlson unternahm keinen Versuch, das Gespräch fortzuführen. Woran dachte er? An das, was sich in der Hütte ereignen sollte? Oder daran, wie er sich von ihr zu trennen beabsichtigte?
Sie benötigten bei dem starken Verkehr einige Zeit, um ihr Ziel zu erreichen. Das kleine, solide Holzhaus lag in einem Talkessel, am Rande des Großen Wannsees, dessen Oberfläche wie polierter Onyx im Sternenlicht glänzte.
Carlson stieg aus. Er öffnete den Koffer und entnahm ihm das Gewehr, den Koffer legte er in den Wagenfond. Beatrice fühlte ein Kribbeln auf ihrer Haut, das Wissen um die Stunde der Entscheidung ließ sie kurzatmig werden.
„Gehen Sie voran“, befahl er.
Beatrice hatte dem Handschuhfach eine Taschenlampe entnommen, sie ließ den Lichtkegel vor sich herwandern, erreichte die hölzerne Tür, tastete zwischen zwei Balken nach dem dort versteckten Schlüssel und führte ihn mit zitternder Hand in das Schloss.
Da war sie wieder, die gemeine, quälende Angst, der Hang zur Kapitulation. Beatrice öffnete die Tür. Die Hütte verfügte über keinen Stromanschluss, aber es gab in einem Anbau ein Dieselaggregat, das bei längeren Aufenthalten Strom für Kühlschrank und Lampen lieferte.
Sie wandte sich um. Sie erklärte Carlson, dass sie das Aggregat nicht zu bedienen wüsste.
„Wir brauchen es nicht“, sagte er und nahm ihr die Lampe aus der Hand. „In wenigen Stunden wird es hell sein. Zieh dich aus.“
„Mir ist kalt“, sagte Beatrice, der es darum ging, Zeit zu gewinnen. Aber was waren fünf oder zehn Minuten, was bedeutete selbst eine dem Schicksal abgetrotzte halbe Stunde? Früher oder später musste sie sich mit dem scheinbar Unausweichlichen abfinden – oder sterben.
Sie setzte sich, sie fühlte sich matt und zerschlagen, aber sie war trotzdem entschlossen zu kämpfen, egal wie.
„Hier“, sagte Carlson und entkorkte die mitgebrachte Flasche. „Das wird dir guttun.“
Sie trank, stoppte aber jäh, als ihr bewusst wurde, wie riskant es war, sich auf diese Weise einlullen zu lassen. Friedrich W. Carlson nahm ihr die Flasche ab und genehmigte sich einen tüchtigen Schluck. Er gab Beatrice die Flasche zurück, legte das Gewehr griffbereit auf den Tisch und nahm stattdessen die Taschenlampe an sich.
Er ließ den hellen Lichtkegel über die Einrichtung huschen. Der kleine Wohnraum war durch einen geöffneten Vorhang vom Schlaftrakt getrennt; auf der anderen Vorhangseite befanden sich zwei Etagenbetten.
„Nicht gerade übermäßig bequem“, spottete Carlson, „aber dieses Manko können wir durch Leidenschaft und Zärtlichkeit wettmachen.“
Beatrice fröstelte. „Ich habe nicht vor, mit Ihnen ein Lager zu teilen“, sagte sie.
Er warf die Lampe auf den Tisch, dann riss er Beatrice mit beiden Händen vom Stuhl hoch. Beatrice wehrte sich, sie versuchte seinem kräftigen, unbarmherzigen Zugriff zu entgehen, aber Carlson war bärenstark, sie konnte sich nicht von ihm lösen.
„Fassen Sie mich nicht an“, keuchte sie. „Aufhören!“
‚Du bist ein Versager‘, warf sie sich vor. ‚Du hättest das Gewehr an dich reißen sollen. Einen Moment lang kehrte der Mörder dir seinen Rücken zu, eine Sekunde lang war er abgelenkt. Du hast diese Chance verschenkt, sie wird vermutlich niemals wiederkommen‘.
Er suchte mit dem Mund nach ihren Lippen, aber Beatrice drehte ihr Gesicht zur Seite, sie trommelte mit den Fäusten gegen seine Brust, sie drehte und wand sich, sie kratzte und trat mit den Füßen nach ihm, aber alles, was sie erreichte, war Carlsons höhnisches Lachen, und, schlimmer noch, ein Anheizen seiner Lust.
„Du kleines, süßes Biest“, sagte er schweratmend, „ich habe dir das Leben gerettet, und du wolltest mich dafür ans Messer liefern. Dafür wirst du bezahlen, mein Wort darauf – erst mit deinem Körper, dann mit deinem Leben!“
Plötzlich hatte sie es geschafft. Sie riss sich los, griff nach dem Gewehr, sprang zurück und richtete den Lauf auf den Mann. Carlson blieb wie betäubt stehen. Es war dunkel in der Hütte, aber seine Augen hatten sich soweit an das diffuse, durch die Fenster einfallende Sternenlicht gewöhnt, dass er Beatrice und das auf ihn gerichtete Gewehr erkennen konnte.
„Lass das“, sagte er. „Was soll der Quatsch?“ Er machte einen Schritt nach vorn, er schob sich auf Beatrice zu.
„Stehenbleiben, oder ich drücke ab!“, warnte sie ihn.
Sie hatte noch niemals ein Gewehr gehandhabt, sie wusste nicht, ob die Waffe entsichert werden musste, und wenn ja, wie, sie wusste nur, dass sie abdrücken würde, wenn er versuchen sollte, sie ein zweites Mal anzugreifen.
„Willst du werden wie ich?“, höhnte er.
„Ich handle in Notwehr!“
„Überlege dir, was du tust“, sagte er und bewegte sich weiter auf sie zu. „Ohne mich wärst du entführt, vielleicht sogar tot. Dieser Gernot Ganz hätte nicht mit sich spaßen lassen. Willst du mir zum Dank für meine Rettungsaktion ein Loch in den Bauch schießen?“
„Ich will nichts dergleichen“, sagte sie. „Aber noch weniger bin ich bereit, mich Ihren absurden Wünschen zu fügen!“
Er lachte, dann setzte er sich erneut in Bewegung. „Du kannst gar nicht schießen“, höhnte er. „Und noch viel weniger kannst du töten. Dazu muss man geboren sein. So wie ich. Töten kann zum Hobby werden, weißt du.“
Beatrice prallte mit dem Rücken gegen die Holzwand. „Stehenbleiben!“, stieß sie hervor.
Der Mann ignorierte ihre Worte, er kam unaufhaltsam auf sie zu, ein drohender Schatten, hinter dem Lüsternheit und Brutalität lauerten.
Beatrice schluckte. Sie schloss die Augen, dann riss sie den Abzug durch. Ein hohles Klicken ertönte. Sie hob die Lider. Der Mann war jetzt dicht vor ihr. Er nahm ihr das Gewehr ab, geradezu behutsam.
„Das“, informierte er sie spöttisch, „ist eine doppelläufige Flinte. Ich habe beide Patronen verschossen – sie töteten Grosser. Dann musste ich dir folgen, ich war praktisch auf der Flucht, mir blieb keine Zeit, die Waffe nachzuladen.“
Er schlug ihr plötzlich mitten ins Gesicht. Tränen schossen in Beatrices Augen. Tränen des Schmerzes, des Zornes und der Verzweiflung.
„Du miese kleine Bestie, du“, sagte er. „Du wolltest mich umlegen, einfach abservieren. was? Ich bin dir dankbar für diese Demonstration deiner Niedertracht, sie macht es mir leicht, mit dir abzurechnen.“
Beatrice gab sich einen Ruck. Mit einer geschickten Körperdrehung stürmte sie an ihm vorbei, auf die Tür zu. Sie rannte ins Freie, als wären tausend Teufel hinter ihr her.
Beatrice glaubte zu wissen, dass sie keine ernsthafte Chance hatte, dem Mörder zu entkommen, er war schneller und beweglicher als sie, aber sie konnte nicht länger in seiner Nähe bleiben, sie musste fliehen und hatte ihm gegenüber immerhin den Vorteil, die Umgebung der Hütte genau zu kennen.
Sie rannte den Weg hinab, der zum See führte und erkannte zu spät, dass das ein Fehler war. Sie hörte hinter sich die Schritte des Mannes, sie kamen rasch näher. ‚Du hättest in den Wald laufen sollen‘, schoss es ihr durch den Kopf. ‚Das Dunkel hätte dich vielleicht gerettet, hier am See kann er dich selbst dann noch sehen, wenn du einen Vorsprung gewinnen solltest‘. Aber an diesen Vorsprung war nicht zu denken, der Mann kam immer näher, er packte plötzlich ihren Arm, er riss sie mit sich zu Boden.
„Bitte nicht ...“, wimmerte Beatrice.
Der Mann hielt sie fest umklammert. Er strich ihr mit einer Hand über die Brüste.
„Du gehörst jetzt mir“, sagte er keuchend. „Erst mir, und dann dem Teufel!“ Er lachte, seine Hand glitt über ihren Körper, er tastete ihn ab, er berauschte sich an dessen Biegsamkeit.
„Ich will dir vorher ein kleines Geständnis machen“, fuhr er fort. „Das Geständnis eines Mörders. Du siehst mich ganz richtig. Ich töte, weil es mir Spaß macht, weil ich es brauche. Der ganze Zirkus um den Engel war nur Tarnung, eine hübsche Verbrämung für mich und die anderen. Es gibt Leute, die töten, um sich zu bereichern. Ich hatte kein solches Motiv. Ich besitze mehr Geld, als ich ausgeben kann. Was tut man als wohlhabender Mann, um seine Mörderinstinkte zu befriedigen?“, höhnte er. „Man weist sich als angeblicher Rächer aus, als Streiter für Recht und Gerechtigkeit.“ Er lachte kurz. „Ich hasse das Verbrechen, stimmt, ich hasse es vor allem deshalb, weil es sich gegen Leute mit meinen Reserven und Brieftaschen richtet. Ich bin ...“
Er unterbrach sich.
Er spürte, dass etwas nicht stimmte, dass irgendeine Veränderung geschehen war, die ihn gefährdete.
Er hatte kein verdächtiges Geräusch gehört und wusste sein Erschrecken nicht zu erklären. Aber da war Beatrice, weshalb wehrte sie sich nicht mehr, warum lag sie geradezu passiv in seinen Armen?
Er warf einen Blick über seine Schulter und sah plötzlich den Schatten über sich, die Konturen eines großen, drohend aussehenden Mannes.
Eine Sekunde lang war Carlson wie paralysiert, dann gab er Beatrice frei, sprang hoch und ließ seine Fäuste fliegen, er musste den jähen Schock durch eine Explosion seiner Kräfte kompensieren, er musste die aufgetauchte Gefahr buchstäblich totschlagen.
Aber er traf kaum, oder nur schlecht, dafür musste er ein paar Schwinger einstecken, die seinen Schwung bremsten und lähmten. Er merkte, dass der Gegner, dessen Gesicht nur als schemenhaftes Oval zu erkennen war, zu kämpfen wusste, und dass er zu wissen schien, wen er vor sich hatte.
Plötzlich traf Carlson ein Schlag ganz anderer Art, eine massive Lichtattacke, die aus gut einem Dutzend starker, greller Scheinwerfer gespeist wurde und in deren Mittelpunkt er sich sah.
Er legte beide Hände vor die Augen. Er fühlte sich gefangen, eingekreist, er war am Ende seines Weges angelangt, er saß in der Falle.
„Sind Sie verletzt?“
Die männliche Stimme galt dem Mädchen. Carlson ließ die Hände sinken und beobachtete blinzelnd, wie der Mann, mit dem der gekämpft hatte, Beatrice Wilde behutsam auf die Beine half.
„Oh, Herr Schuster ...“, hauchte Beatrice.
Sie wurde ohnmächtig, ein Opfer der ausgestandenen Ängste und Spannungen, und sie wäre erneut gefallen, wenn Bernd sie nicht aufgefangen hätte.
Friedrich W. Carlson unternahm keinen Versuch, den Kampf fortzusetzen. Die rings um See und Holzhaus aufgebauten Scheinwerfer machten klar, dass er einer kleinen Armee von Gegnern gegenüberstand.
Ihm fiel der Scheck ein. Beatrices Botschaft. Irgendjemand musste den zerknüllten Scheck aus dem Papierkorb gefischt und alles Weitere veranlasst haben. Carlsons Mundwinkel zuckten bitter. Er hatte sich einen Fehler geleistet, der nicht mehr korrigierbar war.
Schritte kamen näher, ein paar Männer traten in den hellen Lichtkreis. Einen davon kannte Carlson, er hatte ihn wiederholt auf Zeitungsfotos gesehen.
„Hallo, Inspektor“, sagte Carlson und straffte sich wie ein Mann, der zu seinem Vorgesetzten spricht. „Ich bedaure, dass Sie der traurigen Pflicht genügen müssen, mich festzunehmen. Noch mehr werden es die Menschen von West-Berlin bedauern, denn jetzt gibt es keinen mehr, der sie selbstlos gegen das Verbrechen verteidigt.“
„Dumme, haltlose Phrasen“, sagte Bernd. „Ich habe gehört, was Sie über Ihre wahren Motive äußerten. Fräulein Wilde wird es bezeugen können.“
Beatrice kam zu sich, als sie ihren Namen hörte. Sie beobachtete, wie einer der Männer Handschellen um Carlsons Gelenke schnappen ließ und erfasste, dass der größte Alptraum ihres Lebens zu Ende gegangen war.
„Ich will nach Hause“, murmelte sie. „Ich will schlafen, vergessen ...“ Sie hängte sich an Bernds Arm und blickte ihm ins Gesicht. „Bitte, begleiten Sie mich“, sagte sie. „Ich brauche jetzt einen Menschen neben mir, der Ruhe und Vertrauen ausstrahlt und der mir das Gefühl der Geborgenheit gibt ...“
„Kommen Sie“, sagte Bernd und führte sie aus dem hellen Lichtkreis, „ich bringe Sie zu Ihrem Wagen.“
––––––––
17
„Was für ein mieser, schlimmer Tag für alle!“
Bernd Schuster, Franziska, Knut und auch Lucy waren an diesem Spätnachmittag des 4. Novembers in der Detektei versammelt.
„Danke, Dad, dass du mich rechtzeitig da rausgeholt hast!“, sagte Lucy leise und machte ein sehr schuldbewusstes Gesicht.
„Weißt du“, begann Knut, der sonst stets fröhliche Helfer an Bernds Seite, „ich mache mir große Sorgen um die Leute von der APO. Was da heute in Charlottenburg vor dem Landgericht abgegangen ist, hat für mich nichts mehr mit dem Recht auf Demonstrationen zu tun. Das war eine richtige Straßenschlacht mit bürgerkriegsähnlichem Ausmaß.
Die anderen sahen sich schweigend an.
Dieser heutige Tag, an dem der „Fall des Engels“ stattfand, würde nicht als erfolgreicher Tag in die Kriminalgeschichte Berlins eingehen. Vielmehr wurden die Ereignisse von der Schlacht am Tegeler Weg vor dem Landgericht in die Geschichtsbücher eingetragen. Eine Ehrengerichtsverhandlung gegen den Anwalt Horst Mahler wurde von der Außerparlamentarischen Opposition zum Anlass genommen, der Polizei eine blutige Auseinandersetzung zu liefern, die die Bezeichnung der Boulevard-Presse als „Schlacht“ wirklich verdient hatte.
Aufgrund eines Hinweises, den Inspektor Südermann rechtzeitig an Schuster gab, konnten Knut und Franziska rechtzeitig dafür sorgen, dass Lucy und ihre ‚Clique‘ den Platz verließen. Einfach war es für die beiden nicht, sie in der Menge zu finden. Als bereits die Wasserwerfer anrückten und die ersten Steine flogen, schrie Lucy erschrocken auf. Ein Pflasterstein hatte ein Schaufenster in ihrer Nähe getroffen und das Fenster mit einem lauten Knall zerbersten lassen. Der Schrei lenkte Knuts Blick in ihre Richtung, und zu ihr laufen, sie an der Hand packen und den anderen zuzurufen: „Haut ab hier, das wird gleich sehr blutig werden!“ war die Sache von Augenblicken.
Jetzt wartete man nur auf die Ankunft von Lucys Mutter, die mit Bernd abgesprochen hatte, die gemeinsame Tochter für ein paar Tage zu ihr zu nehmen.
Bevor noch jemand wieder das Wort ergriff, öffnete sich die alte Ladentür und Lucy griff ihren gepackten Rucksack.
„Also dann bis später!“, verabschiedete sich die Siebzehnjährige.
Kopfschüttelnd sah ihr Bernd mit besorgter Miene nach.
Die langen, blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden und fielen weit über den gefütterten Parka herunter. Die kurz abgeschnittene Jeans betonte trotz der dicken Strumpfhose die Beine des Mädchens, auch wenn sie wegen der Kälte dazu kniehohe Stiefel trug.
„Komm schon, Bernd, lächle! Wir waren auch mal jung!“, sagte Franziska und klopfte ihm auf die Schulter.
„Ja, waren wir. Aber zu unserer Zeit gab es weder LSD noch diese blöden Demonstrationen, an denen man unbedingt teilnehmen musste“, erwiderte Bernd Schuster und beobachtete, wie seine Tochter winkend in den Wagen ihrer Mutter einstieg.
„Hast du Lust, noch mit zum Spanier rüberzukommen, Knut?“
Knut schüttelte den Kopf.
„Ne, lasst mal! Ihr beide habt ja jetzt sturmfreie Bude, da will ich nicht stören!“
Damit verschwand er auch lachend nach draußen.
Bernd half Franziska in die warm gepolsterte Steppjacke, dann nahm er seine eigene Jacke vom Haken und folgte Franziska auf die Straße.
„Es wird bestimmt ein harter Winter!“, kommentierte er, als beide den kalten Windhauch spürten, der durch ihre Jacken fuhr.
*
Gegen Mitternacht beugte sich die dunkle Gestalt über die Schlafende, von der außer ihren langen Haaren nichts zu erkennen war. Dann streckte er behutsam die Hand nach ihr aus und berührte das Gesicht.
„Was zum...“, erklang eine Stimme, und lächelnd setzte sich der Besucher wieder in den Sessel, in dem er vor wenigen Nächten schon einmal gesessen hatte.
„Wir haben eine Abmachung, Fräulein Markworth!“, sagte er leise, als sich etwas unter der Bettdecke bewegte.
„Eine sehr einseitige, wenn du mich fragst!“, kam die unerwartete Antwort einer dunklen Stimme.
Frank Todd sprang aus dem Sessel, als ihn die kräftige Hand packte.
Obwohl er nicht mit der Anwesenheit Schusters gerechnet hatte, reagierte er blitzschnell. Beide Hände fuhren nach oben und trafen hart auf die Handgelenke, die seinen Mantel gepackt hielten.
Bernd ließ los und musste gleich darauf einem Schlag ausweichen, der noch seinen Wangenknochen erwischte. Dann schlug er rasch zurück, erwischte den Gegner auch, aber Todd schien hart im Nehmen zu sein.
Die angetäuschte Rechte erkannte Bernd rechtzeitig, nicht jedoch die nachfolgende Linke, die ihn hart auf das Ohr traf. Er taumelte zurück, und das genügte dem nächtlichen Besucher. Mit einem Sprung war er auf dem Flur, riss die Wohnungstür auf und lief die Treppen hinunter.
Schon war Bernd Schuster hinter ihm, aber Todd war schneller.
Er sprang immer über mehrere Stufen, schließlich, im unteren Stockwerk, kürzte er mit einem gekonnten Sprung über das Treppengeländer erneut ab und war auf der Straße, als Bernd die Haustür erreichte. Als ein Motor aufheulte, hastete der Privatdetektiv auf die dunkle Limousine zu, aber es war bereits zu spät.
Durchdrehende Reifen, ein Motor, der erbarmungslos hochgezogen wurde, dann jagte das Fahrzeug um die nächste Ecke.
Bernd zerdrückte einen Fluch zwischen den Zähnen und kehrte langsam in die Wohnung zurück, um alles wieder abzuschließen und zu sichern.
Wie es Frank Todd erneut geschafft hatte, auch das Sicherheitsschloss zu überwinden, war ihm noch nicht ganz klar. Aber er war froh, die letzten Nächte in Franziskas Wohnung verbracht zu haben.
‚Ich kriege dich schon noch in die Finger, Todd, keine Frage. Und dann werden wir uns sehr gründlich unterhalten müssen!‘
Erleichtert legte Franziska die Beretta beiseite, als Bernd wieder in die Wohnung trat.
„Ich muss mir wohl eine andere Wohnung suchen!“, sagte Franziska, als sie ihn seine Arme sank.
„Glaube ich nicht, Franzi. Du kannst diese getrost behalten. Vielleicht möchtest du dich ja irgendwann einfach einmal zurückziehen, weil dir vieles auf den Wecker geht. Aber in nächster Zeit schläfst du bei mir. Wie du weißt, hat auch Lucy nichts dagegen!“
Franziska lachte fröhlich auf.
„Ja, das weiß ich ja nun wohl. Und ich halte es für eine vernünftige Entscheidung, dass ich mit ihr gemeinsam zum Frauenarzt gegangen bin.“
Bernd Schuster legte den Kopf schräg und musterte Franziska lächelnd.
„Glaubst du vielleicht, ich möchte mir noch mal die Packung Pariser von ihren Freunden anbieten lassen?“
Beide lachten herzlich, und Bernd streichelte ihr behutsam über den Rücken.
ENDE