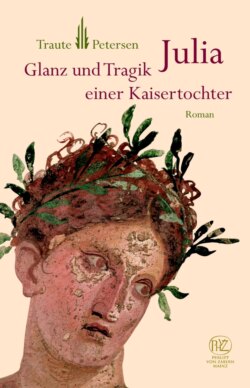Читать книгу Julia - Traute Petersen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Familienpolitik
ОглавлениеMeine enge Verbindung mit Jullus bestand so lange, bis wir unsererseits zu entscheidenden Spielsteinen auf diesem Brett aufrückten. In meinem vierzehnten Lebensjahr heiratete ich auf Anordnung meines Vaters und Octavias meinen Vetter Marcellus. Ich ging diese Ehe ohne eigenen Wunsch, aber auch ohne Abneigung ein. Seit meiner Heirat mischten sich jedoch in die Freundschaft mit Jullus erste erotische Gefühle. Denn Marcellus, diesen schlaksigen, unfertigen Jüngling, betrachtete ich auch nach unserer Heirat nicht anders als zuvor den Spielgefährten der Kindheit: ohne näheres Interesse, mit freundlichem Gleichmut. Den eisernen Ring jedoch, den ich bei der Verlobung erhalten hatte, trug ich mit leidenschaftlichen Hoffnungen – nicht auf die zu erwartenden ehelichen Freuden, sondern auf die Freiheiten, die mir nach dem abgeschlossenen Leben auf dem Palatin durch diese Heirat winkten. Der eiserne Ring versprach mich hinauszuführen aus dem goldenen Käfig. Als Ehefrau würde ich endlich an abendlichen Gastmahlen und Festen teilnehmen, Wein trinken, im Liegen speisen, das Theater besuchen und mich frei von Kontrollen im Haus, in der Stadt und wo immer ich wollte, bewegen. Ungeduldig erwartete ich den Vermählungstag und genoss die Hochzeitsvorbereitungen mit der aufgeregten Eitelkeit einer Vierzehnjährigen. Als ich schließlich die Brautgewänder anlegte und in die roten Sandalen schlüpfte, ließ ich es sogar stolz lächelnd zu, dass Livia mir das viereckige rotgoldene Kopftuch befestigte. Meine Mutter war bei meiner Hochzeit schließlich nicht anwesend.
Wie selbstverständlich nahm ich an, dass ich nun, so wie ich es aus den Versen der Dichter kannte, aus der väterlichen Gewalt in die des Ehemanns wechseln würde. In diesem Irrtum wurde ich dadurch noch bestärkt, dass mein Vater wieder einmal irgendwo in Gallien oder Spanien Krieg führte und deshalb an der Feier nicht teilnahm. In seinem Auftrag und an seiner Stelle leitete sein alter Freund und Kampfgefährte Agrippa die Zeremonie. Als er nach dem obligaten Widderopfer hinter Marcellus und mich trat und unser goldbandverschlungenes Händepaar unter lautem Beifall emporhob, erfasste mich ein leises Zittern – in diesem Moment öffnete sich für mich das Tor zur Freiheit. Hätte ich damals einen Blick in die Zukunft werfen können, hätte ich vielleicht auch gezittert, aber aus anderen Gründen. Und hätte ich schon damals gewusst, dass Agrippa, dieser narbenübersäte Haudegen, der da den Brautvater spielte, schon wenig später ebenso wie jetzt Marcellus seine Hand mit meiner Hand verschlingen würde, ich hätte ob dieser absurden Konstellation wahrscheinlich nur mühsam ein ungläubiges Lächeln verbergen können.
Ich hatte nicht in Rechnung gestellt, dass mit mir die einzige Tochter des Alleinherrschers verheiratet wurde. Die Tür des goldenen Käfigs schien sich zwar einen Spalt weit geöffnet zu haben. Aber der eiserne Verlobungsring war nicht das Zeichen der Freiheit, sondern einer verstärkten Gefangenschaft im kaiserlichen Haus. Nicht nur bei dieser Heirat mit einem Siebzehnjährigen, auch bei den zwei folgenden Eheschließungen mit kriegserfahrenen, bewährten Mittdreißigern oder -vierzigern entließ mich mein Vater mitnichten aus seiner Hand in die Hand des Ehemanns, wie es so schön heißt. Er hat mich bis heute in seiner Hand.
Ich blieb die Kaisertochter, die durch diese Heirat ihrem Ehemann den ersten Platz in der Reihe der künftigen Nachfolger eröffnete. Als Marcellus mich nach der Vermählungsfeier im Schein der Fackeln und unter lautem Jubel und anzüglichen Gesängen über die Schwelle des Hauses trug, in dem unser gemeinsames Leben beginnen sollte, war dies nicht sein Haus, sondern dasselbe Haus, in dem wir beide seit Kindertagen aufgewachsen waren und wo auch Jullus weiterhin bis zu seiner Heirat mit Marcella wohnte. Wir alle blieben Mitglieder der großen Hausgemeinschaft auf dem Palatin. Marcellus und ich bewohnten einen zwar abgeschiedenen, aber nicht abgeschlossenen Seitenflügel, der von meinem Vater, wenn er in Rom weilte, und von Livia jederzeit unangemeldet besucht werden konnte und besucht wurde. Dass sie diese Möglichkeit im Zusammenhang mit Marcellus’ frühem Tod nutzte, scheint mir inzwischen höchst wahrscheinlich.
Auch heute noch frage ich mich, was genau mein Vater mit dieser Ehe bezweckte. Offenbar wollte er vor allem sicherstellen, dass seine einzige Tochter, gewissermaßen der familiäre Schlüssel zur Macht, in die richtigen Hände gegeben wurde. Im Hinblick auf Marcellus aber hätte es dieser Heirat eigentlich gar nicht bedurft, um ihm den Vorzugsplatz in der geplanten Nachfolgeregelung zu verschaffen.
Mein Vater hatte nämlich Marcellus, den einzigen Sohn seiner Schwester Octavia und einzigen männlichen Nachkommen der julischen Familie, von Anfang an öffentlich ausgezeichnet. Bereits bei jenem unvergesslichen Triumphzug, mit dem er seinen Sieg über Antonius und Kleopatra feierte, hatte er den damals Dreizehnjährigen rechts neben seinem Triumphwagen reiten lassen, während sich der gleichaltrige, ungeliebte Stiefsohn Tiberius mit der linken Seite begnügen musste und Jullus unter den Zuschauern neben mir Platz zu nehmen hatte. Es folgten weitere außergewöhnliche Ehrungen für Marcellus, am erstaunlichsten wohl die Erlaubnis, sich bereits zehn Jahre vor der Zeit um das Konsulat zu bewerben. Das hieß nach der neuen Gesetzgebung, bereits mit dreiundzwanzig Jahren das höchste Staatsamt zu bekleiden, das in den Zeiten der Republik aus guten Gründen nur verdienten Männern anvertraut worden war, die die Vierzig überschritten hatten. Diese demonstrative Auszeichnung des noch nicht einmal Zwanzigjährigen erscheint mir inzwischen doppelt unverständlich, weil mein Vater heute mit seinen Adoptivsöhnen Gaius und Lucius gerade in diesem Punkt sehr zurückhaltend und vorsichtig verfährt. Damals waren diese Ehrungen für Marcellus aber noch auffälliger, weil gleichzeitig auch Tiberius bestimmte Privilegien erhielt, die aber immer deutlichen Abstand zu denjenigen von Marcellus wahrten.
Jullus, der stets an dritter Stelle hinter Marcellus und Tiberius genannt wurde, wenn es um die Nachfolge im Kaiserhaus ging, hielt sich völlig zurück und kommentierte die Vorgänge unter vier Augen mit ironischen Prognosen, die sich im Folgenden auf traurige Weise bestätigen sollten. Tiberius aber reagierte zunehmend mürrisch auf Marcellus’ Privilegien, was mich zu halb spöttischen, halb mitleidigen Scherzen veranlasste, die wiederum Tiberius’ Empfindlichkeit vertieften und meinen Stolz als Ehefrau des öffentlich bevorzugten Marcellus erhöhten.
Dieser Stolz war, rückschauend betrachtet, die einzig angenehme Erfahrung meiner kurzen Ehe. Marcellus und ich führten diese Ehe pflichtgemäß. Wir hatten beide schon als Kinder zu Verlobungen im Zusammenhang mit irgendwelchen politischen Zweckbündnissen herhalten müssen und fügten uns nun in unsere neuen Rollen. Wir waren beide unerfahren. In der vorgegebenen Hausordnung fehlte der erotische Reiz, der das neue Rollenspiel hätte schmackhaft machen können – der sich aber bei meinen heimlichen Treffen mit Jullus nun umso lebhafter entfaltete. Es war nicht zuletzt das Verbotene, das uns reizte. Jeden unbeobachteten Moment, jede Säule, jede Statue, die uns vor unerwünschten Blicken Schutz bot, nutzten wir für atemlose, gierige Umarmungen und heftige Küsse.
Heute glaube ich, dass ich solche Momente wohl leidenschaftlicher genossen habe als Jullus. Er suchte wohl nicht zuletzt auch die Befriedigung, von der Kaisertochter so deutlich ausgezeichnet zu werden.
Ist es nicht seltsam, dass mir bei diesen Erinnerungen an Jullus sein damaliges Verhalten in einem zunehmend diffusen Licht erscheint? Oder ist es die Verbitterung hier auf Pandateria, die selbst die glücklichen Erinnerungen verdunkelt?
***
Heute konnte ich zum ersten Mal nach langen Regenwochen wieder einen Gang über die Insel wagen. Nichts blüht, aber die Luft ist weich und mild und tut gut. Sofort regen sich neue Hoffnungen und Sehnsüchte: nach Rom, nach meinen Kindern, nach meinen Freunden, nach sinnvoller Tätigkeit. Und mit den Sehnsüchten wachsen unvernünftige Hoffnungen auf ein Ende meiner Verbannung, auf ein Wort meines Vaters, auf die Möglichkeit, mich zu rechtfertigen.
Bei dieser plötzlich glatten See könnte Phylax seine Fahrten ohne Schwierigkeiten wieder aufnehmen. Ich brenne auf Neuigkeiten aus Rom.
Aber kein Schiff zeigt sich auf der sonst so befahrenen Wasserstraße zwischen Insel und Festland.
***
Untätigkeit war mir immer zuwider, aber erzwungene Untätigkeit ist unerträglich. Doch was heißt: „unerträglich“? Auch das schriftliche Festhalten von Erinnerungen bedeutet Tätigkeit.
Marcellus starb gut zwei Jahre nach unserer Hochzeit. Meine Trauer hielt sich nicht nur aus den erwähnten Gründen in Grenzen. Dafür sorgten auch die dramatischen Ereignisse in seinem Todesjahr.
Mein Vater war nach langer Abwesenheit nach Rom zurückgekehrt, entkräftet von den Strapazen der Kriege in Gallien und Spanien, trotz seiner vierzig Jahre eher einem sechzigjährigen Greis ähnelnd. Nie zuvor hatte ich ihn so matt und müde erlebt. Die Erschöpfung in den harten Kämpfen gegen die kantabrischen Bergvölker hatte ihn bereits in Spanien gezwungen, die Kriegführung seinen Legaten zu überlassen, während er in den warmen Bädern der Pyrenäen Heilung suchte. Vergeblich, wie sich bei seiner Ankunft in Rom zeigte. Es gelang ihm zwar noch, die Verschwörung seines Mitkonsuls Murena zu überstehen, indem er ihn, einen der höchsten Staatsbeamten, zum Entsetzen Roms kurzerhand hinrichten ließ.
Aber diese Verschwörung war nur ein erster Vorbote des Widerstands, der sich inzwischen gegen seinen selbstherrlichen Regierungsstil formiert hatte. Ich beobachtete beunruhigt die bösen Bemerkungen, die auch im Kaiserhaus selbst zunächst verstohlen, schon bald aber (angesichts der Ehrungen, mit denen er Marcellus als künftigen Erben aufbaute) auch ganz offen geäußert wurden. Diese kritischen Stimmen gehörten einer seltsamen Allianz, die Livia, Agrippa, Jullus und Tiberius gebildet hatten. Vor allem Jullus begann damals neben dem immer wieder gedemütigten Tiberius unauffällig seine Chancen wahrzunehmen. Schon kursierte das Gerücht, mein Vater werde Marcellus adoptieren, so wie Gaius Julius Caesar seinerzeit ihn adoptiert hatte, als er so alt gewesen war wie Marcellus jetzt.
Ganz unverhohlen erregte sich Agrippa, der alte Studienfreund und Kampfgefährte meines Vaters. In der ihm eigenen Geradlinigkeit und Direktheit zieh er meinen Vater vor unser aller Ohren der Unverantwortlichkeit: Ein unbedarfter, unerfahrener Jüngling von neunzehn Jahren werde hier in eine Rolle gedrängt, die ihn völlig überfordere.
Mein Vater gab leise zurück: „Muss ich dich daran erinnern, dass nicht nur ich, sondern auch du selbst in eben diesem Alter unsere politischen Karrieren begonnen haben?“
Aber nun brach es erst recht aus Agrippa heraus. Laut schalt er die „unvernünftige Torheit“, mit der mein Vater die Fassade der wiederhergestellten Republik, die er bisher so erfolgreich verteidigt habe, nun niederreißen wolle – um der dynastischen Erbfolge willen: „Deine Herrschaft haben Senat und Volk dir, aber nur dir verliehen, und zwar aufgrund deiner großen Leistungen und Verdienste. Sie kann nicht vererbt werden. Wenn du aber bereits jetzt nach möglichen Nachfolgern Ausschau halten willst, so richte wenigstens deinen Blick nicht auf diejenigen, die dir blutsmäßig am nächsten stehen, sondern auf diejenigen, die sich durch Leistung empfehlen.“
Diese Kampfrede war wohl nicht ganz frei von gekränktem Ehrgefühl. Jedenfalls verließ Agrippa nach diesem Auftritt ohne weitere Worte die Stadt. Einige behaupten: aus enttäuschtem Ehrgeiz. Es hieß aber, er werde sich auf Lesbos geheimen diplomatischen Missionen im Osten widmen.
Auch Livia hatte, was sonst kaum je geschah, an Agrippas Seite Partei gegen meinen Vater ergriffen – aber natürlich aus ganz anderen Gründen. Marcellus’ Bevorzugung vor Tiberius war ihr schon lange ein Dorn im Auge. Jullus hatte, scheinbar gleichgültig, geschwiegen, aber unter gesenkten Lidern keinen der Anwesenden aus den Augen gelassen. Ich dagegen fühlte mich hin- und hergerissen. Einerseits lockte der Glanz, der von den Auszeichnungen des jungen Ehemanns auch auf mich fallen würde. Andererseits war mir klar, was diese Auszeichnungen für Jullus’ Pläne bedeuten mussten.
Angesichts der immer unverhohleneren Kritik versagten die ohnehin erschöpften Kräfte meines Vaters. Bald erkrankte er so schwer, dass wir alle mit seinem Tod rechneten. Er ließ die wichtigsten Magistrate und Senatoren an sein Bett rufen. Auch Agrippa eilte aus dem Osten herbei. Da mein Vater nicht mehr sprechen konnte, überreichte er seinem Mitkonsul Calpurnius Piso stumm eine Liste der Staatseinkünfte sowie ein Verzeichnis aller in den Provinzen stationierten Truppen. Dann zog er langsam und feierlich mit einem tiefen Atemzug, der einem Seufzer glich, den Sphinx-Ring vom Finger, mit dem er seine Briefe, schriftlichen Befehle und Anordnungen siegelte: das Zeichen seiner Herrschaft. In der atemlosen Stille winkte mein Vater Agrippa mit den Augen heran und reichte ihm den Siegelring. Nicht Marcellus, der jugendliche Neffe, sondern Agrippa, der kriegserprobte und hochgeachtete alte Kampfgefährte sollte nach dem Tod des Prinzeps dessen Aufgaben und Pflichten übernehmen. Agrippa nickte zweimal und trat zurück. In seinem sonst eher trotzig-entschlossenen Gesicht schienen sich Teilnahme, Respekt, Beruhigung und Befriedigung auf seltsame Weise zu mischen.
Sofort suchten meine Blicke Livia. Was ging hinter dieser glatten Stirn vor? Bedeutete für sie der Auftrag an Agrippa den Sieg über Marcellus und einen Aufschub ihrer Pläne für Tiberius? Blickte sie auf das Ende ihrer fünfzehnjährigen Ehe mit Gefasstheit? Mit Trauer? Empfand sie Schmerz am Sterbebett ihres Mannes? In ihren feinen Gesichtszügen war eine gewisse Bewegung unverkennbar. Aber sie blieb undurchschaubar und rätselhaft.
Mir brachte diese Stunde am Bett meines Vaters die Erkenntnis, dass ich meinen Vater, diesen entkräfteten Mann, der trotz seiner Schwäche dem Tod so besonnen und nüchtern entgegenging, trotz aller Spannungen und Differenzen nach wie vor liebte. Ich war deshalb wohl eine der wenigen, die ihre Freude unverhüllt äußerten, als die eisigen Trinkkuren und Bäder, die der Arzt Antonius Musa schließlich allen Bedenklichkeiten zum Trotz durchgesetzt hatte, den Todkranken unerwartet genesen ließen. Wenige Wochen, nachdem Rom sich bereits auf pompöse Trauerfeierlichkeiten vorbereitet hatte, konnte mein Vater seine gewohnte Arbeit wieder aufnehmen. Aber der sonst so gesunde Marcellus erkrankte um eben diese Zeit, und dieselben Kuren desselben Arztes schlugen bei Marcellus nicht an. Noch bevor das Jahr zu Ende war, wurde ich, gerade sechzehn geworden, Witwe.
Für Jullus stand von Anfang an fest, dass Livia bei diesem unerwarteten Tod ihre Hand im Spiel gehabt hatte. Sie hatte jederzeit unbemerkt an Marcellus’ Krankenlager treten und mit wenigen Schritten wieder ihre Privatgemächer erreichen können. Aber da damals eine furchtbare Epidemie in Rom und Italien wütete, die zahlreiche Opfer forderte, wies ich Jullus’ Verdächtigungen zunächst entrüstet zurück. Stutzig wurde ich erst Wochen später an einem scheinbar harmlosen Lektüreabend im kaiserlichen Haus.
Mein Vater nahm lebhaften Anteil an der Entstehung von Vergils „Aeneis“ (des „Staats-Opus“, wie wir spotteten) und liebte es, sich vom Dichter höchstpersönlich die jeweils neu entstandenen Verse vorlesen zu lassen. An jenem Abend bestand der Kreis der Zuhörer nur aus meinem Vater, Livia, Octavia und mir. Die beiden alten Freunde meines Vaters fehlten: Agrippa, der mit der Dichtkunst ohnehin seine Schwierigkeiten hatte, war wieder auf Lesbos, und Maecenas, der Entdecker und Förderer Vergils, hatte sich wegen Krankheit entschuldigen lassen. Zwar kann ich auch heute mit Vergils Pathos wenig anfangen. Aber damals hatte er angekündigt, dass er seinen Helden nunmehr in die Unterwelt hinabsteigen lassen werde, wo dieser Antwort auf die Frage nach Roms künftigem Schicksal erhalten werde. Der bäuerlich-realistische Agrippa hätte solche Visionen als „Phantasterei“ abgetan; aber das, was sich dann an jenem Abend abspielte, war alles andere: Hinter der poetisch vergoldeten Fassade der göttlichen Sendung unseres Urahns Aeneas – sprich: dessen Urenkels Augustus – öffneten sich plötzlich Abgründe. Als Vergil schilderte, wie Aeneas unter den Toten im Hades auch den kürzlich verstorbenen Marcellus erblickt, als er in wohltönenden Hexametern die Schönheit des Frühvollendeten pries, brach Octavia zusammen. Erst schluchzte sie kurz und heftig, dann gurgelte sie unverständliche Satzfetzen und abgerissene Anklagen, schließlich verstummte sie und fiel in eine totenähnliche Starre.
Octavia hat von da an in den zwölf Jahren bis zu ihrem Tod nicht mehr gelacht, nur noch Trauergewänder getragen, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt und den Kontakt zu ihrem Bruder abgebrochen. Octavia hatte manche schweren Verluste erlebt, ihren ersten Mann, den sie schätzte, beerdigt und ihren zweiten Mann, Antonius, den sie liebte, an Kleopatra verloren, ohne sein fernes Grabmal schmücken zu können. Vergeblich hatte sie versucht, ihren Bruder Octavian, den sie bedingungslos unterstützte, mit Antonius, den sie bedingungslos liebte, zu versöhnen – nur um am Ende mitzuerleben, wie ihr Bruder ihren Mann in den Selbstmord trieb. Aber all diese kummervollen Erlebnisse hatten es nicht vermocht, sie in ihrer lebensbejahenden, versöhnlichen Haltung zu beirren. Marcellus’ Tod lag nun schon Monate zurück, und sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt ihren Schmerz in den üblichen Formen gezügelt.
Als ich Jullus von dieser Szene berichtete, erschrak er mindestens genauso sehr wie ich zuvor. Dann erinnerten wir uns an seinen früher geäußerten Verdacht. Wir einigten uns auf die Vermutung, dass Octavia in jenem Moment eine Ahnung überfallen haben musste, die den plötzlichen Tod ihres Sohnes erklären konnte. Hatte Livia, hingegeben an den Wohlklang der Verse, sich vielleicht eine kleine Pause in ihrer sonst so meisterhaften Beherrschung gegönnt? Hatte sie vielleicht während Vergils Vortrag durch eine unwillkürliche Geste oder Bewegung der Augen etwas erkennen lassen, das Octavia wie eine blitzartige Erkenntnis getroffen hatte?
Natürlich ließen sich die Hintergründe dieser Szene nie klären. Aber der Verdacht, Livia habe im Zusammenhang mit Marcellus’ Tod Schicksal gespielt, erhielt mehr als zehn Jahre später neue Nahrung – angesichts der Umstände, die zum Tod des kleinen Nero führten, des einzigen Kindes, das ich mit Tiberius hatte.
Marcellus wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und unter höchsten Ehren als Erster unseres Geschlechts in dem gewaltigen Mausoleum beigesetzt, das mein Vater schon früh unweit des Tiberufers hatte errichten lassen. An den leidenschaftlichen öffentlichen Trauerbezeugungen beteiligte ich mich nicht. Dafür war mir Marcellus zu fremd geblieben. Aber ich teilte den Schmerz Octavias über den Verlust ihres einzigen Sohnes. Ich trat mit der Aschenurne in das Dunkel des Mausoleums in dem tröstlichen Bewusstsein: hier werde auch ich einmal meine Ruhe finden.
Das Theater, das dann erbaut wurde, um das Andenken an Marcellus zu wahren, und das seinen Namen trägt, habe ich später immer gern besucht – nicht zuletzt, weil sich dort meist freundliche Erinnerungen an den viel zu früh Verstorbenen einstellten, die die düsteren Bilder seines Todesjahrs vorerst zurückdrängten.
***
Während dieser letzten Wochen, die ich vor allem mit Schreiben verbringe, warte ich mit wachsender Ungeduld auf Nachrichten aus Rom und Baiae. Da ich Vinicius’ Zuverlässigkeit kenne, stört die Ungewissheit über die Gründe seines Schweigens die Konzentration, die ich zum Schreiben so dringend brauche. Die Tage vergehen mit Warten, vergeblichem Warten.
Warten – ein Wort der Tätigkeit, das Untätigkeit bedeutet.