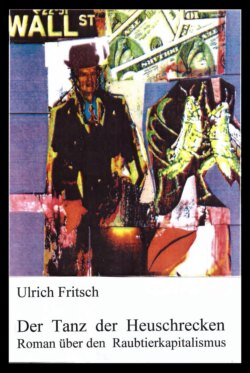Читать книгу Der Tanz der Heuschrecken - Ulrich Fritsch - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеLeon Petrollkowicz war schon auch ein Verehrer des anderen Geschlechts. Wenn er auf der Königsallee in Düsseldorf den mehr oder weniger betuchten jungen Damen an den warmen Sommertagen einen frivolen Gedanken zuwarf, wenn er an der Universität von Nischnij Nowgorod mit hübschen Russinnen parlierte, wenn er am Strand von St.Tropez mit den wunderschönen Evas baden ging, dann tauchte er zu gerne in den Wonnen der Weiblichkeit unter, dann verehrte er für viele Augenblicke das andere Geschlecht mehr als sich selbst, dann hätte er ganz in Nächstenliebe aufgehen können.
Aber im Grundsätzlichen fiel sein Urteil über das andere Geschlecht ganz anders aus. Auch Frauen sind Menschen, sagte er öfters, und meinte das gar nicht so unernst. Zwar hielt er sich gerne an die positiven Seiten einer Beziehung, doch wenn es zu Störungen kam, dann sah er sehr schnell typisch weibliche Eigenschaften als die wahren Ursachen an. Er reflektierte dann gerne die Urteile gescheiter Männer und zitierte Strindberg, Nietzsche, Schopenhauer, Wedekind oder Weininger, die schon manchmal auch Unfreundliches über die Frauen gesagt hatten. Nach seiner unmaßgeblichen Meinung, wie er bescheiden zugab, habe die Frau nur ein Bestreben, durch einen Mann glücklich zu werden, ihn zu lieben, ihn zu bewundern und ihn als Vorbild zu nehmen. Er selbst sei schon bereit, den Frauen dabei zu helfen, müsse sich dann aber an dem spezifisch Weiblichen reiben, an der Unberechenbarkeit, an der Unlogik, an der diffusen Gefühlswelt, kurzum, seine Männlichkeit erlaube es ihm nur bis zu einem bestimmten Grade, sich mit dem anderen Geschlecht auseinanderzusetzen. Ihm reichten schon die vielen kleinen, für ihn typisch weiblichen Randerscheinungen des Alltags. Da war seine Lebensgefährtin Anna. Wenn er mit ihr ausging, musste er in aller Regel spätestens an der dritten Querstraße umkehren, weil der Herd oder das Bügeleisen vielleicht nicht ausgeschaltet waren. Sobald sie in den oder aus dem Wagen stieg, fiel in der Regel ein Gegenstand auf die Straße, der sich nicht so leicht wiederfinden ließ. Und dann die Lust auf Äußerlichkeit: Auch wenn es noch so kalt war, wurde nur das Notwendigste angezogen, weil sich die unerträgliche Leichtigkeit des Seins auch in der Kleidung widerspiegeln musste.
Leon Petrollkowicz monierte aber auch zu Hause viele Kleinigkeiten. Wenn er früh aufstand, zog er als Erstes alle Rollläden hoch. Unterhalb eines Rollladengurtes war ein Tischchen, auf dem eine wackelige Stele in Form eines filigranen schwarzen Körpers stand – der Geniestreich einer Künstlerin. Wenn man auch nur an dem magersüchtigen Mamelucken vorbeihauchte, flog er herunter. In den anderen Zimmern standen Blumen, auch Kakteen, oft gerade da, wo man ständig entlang gehen musste. Manchmal flog eine Vase um, manchmal fuhr ein Kaktus seine Stacheln aus. Selbst auf der Toilette stand vor dem Fenster noch eine wohlriechende Blume. Wenn man lüften wollte, musste man sich erst sehr umständlich von dem sperrigen Duftspender befreien. Im Gang neben dem Telefon stand eine Tischlampe mit einem viel zu großen Schirm. Wenn man zum Telefon raste, fiel nicht selten die Lampe herunter. Im Laufe der Zeit nahm der Leuchtkörper bizarre Formen an. Aber warum sich wegen dieser Bagatellen den Kopf zerbrechen. An solche, aus männlicher Sicht nicht immer verständliche Unebenheiten auf der Oberfläche des häuslichen Sperrguts gewöhnt man sich im Laufe der Jahre. Warum sich beklagen?
„Sehr richtig, Leon Petrollkowicz“, pflichtete ihm einer seiner gescheiten Freunde bei. „Die Frauen wollen es sich und uns doch nur schön machen. Das Funktionale steht dabei nicht immer im Vordergrund. Meine Frau hatte zum Beispiel auf ihrer Kommode im Schlafzimmer neunundneunzig Parfümflaschen stehen. Bei der hundertsten knallte der Champagnerkorken. Wann würde ich sonst jemals im Schlafzimmer ein solch prickelndes Erlebnis haben?“ „Es gibt“, so sagte er dann weiter zu Leon, „nicht nur unsere Sicht der Dinge, auch wenn nur diese uns plausibel erscheint. Liebe heißt, dem Weiblichen nicht immer gleich den Stempel unseres Verständnisses aufdrücken zu wollen. Selbst in der Quantenmechanik, die auf der Unschärferelation beruht“, sagte der Freund zu Leon und entschuldigte sich für den weit hergeholten Vergleich, „kommt man neuerdings zu ganz verblüffenden Erkenntnissen. Jahrzehntelang war man davon überzeugt, dass die kleinsten aller Teilchen genau definierbare Positionen und Geschwindigkeiten einnehmen. Aber selbst Einstein irrte hier. Bei einem bestimmten System mit gleichen Anfangsbedingungen erhält man bei der gleichen Messung einmal das Ergebnis A, einmal das Ergebnis B. War Gott ein weibliches Wesen, das ein Element der Unvorhersagbarkeit oder Zufälligkeit in unsere Welt einführte? Ist es nicht verblüffend, dass Wellen auf Wellen nicht zu stärkeren Wellen führen müssen, sondern dass sich diese Wellen auch gegenseitig aufheben können? Dieses Phänomen der Interferenz haben wir auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wir meinen, alles kann nur in einer bestimmten Richtung definiert werden, wobei manchmal genau das Gegenteil ebenso richtig oder zumindest anders ist, als wir glauben annehmen zu müssen.“ Der Freund von Leon war sehr schlau.
Leon Petrollkowicz überlegte. Dieser Mensch kam mit Vergleichen an, mit denen er wenig anfangen konnte. Er wollte gerne auf jede Unschärferelation verzichten, wenn er an das Weibliche dachte. Aber warum alle diese Überlegungen? Warum musste er sich permanent mit diesem Thema auseinandersetzen?
Leon Petrollkowicz hatte ein Problem. Er liebte Frauen, aber er litt auch unter ihnen. Am schlimmsten erging es ihm in seiner Firma. Er hatte öfters Meinungsverschiedenheiten mit einer erst kürzlich eingestellten Geschäftsführerin, die ihm, dem Inhaber eines mittelständischen Unternehmens für Public Relations und Marketing mit dem Firmennamen „Public Petrollcowicz“, an manchen Tagen das Leben schwer erträglich machte. So auch heute wieder. Er war mit dieser Frau wieder einmal aneinander geraten und hatte deshalb schon etwas vor seiner üblichen Mittagspause fluchtartig das Büro verlassen. Bei dem Versuch, sich in den Straßen von Düsseldorf abzulenken, ließ er sich nicht nur von den Schaufenstern in den Einkaufsstraßen beleben, sondern auch von kleinen Begebenheiten und Zwischenfällen, von dem Treiben in den Straßencafés und vom Flair des bunten Völkchens auf den Bürgersteigen. Immer, wenn er beruflichen Ärger hatte, suchte er im städtischen Treiben Zerstreuung: Manchmal spielte irgendeine Straßenband, suchte die Heilsarmee nach Gutgläubigen, versuchte sich ein Pantomime in der Körpersprache oder warf ihm ein weibliches Wesen einen freundlichen Blick zu. Endlich die Kehrseite des manchmal so tristen Umgangs mit dem anderen Geschlecht. Auf der Königsallee, der Prachtstraße von Düsseldorf, konnte er den Duft, die Schönheit, die Grazie, die Erotik der Frauen genießen, vielleicht nur deshalb, weil er keinen unmittelbaren Kontakt mit ihnen hatte. Je unverbindlicher der Umgang mit ihnen, umso leichter trieb es seine Gedanken in luftige Höhen, wo er endlich nachempfinden konnte, warum Geschichtsschreiber, Poeten, Minnesänger oder Marktschreier dem weiblichen Geschlecht auf jeweils ihre Weise huldigten. Leon Petrollkowicz war kein Historiker und kein Homme de lettres, aber er las gelegentlich die neuen und alten Klassiker und verharrte immer dann, wenn es um das besondere Rollenbild der Frau ging. Sie war seit einer Ewigkeit Göttin und Preis für alles. Schon im ersten Gesang der Ilias erscheint das Weib als Belohnung für den Sieger im Spiel oder im Krieg. Nur der Mutigste und Geschickteste erhielt als höchsten Lohn die Schönste. Heute ist man in den Preisen wesentlich prosaischer. Geld, viel Geld für ein gewonnenes sportliches Event oder für ein paar richtige Antworten im Fernsehen.
Wie anders war es doch in den glanzvollsten Epochen der früheren europäischen Geschichte. Aber natürlich wurde nicht jede Frau auf den Schild des Ritters gehoben, sondern nur das bezaubernde Wesen, das in den Träumen der Männerwelt eine größere Realität besaß als in den stickigen Spinnstuben des Alltags. In Chateaubriands „Martyrs“ wird von einem Feldherrn erzählt, der sich dem Flimmermeer der Sterne hingibt und plötzlich von einem goldenen Etwas geblendet wird, einer Priesterin, die ihn mit langem blonden Haar umwallt – Veleda, die edle Druidin. „Weißt du“, fragt sie den edlen Ritter, „dass ich eine Fee bin?“ „Eine richtige Fee?“, fragt dieser. Sieh an, sagte Leon Petrollkowicz zu sich, obgleich eine Fee höchstens in Gedanken oder virtuell vor uns stehen kann, erscheint sie dem Helden als reales Wesen. Phantasien können so stark sein, dass sie uns wirklich erscheinen und plötzlich die manchmal so raue Wirklichkeit erträglicher machen.
Leon Petrollkowicz träumte und verwob diese Gedanken mit den Eindrücken des Augenblicks. Die Boulevards erschienen ihm wie ein Glacis vor monumentalen Einkaufsburgen, aus denen pappmascheegeformte Glamourgirls und Dressmen ihre Arme durch die Schaufenster streckten, um den Kunden in ein Paradies von käuflichen Großartigkeiten zu locken. Oft erlag er den Verführern, manchmal schenkte er ihnen kauflüsterne Blicke, jetzt aber zeigte er sich standhaft, weil ihn ein Knurren in der Magengrube nur in eine Richtung drängte. Er ging wie immer zu einer kleinen Imbissbude gegenüber einem Kaufhaus in der Schadowstraße. Schon von weitem sah er die lange Schlange der Hungrigen, die in aller Regel nicht nach einer Bratwurst anstanden, sondern nach einer großen Folienkartoffel mit Quark. Man bekam diese Köstlichkeit in einen facionierten Pappkarton eingepackt, um dann entweder an einem der kleinen Stehtische oder an einem anderen Ort mit einer Plastikgabel und einem Plastikmesser zur Tat zu schreiten. Leon Petrollkowicz reihte sich in die Schlange der Wartenden ein. Er nutzte immer diese zehn oder fünfzehn Minuten, um seine Studien vor Ort zu treiben, die er manchmal, wenn es um Alltagssituationen ging, in eine PR-Kampagne oder in ein Marketingkonzept einarbeiten konnte. Man musste, dies war seine Devise, dem Mann beziehungsweise der Frau auf der Straße aufs Maul schauen, um die Massen wirkungsvoll zu beeinflussen. Da standen Männer, die es gewöhnt waren, auf irgendetwas zu warten: auf die Frau ihres Lebens, auf das Grün an der Ampel, auf die Kündigung oder einfach, wie jetzt, nur auf eine Folienkartoffel vor einer Imbissbude. Die Mienen dieser Männer waren wie versteinert. Sie konnten auch in ihrer Mittagspause nicht entspannen, weil sich ein Korsett der Zwänge um ihre Seele presste: Der Zwang im Büro zu parieren, an der Werkbank den Hobel richtig anzusetzen, nach der Arbeit die Wäsche in den Trockner zu schmeißen und am Freitag immer wieder den Lottoschein abgeben zu müssen.
Anders die Frauen in der Schlange der Hungrigen: Sie warteten nur darauf, sich dem anderen mitzuteilen. Ihre Äuglein gingen hin und her, und wenn Frau Pullemuck zur Frau Salehupf nur ein kleines „na denn“ sagte, reichte dies im Allgemeinen, um eine Lawine an Worten loszutreten. Es ging dann um das Wetter, um ein von der Mutter gescholtenes Kind, um die Abgase von Autos oder um die gentechnische Erzeugung von Kartoffeln. Leon Petrollkowicz fiel auch diesmal wieder auf, dass sich das Geplätscher der Weiberstimmen mit dem Gemurmel einer alten Türkin mischte, die tagein tagaus bettelnd neben dem Haupteingang eines Kaufhauses saß und ihre verkrüppelte Hand den Passanten entgegenstreckte. Diese Monotonie des Wartens hatte wenig Erbauliches. Straßenbahnen, Autos, Einkaufstüten, streunende Hunde, kauende Schnellimbisskunden.
Dann aber geschah es: Von weitem näherte sich ein bildhübsches Wesen. Es tauchte aus einem Pulk einkaufswütiger Menschen auf und näherte sich etwas schweren Fußes dem Kartoffelstand. Wie Leon Petrollkowicz mit Kennerblick sofort feststellte, störten die zu hoch geratenen Plateausohlen die ansonsten anmutige Vorwärtsbewegung. Im Übrigen war die Erscheinung makellos: Langes blondes Haar, ein fein geschnittenes Gesicht, ein hübscher, mittelgroßer Busen und eben plateauabsatzverlängerte schlanke Beine. „Sais tu que je suis une fée?“ Sagte das nicht die bezaubernde Druidin zu ihrem dahindösenden Feldherrn? Jetzt kam diese Fee auf die Schlange der Wartenden zu und reihte sich ordnungsgemäß am unteren Ende ein. Leon Petrollkowicz sah sich verstohlen permanent um, nicht nur, weil ihm das Betrachten dieses jungen Mädchens das Anstehen erträglicher machte, sondern weil er mit den Augen eines Malers, der er nebenberuflich auch noch war, das Modell sah, welches sich vor seinen Augen entblätterte und als maldramaturgischen Höhepunkt die Plateauschuhe von sich warf. Er hätte nicht wie Alessandro Botticelli seine Venus aus einer Muschel, sondern aus einer Kartoffel aufsteigen lassen, ein Akt irdischen Gebärens und erdgebundener Sinnlichkeit. Diese Maid wirkte unwiderstehlich allein durch ihre Gegenwart. Hat nicht Ortega y Gasset einmal sinngemäß gesagt: Männer wirken durch ihr Tun, schöne Frauen schon durch ihr Sein. Es sind jene unfassbaren, zerfließenden Gebilde, jene luftigen Traumgewebe, die durch ihre Anwesenheit den Augenblick erträglicher machen.
Die Fee wartete auf ihre Kartoffel und wirkte. Aber sie stand nicht einfach da, sondern sie schwebte – trotz der plateauschuhbeladenen Beine. War sie vor Sekunden noch die Letzte in der Reihe, so stand sie jetzt schon wesentlich weiter vorne, an unförmigen Körpern vorbeihuschend, sich zerfließend in ein Nichts auflösend, um dann plötzlich wieder neben ganz anderen Personen aufzutauchen. Leon Petrollkowicz war ganz erstaunt, als sie plötzlich neben ihm stand. Jetzt brauchte er nicht mehr verstohlen umzublicken. Eine leichte Drehung des Körpers reichte, um jedes Detail an ihr beobachten zu können: Ihre schulterlangen blonden Haare, ihr sanftmütiges Gesicht mit den großen blauen Augen, der kleinen feinen Nase und den aufgeworfenen, sinnlichen Lippen, die in ein tiefes Rot-Violett getaucht waren, die ganz leicht vorstehenden Bakkenknochen, ihr langer Hals, ihr wunderschön geformter Busen, der zwischendurch aus einem so zufällig über die Schultern gelegten Bolero hervorblitzte, die wespenschlanke Taille, und dann dieser selbst den aus dem Kartoffelofen austretenden Dunst übertreffende Duft, eine Mischung aus Parfüm und körpereigenen Essenzen. Als sinnlicher Mensch liebte Leon Petrollkowicz den Duft der Frauen. Da war einmal das äußere Bukett. Während seiner Urlaube in der Provence beobachtete er oft stundenlang die Rosenpflücker, die diese Schönste aller Blumen in Körbe warfen, um sie bei Sonnenuntergang mit dem Auto oder einem Pferdefuhrwerk nach Grasse zu bringen. Hier wurde aus den edlen Gewächsen Parfüm gemacht. Wenn Leon Petrollkowicz Parfüm roch, sog er die Sonne, die Natur, die braune Erde und die Rosenstöcke in sich auf und vermählte dieses Aroma mit dem körpereigenen Odeur einer Schönen. Er erhöhte dieses Erlebnis noch dadurch, dass er als Maler nicht nur die Hülle, sondern auch das Wesen selbst in seiner Unaussprechlichkeit zu erfassen versuchte, wenngleich nicht jedes Umfeld ihn wie von selbst zu den schönsten Höhenflügen animierte. Jetzt störten ihn der monotone Bettelgesang der Türkin, die Abgase der Straße und des rechten Nachbarn, das Gebell eines streunenden Hundes und die prallgefüllten Einkaufstüten der arbeitenden und weit mehr noch der nicht arbeitenden Bevölkerung. Als er sich trotz dieser Irritationen seiner schönen Fee intensiver zuwenden wollte, war sie schon vor ihm, und obgleich er eigentlich an der Reihe war, seinen Essenswunsch vorzutragen, nahm er großzügig in Kauf, dass sie blitzschnell ihre Bestellung der Verkäuferin entgegenrief: „Elf Kartoffeln mit Quark!“
„Elf Kartoffeln!“ Er wusste es. Der Kaufvorgang bei Frauen war immer etwas Eigenartiges. Noch nie war es ihm passiert, dass eine Frau etwas kaufte oder bestellte, das Geld hinlegte, die Ware entgegennahm und verschwand. Immer war eine Garnierung dabei. Man unterhielt sich ganz allgemein, man sprach über die Qualität der Produkte oder deren Preis, man bezahlte in bar, wobei aber ausgerechnet der letzte Cent fehlte, oder aber mit einer bereits abgelaufenen Scheckkarte, oder man bestellte, wie in diesem Fall, nicht eine, sondern elf Kartoffeln. Leon Petrollkowicz wartete und betrachte etwas gereizt die hintere Fassade der noch vorhin so bewunderten Person. Seine Blicke übersprangen in dieser Stimmung Taille, Hüfte und Beine und landeten ohne Umschweife auf den Plateauschuhen. Warum trug diese Frau diese unförmigen, fußentstellenden Treter? Waren vielleicht die Beine zu kurz geraten? Richtig! Die Beine waren viel zu kurz. Sie klebten förmlich an den kartoffelförmigen Ausbuchtungen in der Verlängerung der Wirbelsäule.
Elf Kartoffeln! Wahrscheinlich war sie irgendeine Tippse in einem Großraumbüro oder eine Sprechstundenhilfe bei einem Orthopäden, der sich auf plateaugeschädigte Füße spezialisiert hatte oder das Maskottchen einer Fußballmannschaft.
Leon Petrollkowicz wartete und wartete, und als er endlich an der Reihe war, rief die Verkäuferin „Schluss vorerst! Die letzte Kartoffel wurde soeben verkauft. In einer halben Stunde ist es wieder soweit! Jetzt müssen erst wieder neue Kartoffeln geholt und in den Ofen geschoben werden.“
So war das Leben eben. Leon Petrollkowicz registrierte nicht einmal mehr, wie die kartoffelbeladene Fee davonstapfte. Er ging einen Stand weiter und holte sich zwei mit Käse belegte Brötchen. Sie taten es auch. Warum sollte er sich ärgern? War das nicht genau der Alltag, den er seit eh und je kannte? Sind Männer nicht deshalb so langweilige Geschöpfe, weil sie meinen, es müsse immer alles glatt gehen, die kein Gespür für das Außergewöhnliche haben, die sich einbilden, es müsse sich alles nach ihren Vorstellungen abwickeln? Die immer nur funktionieren um des Funktionierens willen? Die Fuhrmänner seien, dumme Fuhrmänner, die sich und andere durch das Leben schleppen, ohne dabei auch einmal die Facetten am Rande auszukosten, wie dieses einmalige Erlebnis, von einer Fee überholt zu werden, um dann statt in eine Kartoffel in käsebelegte Brötchen zu beißen?
Er wollte im Kaufhaus gegenüber noch etwas einkaufen. Drinnen war eine dicke, stickige Luft. Die Leute drängten sich vor den Wühltischen, als gäbe es etwas umsonst. Die meisten standen nur da und wühlten. Es musste ein schönes Gefühl sein, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Strohhüte, Bettwäsche, Socken, Unterwäsche einfach nur zu befühlen, ohne gleich kaufen zu müssen. Rentner und Frauen hatten an diesen Tischen die absolut dominante Rolle. Sie benutzten nicht nur ihre Hände, sondern auch Ellbogen und Körper. Keiner sollte ihnen etwas wegschnappen, schon gar nicht einer von den gutsituierten Herren, die sich ja auch an den normalen Tischen etwas aussuchen könnten. Leon Petrollkowicz bewegte sich von einem Menschenknäuel zum nächsten, die Käsebrötchen mit einer Hand haltend, mit der anderen sie beschützend und strebte so gut es ging zur Lebensmittelabteilung im Basement. Aber das war nicht so einfach. Frau Pullemuck, die er schon am Kartoffelstand gesehen hatte, entdeckte kurz vor dem Antritt zur Rolltreppe eine Frau Wullig. Die Begrüßung war lang und herzlich. Die beiden Frauen merkten gar nicht, dass sie den einzigen Zugang zum Basement versperrten. Das interessierte sie auch nicht, weil Frauen im Jetzt leben und hier und sofort ihre Spontaneität ausleben wollen und nicht irgendwann und irgendwo. Natürlich landete Leon Petrollkowicz irgendwann irgendwo in der Lebensmittelabteilung, aber eben nach Überwindung etlicher natürlicher Hindernisse. Er kaufte Champagner ein, Krabben, kleine Salate und ein Baguette – alles Dinge, die er seiner Lebensgefährtin am Abend mitbringen wollte.
An der Kasse musste er wieder anstehen. Vor ihm stand aber kein Mensch, sondern nur ein Einkaufswagen. Auch das war ihm geläufig. Er erfand für dieses Event den Ausdruck Phantomeinkaufen. In unregelmäßigen Abständen flogen irgendwelche Waren in den Einkaufswagen, den immer weiter zur Kasse zu schieben seine Aufgabe war. Auf diese Weise vermied dieser Mensch das lästige Anstehen und konnte just dann das Portemonnaie zücken, wenn der von einem gutwilligen Kunden geschobene Einkaufswagen die Kasse erreichte. Voraussetzung war natürlich, dass der Geldbeutel auch vorhanden war. Bei der Frau, die vor Leon Petrollkowicz an der Kasse stand, war das offenbar nicht der Fall. Sie suchte und suchte, hauptsächlich in einer Handtasche, dann aber auch in Mantel und Jacke. Das Portemonnaie war verschwunden. Leon Petrollkowicz wusste, dass bei einer Frau wieder etwas Außergewöhnliches passieren würde, aber eine verlorene Geldbörse war auch für ihn etwas Neues. Die Frau zuckte mit den Schultern, sah sich um, tuschelte mit der Kassiererin und beäugte immer wieder misstrauisch den Mann hinter sich. Eine Bimmel ertönte, eine Verkäuferin eilte herbei, verschwand wieder, um nach kurzer Zeit mit einem Mann aufzutauchen, der sich als Hausdetektiv vorstellte, Leon Petrollkowicz unsanft am Arm nahm und ihn in eine kleine Kammer führte. Die junge Dame und die Verkäuferin waren den beiden gefolgt. Trotz der Enge herrschte in dem nur spärlich beleuchteten Verlies reges Treiben. Ein Polizist, ein anderer, offenbar auch auf frischer Tat ertappter Kunde, der Detektiv, der sich an eine vorgestrige Schreibmaschine setzte, und die in den neuen Fall verwickelten Personen. Leon Petrollkowicz wurde nach seinen Personalien gefragt. Name, Geburtsort, Adresse ...
Was war passiert? Leon Petrollkowicz hatte doch nichts anderes getan als seinen und den Einkaufswagen einer Frau vor sich herzuschieben. Sicher, für den Bruchteil einer Sekunde war diese Frau an ihm vorbeigehuscht, hatte sich noch für die Mühewaltung des Schiebens bedankt, um dann vor ihm die Waren auf das Fließband zu legen und den Zahlvorgang durch umständliches Suchen einzuleiten. Und er stand jetzt in dem Verdacht, das Portemonnaie gestohlen zu haben? Die Obrigkeit würde jetzt ihre Pflicht tun. Leon musste an Franz Kafka denken, der in seinen Romanen wie in seinem Leben permanent gegen eine bornierte Bürokratie und Exekutive anrannte, die ihn peinigte, fertigmachte, knechtete, ihn hochkommen ließ, nur um ihm anschließend gleich wieder den Fuß in den Nacken zu stellen. Finanzamt, Polizei, Registergericht, Vermessungsbehörde, Passamt, Amtsgericht, Arbeitsgerichtsprozess, Krankenkasse etc. etc. Er hatte doch schon genug mit all diesen selbstzufriedenen Staatsdienern zu tun, warum stand er jetzt schon wieder vor so einem subalternen Amtsbüttel? Wegen einer Frau! Hatte Kafka in seinen Romanen immer noch Frauen, die ihn liebten und ihm halfen, so war er, Leon, in seinen Demütigungen nicht nur allein gelassen, sondern wurde sogar noch von einer Frau über die Brüstung der bürgerlichen Anständigkeit geschmissen: Zur wohlgefälligen Selbstwertsteigerung der kleinen und kleinsten Gesetzeshüter. Wie lässt Kafka doch noch den Türhüter in „Der Prozess“ über sich sagen: „Ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.“
Der Mann an der Schreibmaschine, offenbar der Hausdetektiv, produzierte so eigenartige Zuckungen, wenn er von einer Zeile zur anderen wechselte, als wolle er schon mit der Körpersprache seinen Unwillen über die Infamie der sich alle so schuldlos gebärdenden Kaufhausdiebe zum Ausdruck bringen. „Die kriege ich schon!“, wollte er wohl sagen. „Mir kann keiner etwas vormachen.“ Schließlich wäre er ja seit mehreren Jahren in diesem Geschäft und würde seine Pappenheimer schon kennen. Zwischen den Zuckungen und dem Hin- und Herschieben des Schreibmaschinenschlittens sah er immer wieder verächtlich an dem Delinquenten hoch, der nach seiner Ansicht nun wirklich keinen vertrauenswürdigen Eindruck machte. Wie der schon angezogen war! Einen abgeschabten Regenmantel, wo es doch gerade im Angebot des Kaufhofs so günstige gab, ältere Schuhe, wahrscheinlich aus dem Altkleidercontainer gefischt, und als Krönung eine Karikatur von einem Hut. Leon Petrollkowicz sah an sich herunter und musste in diesem Augenblick an die ständigen Aufforderungen seiner Lebensgefährtin denken, sich seiner Position entsprechend – als Inhaber eines mittelständischen Unternehmens war er ja schließlich wer – zu kleiden. Am schlimmsten war der Hut, den er liebte und als seinen Talisman ansah. Mit diesem Hut fuhr er Ski, wanderte in den Bergen, ihn behielt er selbst beim Malen auf oder wenn es in einem Raum zu kalt war. Seine Anna hasste diesen Hut. Er hatte ihn schon auf der Piste verloren, im Zug vergessen, und einmal war er sogar in der Mülltonne gelandet. Aber wie durch ein Wunder gelangte dieses „Möbel“ durch den Müllmann, die Post oder Bahn immer wieder in seine Hände. In diesem Bereich funktionierte die öffentliche Hand.
„Nehmen Sie den Hut ab!“ befahl der Mann an der Schreibmaschine mit einem kenntnisreichen Detektivlächeln. Der Geldbeutel konnte ja dort versteckt sein. Er war es aber nicht, wie sich alsbald herausstellte. Der Mann schrieb weiter und weiter, so als würde er den Hergang der Tat ganz genau kennen und zum Schluss den Dieb nur noch auffordern, das Protokoll zu unterschreiben. Dazu kam es aber nicht. Die sich bestohlen fühlende junge Dame schrie plötzlich auf, fühlte im Futter ihres Mantels etwas Hartes und zog wenig später das Portemonnaie heraus. Es war offenbar durch ein Loch in der Manteltasche in das Futter gerutscht.
Der Mann an der Schreibmaschine, die Verkäuferin, der Polizeibeamte, sie alle waren nicht etwa erleichtert, sondern entsetzt. Wofür hatten sie sich diese Arbeit gemacht! Keine Entschuldigung in Richtung Leon Petrollkowicz, sondern strenge Blicke für die junge Dame. War das nicht so etwas wie Irreführung des Apparates, der schon wie geschmiert zu funktionieren begann? „Also denn“, räusperte sich jemand mit kleinlauter Stimme aus dem Hintergrund. „Damit wäre ja alles geklärt. Die Waren aus den Einkaufswagen habe ich leider schon wieder in die Regale gestellt. Man konnte ja nicht wissen …!“ Leon Petrollkowicz sah geringschätzig auf die kleine, etwas dickliche Verkäuferin herunter, die wohl etwas vorschnell das Verfahren eingeleitet hatte. Er überlegte einen Augenblick, ob er auf eine Entschuldigung drängen oder der ganzen Mannschaft einschließlich der vermeintlich Bestohlenen die Meinung sagen sollte. Aber er tat gar nichts. Er schwenkte seine Käsebrötchen hin und her und eilte aus dem Verlies, um keine Sekunde länger als nötig in dieser beklemmenden Atmosphäre aushalten zu müssen. Er war kaum einige Schritte gegangen, als er von der jungen Frau von hinten angesprochen wurde: „Entschuldigen Sie vielmals. Mir ist das Ganze so peinlich. Ich hätte auf diese blöde Wichtigtuerin an der Kasse nicht hören sollen.“
„Schon gut“, sagte Leon Petrollkowicz etwas ungehalten und ging schnell weiter, verlangsamte aber nach einer Weile seine Gangart und sah sich nachdenklich nach der jungen Frau um. Das war sie doch! Das war doch Helen Laroche, die Mitarbeiterin des allmächtigen Vorstandsmitglieds der berühmten Bank Cassa Nostra AG, Dr. Dr. hc. Alexander Maibohm. Er hatte sie in der Eile des Gefechts und bei dem schummrigen Licht in dem Verhörraum nicht erkannt. Er wartete, bis sie in Reichweite war.
„Sind Sie nicht Frau Laroche?“
„Natürlich, jetzt erkenne ich Sie, Herr Petrollkowicz. Mussten wir uns nach so langer Zeit auf diese Weise wiedersehen?“
Leon Petrollkowicz hatte geschäftlich wenig mit Helen Laroche zu tun, weil für ihn ein junger Handlungsbevollmächtigter aus dem gleichen Vorstandssekretariat zuständig war. Das letzte Mal hatte er sie anlässlich eines Investor-Relationsgesprächs im Plaza Hotel in New York flüchtig gesprochen, als ihr Chef etwas von ihm wissen wollte. Dr. Maibohm war als Beiratsvorsitzender der Firma „Public Petrollkowicz“ eines seiner wichtigsten Aushängeschilder. Er brachte nicht nur die Bank als Kunden ein, sondern auch eine Reihe bekannter Unternehmen, die von dem Know-how der renommierten PR- und Marketingagentur profitieren wollten.
Helen Laroche war noch immer etwas verlegen, fing sich aber langsam wieder, entschuldigte sich zum wiederholten Male und fragte ihn schließlich, ob er schon gegessen habe und wenn nein, ob sie ihn vielleicht als Wiedergutmachung in ein gegenüberliegendes Restaurant zu einem kleinen Essen einladen dürfe. Sie hatte sich ein paar Kleinigkeiten aus der Lebensmittelabteilung mit ins Büro nehmen wollen, war aber, wie auch Leon Petrollkowicz, nicht in der Stimmung, sich noch einmal alles aus den Regalen zusammenzuholen. Leon hatte zunächst an seine angebissenen Käsebrötchen gedacht, diese aber schnell in seiner Manteltasche versteckt, um die Gelegenheit beim Schopfe packen zu können. Wenn ihm auch eine Einladung unter anderen Voraussetzungen lieber gewesen wäre, so war er dennoch spontan einverstanden, nicht nur wegen der versöhnlichen Geste, sondern weil er unter normalen Umständen niemals die Chance gehabt hätte, die wahrscheinlich attraktivste, wenn auch nicht ganz unumstrittene Frau dieser Bank näher kennenzulernen. Man tuschelte hinter vorgehaltener Hand, dass sie ihrem Chef auf mehrere Arten diente und so einen immensen Einfluss auf das Geschäft genommen habe. Dank ihrer hohen Intelligenz und Kompetenz habe sie alle Aufgaben des Vorstandssekretariats der Bank prompt erledigt und sei auch sonst ihrem Herrn und Gebieter gefällig, was offiziell natürlich heftig bestritten, dennoch aber in der für Geschichten so anfälligen Bank-und Börsenwelt eifrig kolportiert wurde
In einem kleinen Argentinischen Steakhaus aßen die beiden zu Mittag. Zunächst ging es noch um das verlorengegangene Portemonnaie mit den bekannten Folgen, dann wechselte man aber schnell das Thema und unterhielt sich über allgemein wirtschaftliche Fragen. Leon Petrollkowicz war erstaunt, wie gut sich Helen Laroche selbst in ökonomischen Details auskannte. Man merkte, dass sie Wirtschaft studiert hatte und ihr theoretisches Wissen durch die vielen praxisbezogenen Vorgänge im Vorstandssekretariat anreichern konnte. Ihre diskursiven Ausführungen wirkten aber nie aufdringlich, besserwisserisch oder diskriminierend – im Gegenteil. Sie hörte sich immer erst seelenruhig an, was ihr Gegenüber zu sagen hatte und gab dann mit größter Zurückhaltung ihren Kommentar ab, wobei sie sich fast dafür entschuldigte, wenn sie in dem einem oder anderen Punkt einfach besser Bescheid wusste. Dieses Understatement war kein Gehabe oder eine intellektuelle Masche, sondern schlicht eine Voraussetzung, um mit dem Vorstand oder den Topmanagern korrespondieren zu dürfen. Mit ihrer einfühlsamen, klugen Dezenz konnte sie jeden Gesprächspartner ganz unaufdringlich von ihrer Kompetenz überzeugen. „Bei so viel Schönheit“, fügte man noch gerne bewundernd hinzu, weil bei vielen Männern das Vorurteil verbreitet ist, dass hinter einer schönen Fassade im Allgemeinen nicht viel stecke.
Helen Laroche war wirklich wunderschön. Ihr Zauber ging einmal von ihrer tadellosen Erscheinung aus, besonders aber von ihrem Gesicht. Durch ihre hohe Stirn, die feine, leicht nach oben geschwungene Nase, den filigran geschnittenen, sinnlichen Mund, der auch dann Botschaften signalisierte, wenn sie nichts sagte, ihre dezent angedeuteten Backenknochen, und dann diese dunklen Augen! Sie waren gütig und präsent. Ihrem Gegenüber gab sie das Gefühl, ihn zu mögen, sympathisch zu finden, wobei sie die Waffen einer Frau geschickt einsetzte. Sie spielte dann mit ihren schwarzen, leicht welligen schulterlangen Haaren, warf sie mit einer leichten Kopfbewegung nach hinten oder zog sie über eine Gesichtshälfte in breiten Streifen in Richtung ihres langen, schönen Halses.
Leon Petrollkowicz merkte im Laufe der Unterhaltung, dass er sich immer weniger auf den Inhalt des Gesprächs konzentrierte – das inzwischen servierte Steak hatte er noch nicht einmal angerührt –, sondern in das Kordongespinst der ihn so sympathisch einfangenden Helen Laroche geriet.
„Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen“, sagte sie nach einer längeren Pause zögernd. „Quasi als Gegenleistung für meinen unglaublichen Faux pas im Kaufhaus. Aber Sie dürfen auf keinen Fall darüber sprechen. Sonst bin ich geliefert. Können Sie mir das zusagen?“
„Ja, natürlich.“
Leon Petrollkowicz ließ sich nicht anmerken, dass er aufs Äußerste angespannt war. Er wusste, dass sein Gegenüber an einer Stelle in der Bank saß, wo früher seine jetzige Kollegin den Ton angegeben hatte und die man ihm sozusagen aufs Auge gedrückt hatte. Obgleich er Alleingesellschafter seiner Firma war, musste er sich dem Diktat seines größten und bedeutendsten Kunden, der Cassa Nostra AG, beugen. Offiziell wollte man ihm jemanden zur Seite stellen, der die Intentionen der Kunden aus dem Blickwinkel einer Bank kannte und deshalb vermeintlich nur ein Gewinn für die Firma sein konnte. Den wahren Grund hatte er nie erfahren. Seine Gedanken wurden durch eine Frage von Helen Laroche unterbrochen. „Ihre Kollegin in der Geschäftsführung ist doch Emma Hengstenberg?“
Als Leon Petrollkowicz nickte, fuhr sie sehr behutsam fort: „Könnte man vielleicht sagen, dass Ihr Verhältnis zueinander nicht gerade sehr kollegial ist?“ Leon Petrollkowicz nickte diesmal nicht mit dem Kopf, sondern ließ seine Augenlider fast unmerklich auf eine Habachtposition abgleiten.
„Ich weiß, dass Sie hierüber nicht gerne sprechen wollen“, sagte Helen Laroche, „und das ehrt Sie auch. Aber diese Rücksichtnahme ist leider einseitig.“
„Und was heißt das?“ Eine lange Pause. Helen Laroche tat für Augenblicke so, als würde sie sich interessiert die Leute im Lokal ansehen, bestellte dann beim Ober einen Salat, sah teilnahmslos zum Fenster hinaus, um dann unvermittelt Leon Petrollkowicz fest in die Augen zu schauen. „Sie müssen mir wirklich versprechen, dass Sie das, was ich Ihnen sage, keinem Menschen wiedererzählen. Das könnte mich die Stellung kosten.“
Leon Petrollkowicz wurde neugierig. Er hob mit gespielter Gleichgültigkeit zwei Finger seiner Schwurhand in Richtung Decke und zerquetschte mit der anderen ein neben seinem Teller liegendes Brötchen. „Das habe ich Ihnen doch schon versichert.“
Ein Verschwörerausdruck huschte über das Gesicht der schönen Frau. „Emma Hengstenberg nutzt jede Gelegenheit, um Sie bei Dr. Maibohm zu diskreditieren. Sie dürfen nicht vergessen, dass sie vom Vorstand abgestellt wurde, damit dessen Interessen wirkungsvoll vertreten werden. Sie sollen in ihren Kampagnen das Image der Topmanager verbessern helfen, was Ihnen offenbar schwerfällt. Frau Hengstenberg kontrolliert Sie aber nicht nur, Sie sägt auch an Ihrem Stuhl.“
Wieder eine längere Pause. Leon Petrollkowicz hob ungläubig die Augenbrauen. „Wie das? Ich habe dieser Frau doch nichts getan.“
„Sie wissen sicherlich, dass Frau Hengstenberg in einer Stabsfunktion damit beschäftigt war, diverse Aufsichtsratmandate zu betreuen. Als man sie aber auf die Kreditseite herüberzog und sie auf Großkunden losgelassen wurde, versagte sie kläglich. Sie ist sehr gescheit, aber Ihr fehlte das Feeling für das Geschäft und für den Kunden. Weil sie wohl die Aufgabe nicht meisterte, wurde sie zunehmend schwieriger, unberechenbarer und falsch. Als sich ein Großkunde beim Vorstand beschwerte, suchte man nach einer Lösung. Schließlich einigte man sich im Vorstand darauf, sie in Ihre Firma abzuschieben. Man war sie los und jemand konnte Ihnen auf die Finger schauen.“
Leon Petrollkowicz schnaubte verächtlich. „So ist das also. Man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn jemand in gewisser Weise enttäuscht oder unbequem wird, geht man nicht den Weg einer arbeitsrechtlichen Lösung, die unter Umständen recht teuer ist, sondern sucht einen Posten in einer für das Geschäft nicht so wichtigen Firma und entgeht damit dem nach einer Trennung üblichen Gequatsche oder den gezielten Indiskretionen in einer von der Diskretion lebenden Branche. Außerdem hat man mehr Kontrolle über meine Firma.“
„So ist es.“ Petrollkowicz schüttelte verständnislos den Kopf. „Und die anderen müssen sehen, wie sie mit diesem Implantat fertig werden. Aber welche Handhabe hat Frau Hengstenberg gegen mich? Schließlich stimmen wir doch alles untereinander ab.“
Helen Laroche hob mit einer Geste der Unentschiedenheit die Schultern.
„Wie es scheint nicht. Und hier ist schon einer der kritischen Punkte. Ihre Kollegin hat uns einen ganzen Aktenordner zukommen lassen, aus dem hervorgeht, dass sie Sie über jedes Detail schriftlich informiert und mit Ihnen abgestimmt hat, umgekehrt aber von Ihnen kaum ein Vorgang als Aktennotiz festgehalten wurde. Damit unterlegt sie ihre Behauptung, sie werde von Ihnen nicht auf dem Laufenden gehalten und habe deshalb keinen Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Auf diese Weise entzog sie sich der Kritik an der letzten von ihrer Firma konzipierten PR-Kampagne und schiebt Ihnen alle Schuld in die Schuhe.“
Leon Petrollkowicz traute seinen Ohren nicht. Er hatte sich fast täglich mit seiner Kollegin über alle nur denkbaren wichtigen Vorgänge verständigt, weil für ihn der Dialog ein wichtiges Hilfsmittel zur Urteilsfindung sein konnte. Ihm war es allerdings lästig, seine wertvolle Zeit darauf zu verwenden, Aktennotizen am Fließband zu produzieren, um seine Kooperationsfähigkeit unter Beweis zu stellen und sich gegen falsche Behauptungen abzusichern. Das war offenbar sein Fehler. Aber im konkreten Fall war er sich doch mit seiner Kollegin und allen Gremien darin einig, eine ausbalancierte PR-Kampagne vorgelegt zu haben. Was sollte also diese Negativkritik?
„Ich weiß, was Sie denken“, fuhr Helen Laroche fort, ohne auf eine Erklärung ihres Gegenübers zu warten. „Erinnern Sie sich an die Passage in einer Anzeige, wo die publizistische Aufgabe der Banken gegenüber der Öffentlichkeit beschrieben wird?“
„Sie meinen die Stelle, in der es sinngemäß heißt: Unser kommunikatives Projekt ist der Sachverhalt. Ihn unverfälscht darzustellen, ihn nicht zu zerstören, bevor man ihn kommentiert, entspricht dem Freiheitspostulat, dem Ziel, den Konsumenten in den Stand zu versetzen, inmitten der Medien seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies setzt aber auf unserer Seite – der Seite der Manager – im Verkehr mit den Medien, der Presse, eines voraus, nämlich Offenheit in des Wortes direkter Bedeutung. Wir müssen sagen, was ist, wir dürfen nicht verschweigen oder verdecken.“
„Sie kennen den Text auswendig?“ Helen Laroche war beeindruckt.
„So gut wie. Wenn sie eine Anzeige hundertmal vorgelegt bekommen, redigieren und schließlich verabschieden, um sie dann in allen großen Zeitungen wiederzufinden, muss die Kernaussage haften bleiben. Aber was habe ich falsch gemacht?“
Helen Laroche tat sich mit der Antwort schwer. Sie setzte mehrere Male zu einer Erklärung an, blieb dann aber immer wieder in ihren Gedankengängen hängen.
„Man kann nicht direkt sagen, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Ihr Auftrag lautete, das Bild des Managers in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Man traut ihm nicht. Meinungsumfragen belegen, dass er das Image hat, der Öffentlichkeit im eigenen Interesse leicht etwas vorzugaukeln. Ihre Strategie bestand nun darin, die Absicht der Manager, mit Offenheit und Selbstkritik an die Öffentlichkeit zu treten, in den Mit
telpunkt der Kampagne zu stellen. Deshalb auch dieses Zitat.“
„Das übrigens von einem Manager stammt!“
„Mag sein. Die meisten Auftraggeber waren ja auch anfangs mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Dann aber überzeugte Emma Hengstenberg meinen Chef, dass nicht Selbstkritik der richtige Weg sei, sondern das Herausstellen positiver Leistungen. Ihre Kollegin ist Ihnen in den Rücken gefallen. Ihr Image hat eine deutliche Delle erfahren.“
Leon Petrollkowicz antwortete mit einem ärgerlichen Auflachen. „Ach, dahin läuft der Hase! Warum hat dann aber die ehemalige Mitarbeiterin Ihrer Bank, die jetzt meinen Betrieb verunsichert, meinen Vorschlag zunächst unterstützt und argumentativ unterlegt?“
„Die Betonung liegt auf ‚zunächst’. Sie hat durch eine perfekt inszenierte Intrige Ihre persönliche Zuverlässigkeit in unserem Hause in Zweifel gestellt und damit Ihre Loyalität zu Ihren Auftraggebern. Sie müssen aufpassen. Täglich erfahre ich im Speisesaal über irgendeines Ihrer Gespräche, mit denen Sie angeblich Meinungsbildner und Politiker über die fragwürdigen Praktiken der Banken und der Industrie informieren. Mal ist es die Insiderproblematik, mal die nicht uneigennützige Globalisierungsmanie, dann sind es wieder Paketverkäufe auf dem Buckel der Kleinaktionäre, unzumutbare Börsengänge und so weiter.“
Leon Petrollkowicz hörte sich die Anschuldigungen mit versteinerter Miene an. Er war als ehemaliger Journalist und Publizist von Natur aus kritisch, suchte nichts zu beschönigen oder unter den Teppich zu kehren und hatte deshalb auch eine offensive PR-Kampagne für die Wirtschaft nach dem Motto gestartet: „Wir machen Fehler, aber reden darüber und suchen nach Lösungen“. Natürlich hatte er immer wieder auf die Dissonanzen im Konzert der Wirtschaft aufmerksam gemacht, weil nach seiner Auffassung nur so das Modell Marktwirtschaft eine Chance hätte. Aber die Wirtschaft honorierte diese Art von Offenheit nicht. Sie hatte jahrzehntelang als Deutschland AG schalten und walten können wie sie wollte und mochte sich jetzt nicht damit abfinden, dass man sich von lieb gewonnenen Gewohnheiten verabschieden sollte. Diese Hengstenberg hatte natürlich seine Gedankengänge schnell durchschaut und genüsslich an entscheidender Stelle mit einem falschen Zungenschlag kolportiert. Warum war er aber ihr gegenüber so blauäugig? Männer sind offenbar zu naiv, zu geradeaus, um die Winkelzüge verkniffener Gewitterziegen zu durchschauen.
Leon Petrollkowicz blieb bis zum Ende des improvisierten Mahls einsilbig. Er dankte Helen Laroche für ihre Offenheit, die ihm vielleicht helfen könne, in Zukunft weniger vertrauensselig zu sein und sich und seine berufliche Zukunft besser zu schützen. „Wissen Sie“, sagte die so verständnisvolle junge Dame beim Aufbruch, „weshalb die Hengstenberg so unheimlich ist? Als sie eines Tages mit einem ihrer gefährlichsten Widersacher eine Besorgung für die Bank machte, kehrte sie alleine zurück. Ihr Kollege war von einem Auto überrollt worden. Die näheren Umstände, die zu dem Unglück führten, wurden nie aufgeklärt.“
„Wie beruhigend!“, sagte Leon Petrollkowicz beim Abschied.