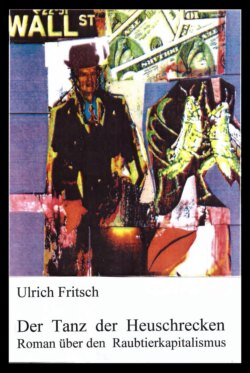Читать книгу Der Tanz der Heuschrecken - Ulrich Fritsch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеLeon Petrollkowicz ging eigentlich recht gerne ins Büro. Er hatte vierzig Angestellte und zu den meisten ein gutes Verhältnis. Die Lage der Firma war ideal: In der Schadowpassage im Herzen von Düsseldorf, wo das Treiben nicht bunter und die allgemeine Stimmung nicht besser sein konnte. Schöne Geschäfte, nette italienische Restaurants, etliche Straßenmusikanten, kleine Verkaufsstände mit allerlei Tand, gut gekleidete Menschen. Wenn er in sein Office ging, mischte er sich gerne für Minuten unter das Volk, warf einen Blick auf die Schaufensterauslagen und ließ sich bei einem italienischen Früchtestand einen frischen Orangensaft auspressen. Weil er kein Frühaufsteher war und sich in seinem Job das meiste in den Abendstunden abspielte, ließ er es morgens langsam angehen und verlangte auch von seinen Mitarbeitern nicht die absolute Pünktlichkeit. Allerdings legte er Wert darauf, dass beim Klingeln der schnurrende Türöffner ertönte, ein Zeichen dafür, dass schon jemand da war und sich dieser gewisse Jemand mit den anderen über das Begrüßungszeremoniell verständigte. Es war fast ein Ritual, dass in der Chefetage jemand eigenhändig die Tür öffnete und man diese Tätigkeit nicht von ihm selbst oder dem Türautomaten übernommen werden musste. Die Mitarbeiter waren damit sehr einverstanden, hatten sie auf diese Weise Gelegenheit, das allmorgendliche Gelage in eine manierliche Büroszene umzugestalten. Ein Hereinplatzen des Chefs hätte unter Umständen recht peinlich sein können. Besonders Frau Hengstenberg legte Wert darauf, sich gegenüber Petrollkowicz keine Blöße zu geben. Es war eine ihrer Gewohnheiten, sich früh zur Auflockerung einen Whisky zu genehmigen, den sie freilich mit Orangensaft geschickt kaschierte. Als Frühaufsteherin nutzte sie die Morgenstunden, um private, aber auch dienstliche Telefonate zu führen, einmal, weil sie dann ungestört parlieren konnte, dann aber auch, um ihrem Gesprächspartner zu stecken, dass Leon Petrollkowicz es mit seinem Berufseifer nicht so ernst nehme, mal erscheine, mal nicht, und dass sie auf künstlerische Gepflogenheiten dieser Art halt Rücksicht nehmen müsse. Auch pflegte sie morgens den Umgang mit einigen ihr besonders sympathischen Mitarbeiterinnen, um sich so ihre Seilschaften aufzubauen. Meistens waren es vom Leben und der Liebe nicht verwöhnte Frauen, die ganz in ihrem Beruf aufgingen und sich gerne an Frau Hengstengberg anlehnten. Wenn dann in den schönsten Gesprächen der Chef klingelte, wurden die Drinks schnell weggestellt und die Plätze eingenommen. Abwechselnd öffnete immer ein anderer die Tür.
An jenem Morgen hatte eine Frau Gabler Türdienst. Sie stand für Sekunden vor ihrem Chef, murmelte ein „Morgen“, machte auf dem Absatz kehrt und ging erhobenen Hauptes in ihr Zimmer. Frau Gabler war ein Lästermaul besonderer Güte. Sie verstand es, sich immer diejenigen der Firma für ihren Schmäh auszusuchen, die bei Frau Hengstenberg ein besonders negatives Image hatten, und dies waren in erster Linie die Vertrauten von Leon Petrollkowicz. Auf diese Weise stieg sie in der Achtung ihrer Chefin und konnte sich viel herausnehmen, zum Beispiel auch, auf Fragen männlicher Vorgesetzten pampig oder überhaupt nicht zu antworten. Irgendeines der männlichen Wesen hatte ihr früher einmal ein Kind gemacht, und danach war ihr Hunger nach männlicher Zuneigung für alle Zeiten gestillt. Man erzählte sich, dass jener Liebhaber, ein Schwarzer, sie mit seinem großen Ding so erschreckt hatte, dass sie tagelang wie traumatisiert herumrannte und seitdem keinen Mann auf mehr als dreißig Zentimeter an sich heran ließ. Leon Petrollkowicz machte ohnehin immer einen großen Bogen um diese Dame, aber er hielt sie, weil sie besser als alle anderen texten konnte, und dies sogar mit leisem Humor, den man bei ihr gar nicht vermutete.
Aber natürlich hatte auch Leon Petrollkowicz seine Bastionen. Da waren seine beiden Sekretärinnen. Abwechselnd brachten sie ihm in letzter Zeit nach seinem Eintreffen das Frühstück oder besser das, was er sich so unter Frühstück vorstellte: einen Haferschleim, einen Zwieback, viel Kaffee. Seine Lebensgefährtin Anna weigerte sich ab einem bestimmten Tag, ihm diese Haferflocken anzurühren, weil, wie sie meinte, der therapeutische Effekt des Breis durch den starken schwarzen Kaffee wieder zunichte gemacht werde und sie sich über diese Unvernunft und seine immer schlimmer werdenden morgendlichen nervösen Einlassungen über Kindererziehung und Hausstand zunehmend ärgern müsse. Außerdem machte sie ihm klar, dass sie gerade am Morgen viele Hausfrauenpflichten hätte und nicht warten könne, bis er irgendwann einmal aus dem Bett kröche. Natürlich hatte der Genussmensch Leon Petrollkowicz keine große Neigung, früh einen Haferschleim zu essen. Aber die äußeren Umstände zwangen ihn dazu, sich mehr als gewohnt um seine Gesundheit zu kümmern. Er spürte, dass mit der ihm aufgezwungenen Emma Hengstenberg ein ungutes Kapitel in seiner Firma aufgeschlagen wurde und dieser Umstand bereitete ihm Magenschmerzen.
An jenem frühen Vormittag, als er mit einem fröhlichen „Guten Morgen“ die Mitarbeiter durch die geöffneten Türen begrüßte, fühlte er sich recht entspannt. Er hatte am Abend vorher noch in Amsterdam mit Kollegen aus dem Internationalen Marketingverband, dessen Vorsitzender er war, gezecht und lange über die Frage diskutiert, ob man wider besseres Wissen eine Investor-Relations-Kampagne starten dürfe, deren strategisches Ziel es sein sollte, einen Zustand schön zu reden. Er berichtete in Amsterdam von seinen Querelen mit den Bankern, besonders mit Dr. Maibohm, und fand bei seinen Kollegen viel Verständnis. Und das stimmte ihn zufrieden.
Weniger zufrieden mit sich, der Welt und mit der internationalen Reputation ihres Kollegen war Emma Hengstenberg. Voller Neid und Eifersucht verfolgte sie seine Auftritte bei großen Veranstaltungen, im Fernsehen, seine Veröffentlichung in der Fachpresse und, wie jetzt, seine emsige Reisetätigkeit. Wenn es irgend ging, suchte sie nach einem Haar in der Suppe und fand meistens auch eins, was dann prompt irgendeiner ihrer vielen Gesprächspartner so ganz beiläufig zu Ohren bekam. Den größten Erfolg hatte sie immer mit dem Hinweis, dass bei Fernsehauftritten von Petrollkowicz einer der Vorstände der Industrie oder der Banken das Ganze viel besser gemacht hätte. Sie wusste, dass die Herren in den obersten Etagen mediale Events schätzten und jeden auch noch so guten Beitrag eines Dritten wenig würdigten, wenn sie zum gleichen Thema ebenso hätten befragt werden können. Macht und Kompetenz sind eben nicht teilbar und schon gar nicht mit irgendeinem im Lande, der letztlich in einer Abhängigkeitsposition war. Leon Petrollkowicz wusste das, aber er musste auch an das Image seiner Firma denken, die letztlich hauptsächlich von guter Publicity und seinen kompetenten Auftritten lebte.
Frau Holle, eine seiner beiden Sekretärinnen, brachte ihm seinen „ekelhaften Haferschleim“ (so drückte er sich immer aus, wenn er den Geruch dieses mehligen Gaumenkillers mit einer abweisenden Handbewegung von sich wegzufächern suchte) und eine Kanne Kaffee, mit dem er seine sieben Sinne wieder auf den normalen Alltag einstellen wollte. Er war an jenem Morgen wach, aber trotzdem nicht ganz da, weil er, wie gesagt, mit seinen Kollegen in Amsterdam auch einen heben musste und er sich bei solchen Gelegenheiten gerne von seiner trinkfesten Seite zeigte.
Frau Holle fragte, diskret wie immer, nach seinem Wohlbefinden. Sie hatte wohl gemerkt, dass er nicht so frisch wie sonst den Tag begann und versuchte in solchen Situationen mit höflichen Floskeln herauszubekommen, wie sie ihm vielleicht einen zusätzlichen kleinen Dienst erweisen könnte: Mit einer Aspirin, einem Glas Wasser, dem Öffnen der Fenster oder auch nur, indem sie ihn besonders verständnisvoll, ja liebevoll ansah. Frau Holle war der perfekte mütterliche Typ, innerlich wie äußerlich. Sie war um seine Gesundheit besorgt, seine Kleidung, kein Knopfannähen war ihr zu viel, kein schnelles Überbügeln der zerknitterten Hose zu lästig, und dabei wahrte sie immer Form und Anstand. Allerdings zeigte sie an manchen Tagen recht auffällig ihre weiblichen Attribute, indem sie zum Beispiel ihren üppigen Busen beim Hinstellen des Tabletts absichtlich etwas länger über der Tischkante baumeln ließ oder sich so hinstellte, dass der Blick auf die schönen langen Beine freigegeben wurde. Sie genoss es dann, wenn ihr Chef mit wohlfeilen Blicken und einem sanften Tremolo in der Stimme diese Signale aufnahm. Mehr wollte sie nicht oder vielleicht doch, aber beide wussten zu gut, dass man im Dienst übertriebene Regungen in dieser Richtung besser unterdrücken sollte.
Leon Petrollkowicz nutzte wie die Monarchen in früheren Jahrhunderten die Frühstückspause, um sich ganz zwanglos die Wünsche und Sorgen seiner „Untertanen“ anzuhören. Er ließ zu diesem Behufe die Tür immer weit offen stehen und brauchte in der Regel nicht lange zu warten, bis jemand das „Allerheiligste“ betrat.
An jenem Morgen näherte sich August Mohren bedächtig dem „Hauptaltar“, begrüßte freundlich seinen Vorgesetzten, um dann gleich eine Petition loszuwerden. Er fühle sich in Gegenwart von Giselle Frou, die ja mit ihm ein Büro teile, erotisch permanent aufgeladen und könne nicht mehr konzentriert arbeiten. Ob er nicht in das Zimmer von Martin von Alzheim, der ja ein viel größeres Büro für sich allein beanspruchen könne, umziehen sollte.
Auch aus Sicht von Leon Petrollkowicz war diese Frou nicht unumstritten. Sie war aufreizend hübsch und betonte dies auch noch durch eine windschlüpfrige Verschalung. Eine knatschenge schwarze Lederhose, dazu passende Lederstiefel mit hohen Absätzen, eine weiße, weit geöffnete Seidenbluse – dies war nur eine Variante ihres oft bis an die Grenze des flippigen Geschmacks gehenden Outfits in einer nicht gerade prüden Büro-Community. Und dann die körpereigenen Vorzüge: schulterlange schwarze Haare, ein voller, weich geschwungener Mund, schwarze Augen, eine sportliche Figur mit einem wunderschön ausgeformten Popo, lange Beine – eine aufreizende Erscheinung.
Hinzu kam eine warme, weiche, sinnliche Stimme, die man als Paradigma eines Lockrufs des Weibchens verstehen konnte. So sah es jedenfalls Leon Petrollkowicz, der die Stimme „seiner“ Frou gerne mit der einer Kaufhausansagerin verglich, die über Lautsprecher Unterwäsche, Übergardinen und Kaffeemaschinen zu Sonderpreisen anpries. Oder anders: Wenn man ihre Stimme hörte, musste man an Dessous denken.
Sie sagte meistens völlig unwesentliche Dinge in einer Stimmlage, die sinnlich werden ließ. Dies führte dazu, dass die Kunden der „Public Petrollkowicz“ nicht den Chef oder Emma Hengstenberg sprechen wollten, sondern lieber mit der Frou telefonierten. Sie unterhielten sich dann manchmal über eine Stunde über nichts. Sie wollten nur Sensitivöl um den Bart geschmiert bekommen und mit einer schönen Stimme flirten. Die Frou verstand die Nöte ihrer Kunden, mehr noch, sie verstand es, den trüben langen Tag mit netten Unterbrechungen zu würzen und hatte dabei noch das Gefühl, etwas Nützliches für die Firma getan zu haben. So sah es auch Leon Petrollkowicz. Gelegentlich war ihm die nicht enden wollende Laberei seiner Mitarbeiterin zuwider. Schließlich hatte er sie eingestellt, um ihren betriebswirtschaftlichen Sachverstand zu nutzen. Giselle Frou hatte in Wuppertal und Paderborn studiert, ihre Examina alle recht ordentlich bestanden und konnte in den ersten Monaten ihrer Anstellung tatsächlich den Eindruck vermitteln, sie hätte auf den beiden Universitäten etwas gelernt. Allmählich verblasste dieses Image. So gab sie sich beispielsweise bei den harmlosen Quizspielchen ihres Chefs so unbedarft, dass man über die Antworten noch nach Tagen schmunzeln musste. Manpower hatte etwas mit der Potenz von Managern zu tun, die Konzertierte Aktion mit musikalischen Events.
Die Frou war aber bei allen beliebt. Sie quirlte durch die Räume und Etagen wie eine aufgescheuchte Henne, immer sehr geschäftig und in einem Aufzug, der an Irma la Douce erinnerte. Ihre ganze Erscheinung war so gepolt, dass die Meridiane ihres Körpers am Südpol zu zerbersten drohten. Um das Ganze so recht zur Wirkung zu bringen, liebte sie ausgefallene Positionen. So warf sie sich sehr gerne über einen Tisch, um irgend etwas zwischen den Aktenordnern zu suchen, oder sie kletterte auf eine Leiter, um Bücher aus den Regalen zu fischen, oder sie bückte sich, um Nichtigkeiten vom Boden aufzuheben. In allen diesen Stellungen kamen ihre weiblichen Reize zu Geltung. Kein Mann konnte in diesen Momenten eine sachliche Beziehung zu dieser Person herstellen. Man, oder besser Mann, dachte dann an ABS, aber nicht etwa an den großen Banker, sondern an das Antibremssystem, mit dem man den inneren Blutstau aufzulösen suchte.
Mit was für Problemen musste sich der Chef herumschlagen! Er hasste diese Art von Personalmanagement, weil er immer persönlich angreifbar war. Entscheidungen dieser Art konnten niemals zur Zufriedenheit aller gelöst werden, weshalb er allzu gerne erneut einen Personalchef eingestellt hätte. Dieser hätte allen Unmut auf sich ziehen sollen, gleichsam als bezahlter Blitzableiter, und nicht er, der Chef, der als Souverän über den Bagatellen des Alltags stehen sollte, den Kopf nur frei für große Entscheidungen. Früher hatte er schon einmal den Versuch gemacht, seinen Chefbuchhalter zusätzlich mit dieser Aufgabe zu betrauen. Aber der Mann zerbrach an dieser doppelten Zumutung. Den ganzen Tag Zahlen und die Probleme von Leuten hin und her zu schieben, war für ihn zuviel. Er schmiss eines Tages das Handtuch, trat in den Staatsdienst ein, machte nebenher eine politische Karriere als Schatzmeister der Liberalen und fand als Meister für Verbindlichkeiten und fürs Unverbindliche endlich die Bestätigung, die er bei der „Public Petrollkowicz“ nie gefunden hatte.
Dann unternahm Petrollkowicz einen zweiten Anlauf. Auf einem Kongress in Cannes lernte er einen Elsässer kennen, der wie er die Leidenschaft zur Malerei teilte, vier Sprachen beherrschte, ein ausgewiesener Personalfachmann und Diplompsychologe war und eine neue Stelle suchte. Leon Petrollkowicz griff zu und war zunächst begeistert. Monsieur Ampere, wie er hieß, war ein Spezialist für Menschenführung. Er genoss es, wenn sich die Mitarbeiter von seinen Redeschwallen mitreißen ließen, wenn er aus der Schatztruhe seiner großen internationalen Erfahrung Wissenswertes hervorholte oder manchmal auch etwas umständlich herauskramte, wenn er auf Fälle und Reinfälle zu sprechen kam und dabei nicht nur Berufliches, sondern auch rein Menschliches zum Besten gab, und das Ganze auch noch mit einem einschmeichelnden, verzaubernden französischen Akzent. Er merkte dabei gar nicht, dass er in Wirklichkeit nicht als Fachmann, sondern als Pausenfüller an Renommee gewann. Jeder in der Firma, der mal wieder keine Lust zum Arbeiten hatte oder aus irgendwelchen Gründen aufgemuntert werden wollte, ging zu Monsieur Ampere. Dieser liebenswerte Franzose hatte zwei Leidenschaften im Büro: Er rauchte pausenlos und trank dazu schwarzen Kaffee. Diese Laster hatten im Laufe der Zeit seinem Gesicht etwas Maskenhaftes gegeben, das sich immer merklicher von seiner schwarzen Haarpracht abhob. Anfangs bewunderte man seinen Lockenkopf, doch eines Tages, als er gerade wieder zu einer seiner Tiraden anhob und dabei in Rage geriet, fing eben dieses dekorative Gespinst an zu Vibrieren, verrutschte auch etwas, woraufhin man unschwer ein Toupé ausmachen konnte, seitdem ein beliebtes Gesprächsthema für die nicht gerade pietätvolle Belegschaft dieser Marketingagentur.
Aber Ampere gab sich nicht geschlagen. Er kämpfte unverdrossen weiter, wusste aber schließlich nicht mehr, gegen wen oder was, denn selbst die gefährlichsten Spötter hatten letztendlich Mitleid mit ihm und wollten auf keinen Fall riskieren, dass er sich selbst ins Aus katapultierte. Dafür war er als Faktotum zu wichtig. So näherte man sich ihm zunehmend gefälliger, sogar etwas Respekt vortäuschend, allerdings immer in der Sorge, er könnte sich der Unsinnigkeit seines Seins bewusst werden und die Stelle wechseln. Eines Tages musste er aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Er hatte eine seltene Blutkrankheit. Nach mehrwöchigen Krankenhausaufenthalten kehrte er nicht mehr in die Firma zurück. Leon Petrollkowicz war wieder mit dem ganzen Personalunwesen befasst, scheute sich aber, erneut einen Pausenclown einzustellen. Er war wieder selbst gefordert.
Giselle Frou aus dem Zimmer von August Mohren entfernen? Wenn er August Mohren und Martin von Alzheim, seinen engsten und besten Mitarbeiter, den er vor zwei Jahren von einer Großbank abgeworben hatte, zusammensetzen würde? Aber würde man dieser Dame mit einem eigenen Zimmer dann nicht zuviel Ehre erweisen? Und Mohren und von Alzheim zusammen? Undenkbar, weil von Alzheim prestigebewusst war und zu seinem Status als Abteilungsleiter auch der Anspruch auf ein eigenes Zimmer gehörte. Oder sollte man die gesprächige Dame in das Großraumbüro setzen, wo der Schwall ihrer Worte in den schallgedämpften Sprecharchipelen versickern und keinen Protest hervorrufen würde? Oder sollte man einfach die Angelegenheit vertagen und die Dame vorsichtig ermahnen, mit ihren Talenten sparsamer umzugehen? Leon Petrollkowicz entschied sich für die letzte Lösung. Sie war halt im Augenblick die bequemste.
So war eben Leon Petrollkowicz, der an manchen Tagen, an denen seine Qualifikation als einfühlsamer Patron gefordert war, lieber auf der Straße Postkarten verkauft hätte als in der Firma nach Problemlösungen zu suchen. Nach dieser Verwaltungsarabeske schaltete er wieder auf seine eigentliche Aufgabe um, den Profit der Firma zu mehren und bereitete sich auf das Gespräch mit Louis Sinopret vor, Chef der Staatlichen Kadabra-Bank, einem bedeutenden Kreditinstitut in Nordrhein-Westfalen. Er hatte schon vor Wochen diesen Mittagstermin vereinbart, bei dem über einen Großauftrag gesprochen werden sollte. Die Bank war wegen überzogenen Kreditengagements und waghalsigen Spekulationsgeschäften in die Schlagzeilen gekommen und wollte unter anderem über eine geschickte Medienstrategie ihr Image wieder aufpolieren. Auf diesem Gebiet war die Firma von Leon Petrollkowicz Spitze, weil sie mit glaubwürdigen und niemals mit schreierischen Konzepten die Kunden bediente und manchmal sogar von größeren Kampagnen abriet, wenn gewisse Aussagen unglaubwürdig waren. Ob er Louis Sinopret eher restriktiv gegenübertreten würde, wollte er von dem Gespräch abhängig machen. Er konnte sich aber in diesem konkreten Fall durchaus vorstellen, einige interessante Geschäftsideen der Bank nach vorne zu kehren, um sie aus den negativen Schlagzeilen zu bringen. Eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe, die er aber, wie sich in den nächsten Minuten herausstellen sollte, zumindest vorerst nicht lösen durfte. Als er nämlich entspannt und gutgelaunt seine Beine auf den Tisch legte, sich eine Zigarette anzündete und die Dialektik der in der Investor-Relationsarbeit immer wieder auftretenden Ansprüche und Widersprüche reflektierte, wurde er durch einen Anruf von Martin von Alzheim aus seiner Sinnierlaune geweckt.
„Ich kann es nicht für möglich halten!“
„Was können Sie nicht für möglich halten?“
„Soweit ich es richtig verstanden habe, will die Alte, Entschuldigung, Frau Hengstenberg, Ihren Termin mit Herrn Sinopret vereiteln."
„Wie bitte?“
Martin von Alzheim konnte schon ein eigenartiger Vogel sein. Wegen des ihm angeborenen Misstrauens, das sich sogar gegen gute Freunde richtete, um so mehr gegen ihm nicht sehr gewogene Vorgesetzte, suchte er nach allen Wegen, der beargwöhnten Person auf die Schliche zu kommen. Einer davon war die Abhörtechnik. So stieg er im Falle Hengstenberg auf eine kleine Leiter in seinem Büro, die immer an der gleichen Stelle positioniert war, um zum Schein ein Buch in seiner großen Bücherwand zu suchen, in Wirklichkeit aber, um sein Ohr zwischen den Büchern an eine Stelle zu legen, wo nach einem Rohrbruch die Wand nur oberflächlich mit einer Tapete saniert war und man deshalb nach dem Wegräumen einiger Bücher die Gespräche im Nebenzimmer wenigstens bruchstückhaft belauschen konnte. Dies war natürlich ein mühsames, von Leon Petrollkowicz nicht goutiertes Unterfangen, weil er seinen Mitarbeiter nicht auf der Leiter, sondern hinter seinem Schreibtisch sehen wollte. Aber manchmal machte sich dessen Klettereifer schon bezahlt. Oft reichten wenige Worte aus dem Nebenzimmer, um sich auf ein Gespräch oder Telefonat einen Reim machen zu können. Von Alzheim hatte natürlich im Laufe der Zeit seine Bücherwandbesteigungen an gewisse äußere Umstände gekoppelt. Wenn Emma Hengstenberg ausflippte oder besonders freundlich war, wenn sie der Sekretärin zurief, zu einem wichtigen Gesprächspartner durchzustellen, wenn einer ihrer erlesenen Berater an der Außentür klingelte oder in ihrem Terminkalender vielverheißende Eintragungen mit Zeitangaben standen, dann läuteten bei ihm die Alarmglocken. Außerdem hatte er seine Seilschaften, die ihm aus Papierkörben, beiläufigen Gesprächen Schreib- oder Sprachfetzen übermittelten, die er dann auf mögliche Informationen für seinen Chef auswertete.
Im konkreten Fall gab sich von Alzheim einsilbiger als sonst. Wahrscheinlich konnte er selbst nicht glauben, was er da gehört hatte.
„Wenn ich richtig verstanden habe, hat die Dame Ihre Unterredung mit der Kreditbank abgesagt.“
Leon Petrollkowicz verspürte einen heißen Stich im Magen und schüttelte ungläubig den Kopf. „Abgesagt? Das versteht doch kein Mensch. Schließlich ist das zur Zeit unser bester potentieller Kunde.“
Von Alzheim druckste herum. „Ich hörte was von ‚zu tief ins Glas geschaut’ und ‚Sie wissen schon, wie das so ist, wenn man sich die Nacht um die Ohren schlägt’ und ‚Männer unter sich’ und so weiter.“
Leon Petrollkowicz konnte und wollte es nicht fassen. Er legte auf, steckte sich erneut eine Zigarette an und sah durch das Fenster in den wolkenverhangenen Himmel. Diese Hexe, dachte er bei sich, wird mir das wohl hoffentlich nicht antun. Er wusste, dass sie den Kontakt zu den Damen in den Vorzimmern einflussreicher Leute pflegte und auch ohne besonderen Grund hier und dort anrief, aber meistens doch nur, um für sich schön Wetter zu machen. Dass sie ihn so massiv kompromittierte, war eigentlich noch nie vorgekommen. Dafür war Emma Hengstenberg zu geschickt. Als nach einer halben Stunde rein gar nichts von irgendeiner Seite verlautete – nichts vom Sekretariat, nichts vom Empfang, nichts von seiner Kollegin – ging er zu seinem Schrank und zog sich den Mantel an, um den für das Geschäft so wichtigen Termin wahrzunehmen. Unterwegs wollte er noch von Alzheim einige Instruktionen geben, aber dazu kam es nicht mehr. Emma Hengstenberg teilt ihm auf den Gang mit, dass das Vorzimmer von Herrn Sinopret angerufen und um Aufschiebung des Termins gebeten hätte. Man würde sich rechtzeitig wieder bei ihm melden.
Leon Petrollkowicz sagte nichts. Er ging zurück in sein Zimmer und rief seinen Vertrauensmann in der Staatsbank an, einen alten Freund, den er noch aus den Tagen seines Studiums kannte. Dieser versprach sich umzuhören und wieder zurückzurufen. Tatsächlich kam nach wenigen Minuten auf seiner Direktleitung, die nur wenigen Leuten zugänglich war, der Rückruf. Sein Gewährsmann konnte nichts Konkretes erfahren. Feststand, dass der Termin abgesagt wurde, aber nicht von Seiten der Bank. Damit war für Leon Petrollkowicz klar, dass seine Gegenspielerin ihn in unerträglicher Weise kompromittiert haben musste und ihm gar keine andere Möglichkeit blieb, als ihr den Garaus zu machen. Jetzt versuchte er erst einmal über die Sekretariate den für die Firma so wichtigen Gesprächstermin zu retten. Aber der Chef der Bank hatte angeblich anders disponiert und war schon auf dem Weg zum nächsten Termin, um dann von dort aus für mehrere Tage ins Ausland zu fliegen. Natürlich erfuhr Leon Petrollkowicz nicht, was Louis Sinopret im einzelnen vorhatte, wann er zurückkommen würde, ob er überhaupt noch einmal eine Chance bekäme, den mit größeren Aufgaben befassten Vorstandsvorsitzenden persönlich zu Gesicht zu bekommen. Dafür hatte der Boss seine Stabsabteilungen. Er war schließlich für das Großkundengeschäft zuständig und musste den Kontakt zu den Spitzenleuten pflegen und nicht unbedingt zu den Dienstleistern im Umfeld seiner Bank.
Leon Petrollkowicz war in einer prekären Situation. Der Werbechef der Staatsbank war ein übler Genosse. Man munkelte, dass er zuweilen die Ausschreibungen so geschickt manipulierte, dass eben einer seiner Freunde und Helfer zum Zuge kam. Leon Petrollkowicz musste also nicht ihn, sondern den Chef der Bank überzeugen, dass er in Stil, Kreativität und Kosten den Mitbewerbern überlegen war. Dieser Weg war zunächst einmal verbaut. Seine Wut, sein Hass auf Emma Hengstenberg, war nicht mehr zu kontrollieren. Er rannte in das Zimmer seiner Kollegin, baute sich vor ihr auf und legte wutentbrannt los:
„Sie perfide Person! Was fällt Ihnen ein, mein mühsam aufgebautes Unternehmen kaputt zu machen! Was wollen Sie überhaupt hier? Wenn man Sie in der Bank nicht mehr gebrauchen kann, dann suchen Sie sich einen anderen Job, aber lassen Sie uns mit Ihren bösartigen Intrigen in Ruhe! Ihnen haben wir es zu verdanken, wenn wir den nächsten Auftrag vielleicht nicht mehr bekommen. Damit gefährden Sie die Arbeitsplätze vieler Mitarbeiter. Wie können Sie es wagen, mich quasi als Trunkenbold hinzustellen und einen meiner wichtigsten Termine platzen zu lassen? Ausgerechnet Sie, die sich jeden Morgen schon einen Whisky hinter die Binde kippt, natürlich schön kaschiert mit Orangensaft, damit es keiner merkt! Ich werde Sie wegen übler Nachrede belangen und Sie rausschmeißen!“
Emma Hengstenbergs Gesichtsfarbe änderte sich, soweit man das unter der Puderschicht überhaupt feststellen konnte, nur geringfügig, ihre eiskalten blauen Augen waren nur noch als Schlitze auszumachen, ihr Busen bebte leicht und signalisierte ihrem aufgebrachten Gegenüber, dass sie sich als Frau missverstanden fühlte.
„Woher wissen Sie? Aber egal. Ihr Ausbruch zeigt doch nur, dass ich mit meiner Entscheidung richtig lag, Sie in diesem Zustand nicht auf wichtige Kunden loszulassen. Wenn Sie nüchtern sind, können Sie sich bei mir entschuldigen. Ich habe übrigens ein Tonband laufen. Also übernehmen Sie sich nicht mit Ihren Verwünschungen.“
Auch das noch. Dieses Weib dachte strategisch, aber nur in einer Richtung. Nicht etwa, wie man das Unternehmen fördern könnte, sondern nur, wie man eigene Unzulänglichkeiten vertuschen, die Gegner desavouieren und sich bei allen Kunden und einflussreichen Personen im Lande ins rechte Licht rücken könnte. Darüber dachte sie den ganzen Tag nach. Sie spannte Stolperdrähte, und wenn der Gegner hinfiel, sorgte sie wie im Falle des letzten Auftritts dafür, dass sein Wutgeschrei für Dritte festgehalten wurde.
Leon Petrollkowicz rannte zurück in sein Zimmer. Er warf sich auf die kleine Couch in der Raucherecke, sprang aber gleich wieder hoch und lief ins Freie. Er erstickte fast vor Wut und überlegte für Sekunden, ob er nicht umkehren und diesem Weib fristlos kündigen solle. Aber er ließ den Gedanken gleich wieder fallen. Ohne das Votum der Gremien konnte er ohnehin nicht handeln, und außerdem musste er aufpassen, dass seine Aktionen ihm nicht mehr als dieser Intrigantin schadeten. Nein, er musste endlich anfangen, nicht mit der Axt, sondern mit machiavellistischen Volten die Gegnerin mit ihren Hintermännern in Schach zu halten.
Hintermänner? Fest stand, dass ihr früherer Boss, der allgewaltige Dr. Dr. h.c. Alexander Maibohm dieses Weib in seine Firma gedrückt hatte. Er wollte es, Punktum. Die Bank war nicht nur wichtigster Kunde, sondern auch Drahtzieher zu allen tatsächlichen und potentiellen Auftraggebern. Ohne sie lief gar nichts. Wenn einer in diesem Konzert mitmischen wollte, musste er die Usancen kennen und sich ihnen unterordnen. Das geringste Aufmucken, und sei es noch so berechtigt, war tödlich. Man musste im Gegenteil durch einen vorauseilenden Gehorsam die Intentionen der Auftraggeber erkennen und so tun, als hätte man immer nur ihre Ziele im Auge gehabt und immer und ewig bis zur Selbstaufgabe dazu beitragen wollen, dass sie auch in der Praxis durchgesetzt würden. Leon Petrollkowicz musste wissen, was Dr. Maibohm mit seiner Firma vorhatte. Wollte man ihm im Interesse einer übergeordneten Strategie zu Leibe rücken, dann würde er gnadenlos überrollt. Die Tatsache, dass ihm Emma Hengstenberg aufs Auge gedrückt wurde, geschah ja nicht nur zu dem Zweck, diese für gewisse Aufgaben ungeeignete Person auf ein Abstellgleis zu schieben. Er wollte die Lage mit seinen Freunden durchsprechen, um vor Überraschungen gefeit zu sein. Was ihn stutzig machte war, dass sich seine Geschäftsfreunde auffallend zurückhaltend verhielten, so als wollten sie auf keinen Fall in etwas reingezogen werden. Verschwiegen sie ihm etwas? Er hatte ein ungutes Gefühl, in dem er durch das arrogant selbstsichere Auftreten dieser Person noch bestärkt wurde.
Emma Hengstenberg führte irgendetwas im Schilde, sonst würde sie versuchen, sich zu arrangieren. Sie kämpfte aber gegen ihn, und er wusste nicht, wie er diesen Kampf gewinnen sollte. „Der Himmel stehe mir bei“, sagte er sich an diesem Vormittag und schaute in dräuende Wolkenschwaden, die Sturm und Regen ankündigten. Immer wieder das gleiche Bild: Straßenmusikanten, Passanten mit großen Einkaufs-tüten, Bettler, vorbeieilende Manager mit und ohne Handy, Frauen mit und ohne Frisur, Zeitungsverkäufer und natürlich diese Fifty-Fifty-Obdachlosen, die ihre magere Zeitung für etwas Geld an den Mann oder an die Frau bringen wollten. Warum arbeiteten diese Menschen nicht? Sie könnten doch die Bürgersteige säubern oder sich als Wachattrappen vor die Geschäfte stellen! Wer arbeitete heute überhaupt noch? Neulich hatte er gelesen, dass fünfzig Prozent der Bevölkerung die anderen fünfzig Prozent über Wasser hielten. Fifty-Fifty also. Ein Witz? Herrlich, dieser Staat. Hier verhungert keiner, aber irgendwann geht die Wirtschaft den Bach hinunter.
Was wird aus ihm? Kann er die Firma halten? Wenn nein, was macht er dann? Malen oder als Journalist arbeiten? Er las die Überschrift auf dem Blättchen des Fifty-Fifty-Verkäufers: „Künstler helfen Obdachlosen“. Leon Petrollkowicz fand es gut, dass sich viele aus dieser Szene für die Armen engagierten. Sollte er nicht auch so ein Blättchen kaufen und damit den Jungen von der Parkbank das Konto aufbessern? Er kaufte. Und in dem Augenblick, da er aus der Hosentasche einige Euro fischte und dafür das Blatt entgegennahm, erfuhr er eine weitere Demütigung. Emma Hengstenberg lief gemessenen Schrittes an ihm vorbei und quittierte mit einem unverschämten Lächeln die Aktion ihres Kollegen.
Sie grüßte nicht, sie sagte nichts, sie griente ganz einfach, so als wollte sie diesem Käufer des Fifty-Fifty-Blattes zu verstehen geben, dass er gut daran tue, sich schon mal mit diesem Milieu vertraut zu machen. So meinte jedenfalls Leon Petrollkowicz das Mienenspiel dieser Frau deuten zu müssen. En passent, versteht sich, aus den Augenwinkeln heraus, beobachtete er dieses unverschämte Weib, das von seiner unternehmerischen Aufbauleistung profitierte und ein fürstliches Gehalt einsteckte. Und wofür? Um ihn zu desavouieren, vor den Augen seines besten Kunden zu kompromittieren, ihn quasi als Säufer hinzustellen. Wohin ging sie eigentlich zu dieser Mittagsstunde? Es war nicht die normale Route zur Kantine der Cassa Nostra AG, ihrem früheren Arbeitsplatz, sondern die Richtung Parkhotel. Er folgte ihr. Warum Parkhotel? Hatte sie sich zum Schluss mit Louis Sinopret zum Essen verabredet? Aha! War es nicht denkbar, dass sie statt seiner jetzt selbst den Termin wahrnehmen wollte, um zu zeigen, dass sie es besser als er könne? Wenn ja, dann hätte er ihr vielleicht teilweise Unrecht getan. Aber letztlich war ihr Verhalten so oder so unentschuldbar, weil sie seine Würde in den Schmutz gezogen hatte und er Mühe haben würde, diese Unverschämtheit aus der Welt zu räumen.
Sie ging tatsächlich ins Parkhotel, aber dahin konnte er ihr nicht weiter folgen, ohne sich nicht zuviel zu vergeben. Er machte kehrt und marschierte die Schadowstraße hinunter zur Imbissbude, um sich dort wieder seine Kartoffel abzuholen. So ungerecht konnte die Welt sein. Der Chef holte sich eine Kartoffel und seine Angestellte, die sie formaljuristisch schließlich war, ging in das feinste Hotel, um zu lunchen und anschließend in einem separaten Raum die Modalitäten der Imagekampagne zu besprechen. Natürlich, natürlich. Oder war es doch anders?
Am Kartoffelstand stand wieder eine Frau vor ihm. Diesmal eher ein indischer Typ. Er bewunderte das farbenfrohe Gewand, er sog den Duft der Haare in sich auf. Würde gleich wieder etwas Außerplanmäßiges passieren? Aber warum immer gleich so negativ denken? Vielleicht war alles ganz anders. Frau Hengstenberg traf sich mit ihrer Mutter zum Mittagessen im Hotel, und die Lady vor ihm benahm sich völlig normal, kaufte ihre Kartoffel und verschwand.
Es kam doch anders. Die Inderin stürzte die Schar der Wartenden für lange Minuten in ein Nirwana der Ratlosigkeit. Sie wollte ihre Kartoffel mit der Scheckkarte bezahlen und wunderte sich, dass die Verkäuferin auf bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht eingestellt war. Sie rannte zum nächsten Geldautomaten. Die nunmehr verwaiste Kartoffel wurde aber nicht an Leon Petrollkowicz weiterverkauft, sondern auf die Seite gelegt, weil es die letzte Kartoffel dieser Backserie war und die Inderin betonte, dass ihr und nur ihr „dieses Mahlzeit“, wie sie sagte, zustand. Und so wartete Leon Petrollkowicz eben, bis die nächste Backserie fertig war, ohne zu murren, er war schließlich weder frauen- noch ausländerfeindlich, machte sich nur gelegentlich so seine Gedanken. An diesem Tag hatte sich wohl alles gegen ihn verschworen, aber er versuchte es einigermaßen gelassen zu nehmen. Schließlich redete er sich sogar ein, dass es ein erfolgreicher Tag gewesen sei, weil er dieser blöden Megäre im Büro endlich die Zähne gezeigt und sie damit in die Schranken gewiesen hätte. Er wollte kämpfen, koste es, was es wolle. Eines Tages würde dieses Weib sich im Staube der Straße vor ihm krümmen, um Verzeihung bitten, und er würde sie gnadenlos abweisen. Er bahnte sich einen Weg durch die Avenue der Gastarbeiter, wie er die Schadowstraße gerne nannte, und fuhr nach Hause. Per Handy gab er seinen Mitarbeitern noch einige Anweisungen.