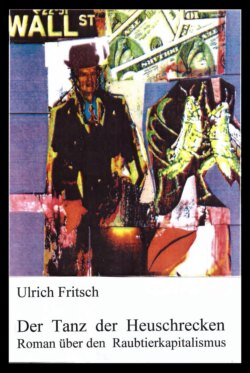Читать книгу Der Tanz der Heuschrecken - Ulrich Fritsch - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеLeon Petrollkowicz hatte in Meerbusch bei Düsseldorf ein wunderschönes Zuhause. Er wohnte in der Poststraße, keine der ganz noblen Straßen wie die Hindenburgallee, wo sich die ganz Reichen eingenistet hatten und auch Dr. Maibohm eine Prunkvilla besaß, aber in einer schönen Straße im Ortsteil Büderich. Seine Wohnung hatte über zweihundert Quadratmeter. Sie war repräsentativ, aber nicht protzig, sondern trotzig. Mit ihr wollte er zeigen, dass er es zu etwas gebracht hatte, als umsichtiger, kompetenter Unternehmer, und wenn es sein musste, sollte sein Eigentum auch Neid hervorrufen. Schließlich war er wie viele andere tüchtige Firmengründer, die sich dem harten Wind des Wettbewerbs stellten, ein Aushängeschild der Marktwirtschaft. Allen Widrigkeiten zum Trotz wollte er überleben und andere ermuntern, es ihm gleichzutun. Mit dieser Einstellung brauchte man sich seines Lebensstandards nicht zu schämen. Dazu gehörte, sich Personal zu leisten, ein edles Auto zu fahren, schöne Reisen zu machen, in gute Restaurants zu gehen, Klamotten zu kaufen, die Lebensgefährtin zu verwöhnen und seine kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen.
Leon Petrollkowicz ärgerte sich darüber, dass viele ganz anders dachten. Sie wollten herrlich leben, ohne selbst ein Risiko einzugehen. Und das Rezept lautete: Hohe Managergehälter, opulente Bonuszahlungen. Oder die andere Variante: Mehr Staat, höhere Sozialleistungen, koste es was es wolle. Aber wer sollte dies alles bezahlen? Mittelständler, die produktiv im Wirtschaftsprozess standen und die Staatskasse auffüllten, wurden für ihre Leistung nicht belohnt, sondern mit hohen Steuern bestraft. Sie waren die Buhmänner, die Kapitalisten, die in Villenvororten residierten und angeblich kein Herz für die Nöte des Volkes hatten. So, als wollten die linken Regierenden ihren Unmut über die Arroganz der Reichen auch noch akustisch zum Ausdruck bringen, donnerten die Flugzeuge im Fünfminutentakt über das Villenviertel. Leon Petrollkowicz trotzte aber all diesen Widrigkeiten.
Der Jungunternehmer dachte besonders über seine Pappenheimer in der Industrie nach. Für ihn waren die Topmanager keine Unternehmer, weil sie letztlich kein Risiko trugen. Sie verdienten Millionen, und wenn sie die Firma in den Ruin gewirtschaftet hatten, bekamen sie noch einmal einige Millionen Abfindung. Weltweit gab es diese schwarzen Schafe. Wenn Petrollkowicz einschlafen wollte, dann zählte er diese schwarzen Schäflein, und manchmal fand er auch nach Stunden noch keinen Schlaf. Wie ungerecht und kompliziert war doch diese Welt. Und er war in den Fängen der Mächtigen. Auf der einen Seite strangulierte ihn der Staat mit Steuern, auf der anderen glaubte er sich dunklen Machenschaften der Industrie und der Banken ausgesetzt. Oder sah er nur Gespenster?
Seine Lebensgefährtin Anna merkte in diesen Tagen, dass irgendetwas nicht stimmte. Ihr Partner kam ihr so verändert vor. Während er normalerweise mit Oliver, ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung, über Schule, Freizeit und Belanglosigkeiten des Alltags plauderte, war er in letzter Zeit schweigsam und zog sich öfter als gewohnt in seine Höhle, in diesem Fall in sein Arbeitszimmer, zurück. Er sinnierte, grübelte, führte Selbstgespräche, war schnell gereizt, kurzum, er war mit sich und der Welt nicht zufrieden.
Seine Lebensgefährtin litt unter dieser angespannten Konstellation, zumal Leon sich nur selten über seine beruflichen Probleme äußerte.
„Anna“, sagte er eines Tages zu ihr, „was wäre, wenn wir arm wären?“
Sie antwortete ausweichend: „Tu mir das nicht an.“
Leon hatte mit dieser Reaktion gerechnet. Sie lebte in der schönsten Kleinstadt im Umkreis von Düsseldorf, hatte viele anspruchsvolle Freundinnen, spielte gerne Bridge und Golf, manchmal auch Tennis, ging gerne auf dem großen Boulevard in Düsseldorf bummeln, kaufte sich gerne schicke Sachen, ging häufig ins Konzert oder Theater, liebte teure Restaurants und hatte einen Partner, der ihr das alles ermöglichte. Dabei war sie kein Luxusweibchen. Sie sonnte sich nicht im Wohlstand, sondern hielt dieses Leben für etwas Gottgewolltes. Gott liebte eben die Seinen und bescherte ihnen das kleine Paradies schon auf Erden. Um diesen Standard nicht für selbstverständlich zu halten, vergällte einem der Herr den einen oder anderen Tag mit vielen kleinen Widrigkeiten, die aber allesamt nur zu dem Behufe auftauchten, die schönen Seiten des Lebens noch schöner zu finden. Denn wo kein Schatten ist, ist auch kein Licht.
Anna dachte aber nicht nur an sich, sondern teilte die Sorgen ihres Partners. Was sie über diese Emma Hengstenberg gehört hatte, musste auch sie im höchsten Maß beunruhigen.
„Warum gehst du nicht wieder für ein paar Wochen nach Salzburg?“, fragte sie zwischendurch.
Anna wusste, dass sie mit diesem Vorschlag Leon auf schönere Gedanken bringen konnte. Sie hatte schon vor Jahren dafür gesorgt, dass er an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst seinem großen Talent, der Malerei, nachging. Leon war einige Male dort und war so erfolgreich, dass er daheim zunächst kleinere, dann größere Ausstellungen durchführen konnte und die Fachwelt ihn nicht ganz ignorierte. Und das hieß etwas. Schließlich interessierten sich Kunstkritiker und Galeristen schon seit Jahrzehnten nicht mehr dafür, was Qualität bedeutete, sondern nur für den Marktwert eines Künstlers. Die meisten in der Zunft verstanden ohnehin nichts von Kunst, sondern plapperten nur das nach, was die Protagonisten der Szene zu einem Tafelbild oder einer Installation, einer Stele oder einem Gipsabdruck zu sagen hatten. Wie sollten sie auch einen Pappkarton, einen Schuh, eine Fettecke oder einen onanierenden Jüngling auf einer ausgefransten Leinwand künstlerisch einordnen? Dies taten die Wissenschaftler an den Akademien und Universitäten, in den Museen und Kunstzeitschriften.
Leon war als Maler wenig bekannt, dafür verstand er aber etwas vom Marketing. Wenn er den Galeristen versprach, dass der Geldadel einer Stadt zu seiner Vernissage käme, dann öffneten sie schon mal ihre Pforten. Manche wollten das Geschäft aber gar nicht erst abwarten, sondern forderten vorab Garantien für einen Mindesterlös. Leon machte dieses Spielchen nicht mit und verwies auf die Qualität seiner Arbeiten. Einmal wurde er sogar durch einen wirklichen Fachmann bestätigt. Tobias Dominikus, Kunstkritiker aus Düsseldorf, war von seinen Bildern begeistert. Er hatte selbst Kunst studiert, war Meisterschüler von Josef Beuys und verlegte sich dann auf die Kunstkritik, weil sich keiner für seine Werke interessierte. Er schwor sich, nur auf seine innere Stimme zu hören und jeder Einflussnahme von außen zu widerstehen. Er wurde auf diese Weise nicht wohlhabend, aber angesehen, und sein Urteil hatte Gewicht. So kam es, dass Leon auch im Kunstbetrieb etwas bekannter wurde.
„Salzburg?“ Leon überlegte. Er würde sicherlich irgendwann wieder malen, zumal er großartige Ideen hatte, aber im Augenblick stand ihm nicht der Sinn danach. Er konnte in dieser Situation seine Firma keinen Tag im Stich lassen.
Anna erriet die Gedanken ihres Partners. Wenn man jahrelang fast täglich zusammen war, bedurfte es keiner verbalen Äußerungen, um die Reaktion des anderen zu erkennen. In diesem Fall reichten ein nachdenklicher Gesichtsausdruck, ein melancholischer Blick und eine defensive Körperhaltung um dem Gegenüber zu signalisieren, was man meinte. Aber Anna gab so schnell nicht auf. Sie musste ihm irgendwie helfen, damit er nicht die Bodenhaftung verlor. Sie riet ihm, seine einflussreichen Freunde anzurufen und Strategien gegen das üble Intrigenspiel seiner Gegnerin zu entwickeln. „Du musst Dr. Hüttel anrufen.“
Dr. Heinrich Hüttel, Finanzvorstand des Automobilkonzerns CAR in Braunfelden, war in der Tat sein bester Geschäftsfreund, aber eben nur Geschäftsfreund. Er lerne ihn vor Jahren kennen, als dieser noch Finanzvorstand bei der Röhren AG in Düsseldorf war. Damals tranken sie einmal die Woche Tee zusammen, nicht nur um berufliche Dinge zu besprechen, sondern auch, um sich über den Sinn des Wirtschaftens und darüber hinaus des Lebens Gedanken zu machen. Leon Petrollkowicz ging in der Vorstandsetage ein und aus, weil er Hüttel in allen Medienfragen beriet und speziell Pressefragen mit ihm besprach. Natürlich hätte sich Hüttel auf eine große Presseabteilung stützen können, aber diese war auf den Vorsitzenden eingeschworen, mit dem Hüttel nur selten konform ging, beruflich wie privat. Und dann kam es eines Tages zu einer gewaltigen Auseinandersetzung, bei der, wie konnte es anders sein, eine Frau im Mittelpunkt stand. Auch hier hatte Leon Petrollkowicz seine Hände im Spiel. Das kam so:
Vor seiner Tätigkeit als Unternehmer war Petrollkowicz Redakteur bei einer Rundfunkanstalt und lernte schnell die ganze Medienlandschaft kennen. In Wirtschaftsfragen korrespondierte er gerne mit einer Journalistin, die durch gekonnte Fernsehauftritte und durch ihre politischen und ökonomischen Sachkenntnisse in der Fachwelt geschätzt und beim breiten Publikum beliebt war. Später, als er seine eigene Firma hatte, kam Leon Petrollkowicz dieser Kontakt sehr zustatten, denn die Wirtschaft maß die Qualität einer Medienagentur nicht nur an den ausgefeilten Kampagnen, sondern auch an den guten Kontakten zu den Medien.
Diese Journalistin plante ein großes Feature zum Thema „Vermögensbildung in Krisenzeiten“. Die ersten Recherchen zeigten ihr, dass es schwierig war, mit dieser zähflüssigen Materie einen Hund hinter dem Ofen hervorzulocken. Zu oft war der kleine Mann auf die vielen Sprüche der Wirtschaftler und Politiker hereingefallen und hatte viel Geld mit Aktien und anderen Wertpapieren verloren. Andererseits brauchte die Wirtschaft Kapital und musste sehen, wie sie die Anleger mobilisieren konnte. Die Journalistin fand nicht den richtigen Zugang zu diesem Thema, aber auch Leon Petrollkowicz kannte keine Patentrezepte für die journalistische Umsetzung, wohl aber kompetente Gesprächspartner in der Industrie. Er lud seine Kollegin nach Düsseldorf ein und stellte den Kontakt zu Dr. Hüttel her. Schon beim ersten Mittagessen stellte sich heraus, dass Hüttel an Thema und Frau sehr interessiert war und lud sie zu weiteren Gesprächen ein. Leider war aber auch der Vorsitzende des Vorstands an dem gescheiten und hübschen Mädchen interessiert. Ein Balzgezetere sondergleichen erschütterte die Vorstandsetage. Der Vorsitzende machte das Rennen, und Dr. Hüttel verließ nach einiger Zeit das Unternehmen und ging nach Braunfelden, wo er Finanzvorstand bei CAR wurde.
Trotz der jetzt größeren räumlichen Entfernung war der Kontakt zwischen dem Medienfachmann und dem Finanzvorstand nie ganz abgebrochen. Leon Petrollkowicz überlegte. Er musste die nächste Gelegenheit, vielleicht schon den Neujahrsempfang des Industrieclubs in Düsseldorf nutzen, um Hüttel über die unerfreuliche Entwicklung in seinem Unternehmen zu informieren.
Leon Petrollkowicz machte sich also seine Gedanken, wie es mit seiner Firma weitergehen könnte, ließ sich aber durch die Annehmlichkeiten seines schönen Zuhauses, durch den Zuspruch seines Freundeskreises und durch interessante Gespräche in den Clubs und in diversen Gremien vielseitig ablenken. Schließlich war er wer. Nicht, weil er es unbedingt sein wollte, sondern weil er als Vorzeigeapostel der mittelständischen Wirtschaft, als Medienexperte, Künstler, Journalist über so viele Talente verfügte, dass ihn jeder gerne an die Spitze der jeweiligen Institution stellen wollte. In jenen Herbsttagen gab es eine Anhäufung an Ämtern, so dass er sich schon wie ein Großmogul fühlte und Sorge hatte, die vielen ehrenvollen Aufgaben nicht verantwortungsvoll ausfüllen zu können. Zu seinem Leidwesen brachten diese Ämter allesamt kein Geld. Und hierin unterschied er sich von den Gurus der Wirtschaft. Sie verdienten mit ihren Aufsichtsrats-und Beiratsmandaten viel Zaster und suchten sich dann noch ein paar Ehrenjobs aus, die ihnen einige Annehmlichkeiten brachten. So war Dr. Hüttel Präsident des Kuratoriums der Berliner Philharmoniker, Ehrenpräsident der Universität Heidelberg, Ehrenkonsul von Bolivien etc. Die Firma spendete, und die Topmanager profitierten: Ehrendoktor, Professor, Premierenkarten, Luxusreisen.
Leon Petrollkowicz sprach gelegentlich über Themen wie diese mit Anna. Sie teilte seine kritische Einstellung, meinte aber auch, dass er sich viel zu sehr aufreibe. Ihm fehle, wie sie sich ausdrückte, die Abgeklärtheit und Coolness eines Managers. Mehr Gelassenheit, vielleicht sogar ein Schuss Opportunismus seien besonders in schwierigen Zeiten angesagt, sonst würde man sich aufzehren und zu viele Angriffsflächen bieten.
Anna verstand diese gut gemeinten Einlassungen als ihren verbalen Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen beruflichen Kalamitäten ihres Partners. Leon gab ihr Recht, meinte aber, dass er aus seiner Haut nicht raus könne. „Mir geht es manchmal wie Tucholsky. In welcher Situation er auch war, er blieb immer kritisch und hat sich nie an irgendeinen verkauft.“
Anna sah ihren Partner fast etwas mitleidig an. „Du bist viel zu ehrlich und kritisch in deinem Job. Als du kürzlich in München vor zweitausend Anlegern einen Vortrag gehalten hast, wurden die Banker, die dich eingeladen hatten, von dir ganz schön angegriffen. Sehr klug!“
Leon hob resignierend die Schultern. „Des Brot ich ess, des Lied ich sing! Ich weiß, ich weiß. Aber ich schaff es nicht. Wir können in Deutschland doch nur dann etwas ändern, wenn einige den Mut haben, diesen Herren den Spiegel vorzuhalten. Das Verhalten der Banken dem Anleger gegenüber war nicht selten skandalös. Viele rechtschaffene Leute haben einen Teil ihres sauer ersparten Geldes verloren. Wenn wir in einigen Bereichen die Gesetze nicht ändern, wird alles noch schlimmer.“
Anna wiegte den Kopf. „Mag sein. Aber musst du dich so unklug verhalten? Als du einmal vor einem Industrie-verband einen Vortrag gehalten hast, musste denn da deine Quintessenz sein, dass die Vorstände und Aufsichtsräte in der Industrie sich so manchmal in die eigene Tasche lügen?“
„Und dabei ihr Wohl im Auge haben“, fügte Leon hinzu. „Hier ging es um die Corporate Governance in Deutschland, also darum, wie die Kontrolle über die Firmen besser funktionieren könne. Ich habe nur den unveröffentlichten Bericht einer unabhängigen Kommission zitiert. Einige von der Presse kannten den Bericht und schwiegen.“
Jetzt wurde Anna langsam wütend. „Die wissen schon, warum. Aber du musst auf die Pauke hauen, ohne an deine Firma und an uns zu denken. So unabhängig, wie du meinst, bist du nicht.“
Leon war aufgesprungen und im Zimmer wie ein eingesperrter Tiger auf und ab gegangen. „Ich weiß. Aber wenn die mich fertig machen wollen, dann hat das noch einen anderen Grund, den ich erst vor wenigen Tagen erfahren habe. Dr. Maibohm ist ja in einer Vielzahl von Aufsichts-und Beiräten und fühlt sich diesen Firmen besonders verpflichtet. In einer von diesen, ein großer Konzern in Süddeutschland, sitzt ein persönlicher Freund von ihm. Dieser Freund hat einen Schwiegersohn, der sich auf dem gleichen Gebiet versucht wie ich. Bisher ohne großen Erfolg. Das soll sich ändern und auch deshalb werde ich ausgeschaltet. Natürlich ist dieser Jemand linientreuer als ich.“
Anna fuhr erschrocken hoch. „Aber man kann doch deine renommierte Firma nicht wegen einer Personalie über die Wupper gehen lassen.“
„Der Meinung bin ich auch“, stimmte Leon ihr zu. „Aber man kann, wenn sich das Gegengeschäft lohnt. Eine Hand wäscht die andere. Dem Vorstand eines großen Konzerns ist man gerne gefällig. Ich bin für die ein Nobody, den man bei Bedarf zur Seite schiebt. Und Emma Hengstenberg hilft dabei.“
Anna lachte verbittert auf. „Das Kuckucksei in deinem Laden. Du hast ein blühendes Unternehmen, gehörst zu den Besten deiner Zunft in Europa, und da spuckt dir so einer in die Suppe. Gibt es dagegen kein Mittel?“
„Nein. Diese Leute sind zu mächtig. Sie haben ihr fein gesponnenes Netzwerk von gegenseitigen Abhängigkeiten und achten sehr darauf, dass man sich allzeit gefällig ist.“
„Und deine Kontakte zur Presse?“, wollte Anna wissen.
„Vergiss es. Die Presse heult viel zu oft auch nur mit den Wölfen. Und was kann ich denn groß vorbringen? Eine nicht ganz wasserdichte Behauptung wird von der Wirtschaft sofort mit der Androhung einer Klage vom Tisch gefegt. Diese Leute haben ganze Bataillone von Anwälten zur Verfügung. Als kleiner Michael Kohlhaas hältst du nicht lange durch.“
Anna meinte es gut mit ihren Diskursen, aber sie konnte Leon letztlich auch nicht helfen. Sie beschlich die furchtbare Angst, eines Tages ihr herrlich bequemes Leben und den Wohlstand aufgeben zu müssen. Dann sagte sie sich wieder, dass sie schließlich keinen Beamten an der Seite habe und deshalb auch das unternehmerische Risiko mittragen müsse. Aber wäre sie dazu in der Lage? Noch war ja alles einigermaßen in Ordnung und vielleicht würde sich die kleine Krise in Wohlgefallen auflösen. Schließlich gab es ja noch Dr. Hüttel und einige Gleichgesinnte, die immer auf der Seite ihres Mannes standen. Warum sollte sie sich übertrieben Gedanken machen? Wäre es nicht besser, ihren Golfbag zu nehmen und auf den Golfplatz zu gehen oder sich zu einem Einkaufsbummel auf der Kö zu verabreden oder im schönen Büderich auf der Dorfstraße spazieren zu gehen und mit den vielen Freunden und Bekannten ein Schwätzchen zu halten?
Sie wartete, bis Leon und ihr Sohn aus dem Hause waren und fuhr dann auf den nahe gelegenen Golfplatz. Zu einer kleinen Runde brauchte man sich nicht groß zu verabreden, weil immer einige Ladies aus dem Nobelstädtchen zur Stelle waren. Geschäftsleute, die gerne mal zwischendurch auf dem Golfplatz auftauchten, um in dem schönen Clublokal eine Kleinigkeit zu essen, nahmen mit Erleichterung zur Kenntnis, dass ihre besseren Hälften sich nicht zu Hause mit dem Hauslehrer ihrer Kinder befassten, sondern Sport und frische Luft genossen, um abends gestählt den häuslichen Obliegenheiten gewachsen zu sein. Die Männer verlangten als Gegenleistung für dieses Geschenk oft nur die Konzession, sich als Zweitwagen einen Porsche kaufen zu dürfen, was manchem vorzeitig Gereiften die Jugend zurückzugeben vermochte. Dem Besitzer wurden Momente des Glücks zuteil, wenn sie leicht gekrümmt in den Schalensitzen einem Geschwindigkeitsrausch erlagen. Auch daran dachten die Damen, wenn sie auf dem Golfplatz beschwingt aus ihrem Coupé sprangen. Sie rückten ihren dem Gesicht schmeichelnden Sonnenschutz zurecht, packten ihren Bag auf den Elektrokarren, wobei sie schon etwas traurig darüber waren, dass nicht ein junger lebendiger Caddy ihre Golftasche trug. Herzliche Umarmungen, lange Dialoge, denn man hatte sich ja zwei Tage nicht gesehen, und dann der Marsch zum ersten Abschlag, nach dem sich allerdings in vielen Fällen die Freude an diesem Sport relativierte. Die Suche nach den Bällen war manchmal schweißtreibend.
Anna liebte diesen Sport vor allem dann, wenn er in der Kombination mit Bridge ausgeübt wurde. Zuerst etwas Golf, dann etwas Bridge, dann lange Plaudereien, wenn es die Zeit erlaubte. Sie machten es sich schön und zeigten allen, wie sehr sie zu leben verstanden.
Über die herrlichen Erlebnisse auf dem Golfplatz sprachen Anna und Leon gerne abends vor dem Kamin. Sie ließen dann ihre Gedanken in ferne Länder streifen: Nach Portugal an die Algarve, nach Marokko, wo sie auf den Golfanlagen um Marrakesch Entspannung suchten, nach Kalifornien, Florida oder an die Costa del Sol. Dieser Blick über die Ferienparadiese, das genüssliche Wandern mit den „Swinging Clubs“ – das war Erholung und Freiheit pur. Für beide der schönste Sport der Welt, der über kurz oder lang die breite Masse in seinen Bann schlagen würde, darin war man sich einig. Dann wären allerdings die schönen Zeiten der Beschaulichkeit vorbei, weil Scharen von Freizeitclubs die Inseln der Einsamkeit überfluten würden.
Leon und Anna kannten die Perlen unter den Golfclubs und flogen, wenn es sein musste, bis ans Ende der Welt, um dort Ruhe und Entspannung zu finden. Sie hatten diesen Sport im letzten Jahr weidlich genossen und waren mehr, als es das schleppende Geschäft erlaubt hätte, der Sonne hinterher geeilt. So kam es, dass Leon eines Tages eine sonderbare Entdeckung machte. Er bemerkte an der rechten Backe unter seiner braunen Lederhaut ein kleines Geflecht von eigenartigen Punkten und Nestern, die mal hell-, mal dunkelbraun bis schwarz waren und sich wie eine Pigmentverfärbung ausnahmen. Lange Zeit war ihm diese nicht sonderlich auffällige Veränderung auf der Backe zunächst nicht ins Auge gestochen, aber mit der Zeit wurde er doch etwas unruhig, zumal auch Anna diese Stelle immer häufiger ins Visier nahm.
Der Gang zur Uniklinik sollte Klarheit verschaffen. Der Oberarzt der Hautklinik beruhigte seinen Patienten, schabte die Stelle weg und entließ ihn nach kaum einer halben Stunde mit einem kleinen Pflaster im Gesicht. Leon erschrak nicht wenig, als nach zwei Wochen der Chef der Hautklinik bei ihm zu Hause anrief und ihm mitteilte, dass er wahrscheinlich einen bösartigen Tumor hätte. Um sich Gewissheit zu verschaffen, müsse Leon Petrollkowicz erneut zur Entnahme einer größeren Probe in die Klinik kommen. Gesagt, getan. Wieder die Warterei, wieder die Ungewissheit. Diesmal kam schon nach fünf Tagen das Ergebnis des Labors. Leon hatte wiederholt angerufen, wurde in die Klinik bestellt, wartete eine halbe Stunde vor dem OP, bis der Oberarzt herauskam. Die Tatsache, dass er Leon in ein kleines Behandlungszimmer bat und nicht schon auf dem Gang den Befund erläuterte, ließ nichts Gutes ahnen. Leon wurde mit knappen Worten mitgeteilt, dass er Hautkrebs hätte. Man sei sich über Level und Dicke des Tumors nicht ganz einig und müsse deshalb schnellstens mit dem gebührenden Sicherheitsabstand die Operation vornehmen. Leon wurde für den nächsten Tag bestellt, dann aber wieder abbestellt, weil der Oberarzt zu einem Kongress nach Barcelona müsse und noch ein paar Tage Urlaub dranhängen wolle.
Man empfahl Leon einen Hautarzt in der Stadt, der Eingriffe dieser Art brillant ambulant durchführen könne. Leon wurde abermals malträtiert. Das Ergebnis war erschütternd. An der Peripherie der Schnittwunde zeigten sich, so die Histologie, gefährliche Sprengel des Haupttumors. Eine noch größere Exzision mit Transplantation in einer Krefelder Spezialklinik sei unvermeidbar. Der Tumormarker war miserabel, alles deutete auf eine Metastasierung hin. Würde Leon überleben? Er überlebte, weil er noch Glück im Unglück hatte. Eine ganze Reihe von Untersuchungen zeigte, dass der Rubikon noch nicht überschritten war. Leon wurde nach drei Wochen als vorläufig geheilt entlassen, mit einem entstellenden Narbenkranz im Gesicht, dem noch die nötige Durchblutung fehlte.
Leon war niedergeschlagen, nicht nur wegen der Krankheit. Gerade in dieser Zeit rang seine Firma nach frischem Tatendrang. Da der Chef oft gefehlt hatte und Emma Hengstenberg dem Dahindümpeln des Unternehmens tatenlos zusah, musste er alle Kräfte aufbieten, um das Steuer im letzten Augenblick noch einmal herumzureißen. Aber wie sollte das geschehen? Er hatte zwar einige Ideen, aber noch fehlte ihm der nötige Elan. Zunächst einmal war eine Kur angesagt, dann würde er mit aller Kraft versuchen, neue Aufträge zu erhalten.
Wochen gingen ins Land. Er hatte viel zur Stärkung seines Immunsystems getan und sich körperlich so weit regeneriert, dass er wieder einigermaßen einsatzfähig war und den laufenden Geschäften nachgehen konnte. So ganz war er aber nicht auf der Höhe, weil ihn der Gedanke plagte, was denn wäre, wenn er physisch, psychisch und beruflich Schiffbruch erleiden würde. Wie sollte er seine kleine Crew über Wasser halten? Was sollte er tun, wenn er körperlich wieder fit, geschäftlich aber am Ende wäre? Könnte er mit seinen journalistischen und künstlerischen Fähigkeiten sein Brot verdienen?
Immer wieder kam er ins Grübeln, und die Angst, die ihn dabei beschlich, lähmte seine Arbeitsfreude. Seine Rivalin im Büro genoss dieses labile Gleichgewicht, weil auch ohne weitere Einlassungen ihr Plan aufzugehen schien, Leon Petrollkowicz den Garaus zu machen. Warum aber diese destruktive Einstellung von Emma Hengtsenberg? Leon Petrollkowicz war sich allmählich ganz sicher, dass das Manöver gegen ihn nicht nur gestartet wurde, weil er den Herrschaften unbequem wurde, sondern weil man dem Kollegen von Maibohm einen Gefallen tun wollte.
Als weiteren Gedanken kam ihn, dass Dr. Maibohm einen Job außerhalb der Firma für Emma Hengstenberg suchte, weil Helen Laroche in seiner Gunst stieg. Vorstellbar waren verschiedene Versionen. Auch der Gedanke der Geliebtenrochade schien nicht zu weit hergeholt zu sein. „Was meinen Sie“, sagte einmal der Vorstand eines Unternehmens zu Leon Petrollkowicz, „was sich auf der obersten Etage alles abspielt. Um die Spielgefährtin zu halten, werden oft Unsummen eingesetzt und ganz neue Positionen geschaffen.“
Leon Petrollkowicz grübelte und grübelte. Er musste jetzt alles tun, um sein Geschäft über Wasser zu halten. Gesundheitlich ging es gottlob schneller als vermutet bergauf. Immer katastrophaler wurden aber die finanziellen Umstände. Leon hatte einen gewaltigen Unkostenapparat zu bewältigen und in den letzten Monaten sogar sein Privatvermögen zur Sicherung der Firmenkredite einbringen müssen. Wie würde er aus dem Würgegriff der Banken wieder raus kommen, ohne massiv Schaden zu nehmen? Noch hatte er einige Pfeile im Köcher. Besonders Dr. Hüttel durfte ihn nicht im Stich lassen. Eine PR-Kampagne für den Global Player könnte ihn mit einem Schlag von allen Nöten befreien. Dr. Hüttel hatte sich für den Neujahrsempfang des Industrieclubs in Düsseldorf angesagt, und Leon Petrollkowicz könnte ihn spätestens dort unter vier Augen sprechen. Bis dahin müsste er alle Kräfte sammeln, um die Firma wieder auf Kurs zu bringen. In dieser schwierigen Situation half ihm am meisten sein Mitarbeiter Martin von Alzheim. Sie gingen beide immer wieder die verfahrene Geschichte durch und arbeiteten an Modellen zur Krisenbewältigung. Man wollte sich mit allen Mitteln dem Schicksal entgegenstemmen.
Eines Tages klingelte es Sturm an seiner Wohnungstür. Anna öffnete, musste ein amtliches Schreiben entgegennehmen und quittieren. Sie legte es ihrem Mann auf den Schreibtisch. Als Leon Petrollkowicz abends heimkam und in sein Arbeitszimmer ging, starrte er ungläubig auf den Absender „Amtsgericht Neuss“. Er öffnete den Brief. In ihm stand lapidar, dass nach einer bestimmten Frist seine Eigentumswohnung zwangsversteigert würde.
Dies war für Leon Petrollkowicz der Anfang vom Ende. Wie konnte das passieren? Im letzten halben Jahr zeichnete sich das Fiasko zunächst überhaupt nicht ab, dann höchstens als Gewitterwolken am Horizont. Er hatte Freunde bei den Banken, in der Industrie, die immer wieder auf ihn zukamen und ihm größere oder kleinere Aufträge gaben. Man schätzte seine Expertise und seine Offenheit, die immer auch zugleich Unbestechlichkeit signalisierte. Warum hat man ihn plötzlich fallen lassen? Seitdem diese Emma wie eine bösartige Glucke um sich biss und ihn offenbar aus der Bahn zu werfen versuchte, gelang ihm nichts mehr. Und hinter dieser Frau steckte Dr. Maibohm, der irgendetwas gegen ihn im Schilde führte. Nicht aufgeben, sagte er sich immer wieder. Bald würde er Dr. Hüttel treffen. Ein einziger PR-Auftrag von CAR für seine Firma könnte alles zum Guten wenden. Dann bräuchte er nicht mehr die Bank von Maibohm und könnte die unangenehme Intrigantin endlich an die Luft setzen. Was sollte er aber machen, wenn es nicht klappte?
Leon Petrollkowicz hatte, wie gesagt, mehrere Professionen: Er war als Medienfachmann ein angesehener Mittelständler; er war Journalist und Publizist und könnte sich zur Not beim Rundfunk oder irgendeiner Zeitung verdingen. Die Zeichen der Zeit standen aber nicht für alle Branchen auf Prosperität. Eine schwache Regierung und eine schwächelnde Weltkonjunktur hatten das Land stark gebeutelt. Durch einen immer schmaler werdenden Annoncenteil gerieten viele Zeitungen zunehmend in eine Schieflage. Sie entließen Redakteure und stellten keine neuen ein. Was sollte er sich hier erhoffen?
Blieb die Kunst, die brotlose Kunst. Leon Petrollkowicz hatte die letzten zehn Jahre keinen Urlaub gemacht, sondern war an die Sommerakademie nach Salzburg gegangen. Dort hatte er mit vielen Künstlern zusammengearbeitet, gelitten und gestritten und es zu erstaunlichen Resultaten gebracht. Ausstellungen in einigen Großstädten beflügelten ihn, spülten aber kaum Geld in die Kasse. Die Sammler und Galeristen gingen, wie Petrollkowicz bei jeder sich bietenden Gelegenheit monierte, nur nach den großen Namen. Und wenn sie an diese nicht herankamen, dann mussten es zumindest Meisterschüler einer Akademie sein. Zerfließende Pinselstriche waren dann Meisterwerke, unbeholfene Männchenmalereien ein genialer Infantilismus. Zum Unglück der unsachverständigen und unvoreingenommenen Beschauer gab es immer irgendwelche Kunstkritiker, die jede Banalität in Weihrauchwolken hüllten und erst durch ihre verbale Ausdruckkraft veredelten. Hätte sich Leon Petrollkowicz ganz der Malerei widmen können, wäre er in Kombination mit seinem Marketinggeschick vielleicht zu einer gewissen Größe aufgestiegen. So aber brachte er nur Qualität, und das zählte auf dem Kunstmarkt reichlich wenig.
Womit also sein Geld verdienen? Der mittelständische Unternehmer von einst bekam plötzlich Existenzängste. Er dachte in alle Richtungen und erinnerte sich jetzt auch an seine Zeit als Redakteur bei einem Rundfunksender. Damals zermürbten ihn aber die ewigen Diskurse in den Redaktionskonferenzen und gaben schlussendlich den Ausschlag, dem Journalismus den Rücken zu kehren. Allerdings war der Sprung in die freie Wirtschaft schwieriger, als er sich das vorstellte. Von Dr. Hüttel erhielt er den ersten Auftrag. Er gewann in seiner Einzigartigkeit der verbalen Präsentation fortan fast jede Ausschreibung und konnte schon in wenigen Jahren erheblich expandieren Und jetzt das. Er kam aus dem Grübeln nicht mehr heraus und bezog seine Anna mehr und mehr in seine Gedankengänge ein.
Was ihm nur auffiel, war die deprimierende Kraftlosigkeit seiner Lieben. Sie registrierten widerwillig, dass ihr Leon nicht mehr der alte war und sie ihren üppigen Lebensstandard aufgeben mussten. Leon tröstete sich mit dem Gedanken, dass sein bester Geschäftsfreund Dr. Hüttel bald nach Düsseldorf kommen würde. Der Industrieclub hatte die ganze Prominenz aus Politik und Wirtschaft zum Neujahrsempfang eingeladen. Hier würde er ihn treffen. Ein anderer Termin war undenkbar. Leute dieses Kalibers vergaben so gut wie keine Termine an irgendwelche Bittsteller. Sie hatten Geschäfte zu machen und für die Peanuts ihre Fachidioten. Aber es gab Events, wo man sich traf. Und manchmal reichte ein kleines Tête à Tête, um wieder im Geschäft zu sein. Leon konnte auf dem Klavier der Konversation gut spielen und würde seinen Gönner bestimmt auf seine Situation einstimmen können. Aber bis dahin waren noch einige Wochen zu überbrücken.
Anna und ihr Sohn taten sich mit der neuen Situation schwer. Sie waren es so gewohnt, auf Rosen gebettet zu sein, dass man die berufliche Erschütterung des Familienoberhauptes nicht so leicht verkraften konnte. Zwar redeten sie sich ein, dass Leon das Kind letztlich schon schaukeln würde, aber die täglichen Debatten über den Schicksalsschlag und die Andeutungen über Umzug, eventuelle Berufstätigkeit der Mutter, Verkauf eines Autos, Disziplinierung beim Telefonieren, Austritt aus Golf-und Tennisclub, Einschränkung bei der Garderobe etc. etc. zermürbten und ließen vor allen bei Anna eine Welt einstürzen. Sie genoss bis dato ein Luxusleben. Das war schon außergewöhnlich. Sollte das alles zu Ende sein? Man konnte es meinen, als Anna beobachtete, wie Immobilienhaie von den Balkonen der Nachbarhäuser aus die Lage der Eigentumswohnung begutachteten. Wenn es klingelte, machte man die Tür erst dann auf, wenn man sicher ging, dass kein Gerichtsvollzieher, Banker oder Makler vor der Tür stand.
Oliver war einigermaßen gefasst. Er rechnete sich aus, dass im Falle eines Umzugs auch die Schule gewechselt würde und er dann endlich wieder einen ihm genehmen Stundenplan bekäme. So passte es ihm absolut nicht, dass seit Wochen Sport und Musik ausfielen und er stattdessen mit Mathe und Deutsch zugedeckt wurde. Er wollte Fußballer oder Musiker werden und deshalb auf seine Lieblingsfächer nicht verzichten.
Leon Petrollkowicz war mehr als bekümmert. Früher gab er seiner kleinen Lebensgemeinschaft Halt. Sie war für ihn eine Insel der Unbeschwertheit, des Miteinanders und des glücklichen Erlebens. Das lenkte ihn von seinem Alltagsstress ab und gab ihm jene Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, die letztlich der Schlüssel zu seinem souveränen Auftreten waren. Jetzt war alles anders. Das Verhältnis zu Anna und Oliver war angespannt, sein quälendes Grübeln überdeckte die an ihm so geschätzte Leichtigkeit des Umgangs mit Dritten. Er kannte das Problem: Wenn sein Umfeld merkte, dass er unsicher wurde, verschlimmerte sich seine Lage umso mehr. Er wäre dann nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte.
In seiner Firma erkannte man sehr schnell die neue Lage. Was den Mitarbeitern nur unklar blieb, war die Frage, inwieweit sie selbst von eventuellen Veränderungen betroffen wären. Da der Chef angeschlagen war und Emma Hengstenberg eine unglaubliche Siegesgewissheit ausstrahlte, bekam das Boot Schlagseite zugunsten der weiblichen Führungsriege. So jedenfalls empfanden das Außenstehende. Das Boot bewegte sich irgendwie, aber es schlingerte unter dem Gerudere der Widersacher.
Einer, der auch in dieser verfahrenen Situation auf der Seite des Chefs stand, war Martin von Alzheim. Aber auch er roch natürlich den Braten und fragte eines Tages seinen Vorgesetzten, ob er nicht eine neue Stelle für ihn wüsste. Leon Petrollkowicz verneinte. Er verstand dessen Lage nur zu gut. Schließlich hatte er selbst nach allen Seiten seine Fühler ausgestreckt und nach Alternativen zu seinem bisherigen Job gesucht. Auch jetzt telefonierte er wieder rund um die Uhr, schmiedete Kontakte und redete sich immer wieder ein, dass er es schon irgendwie schaffen würde. Das kümmerliche Ergebnis seiner Anstrengungen: Ihm wurde bedeutet, dass sein kleiner Lehrauftrag in Nischnij Nowgorod ausbaufähig sei. Aber Rettung versprach er sich nur von Dr. Hüttel. Nur mit seiner Hilfe konnte sich die Lage zum Besseren wenden. Also arrangierte Leon Petrollkowicz alles Notwendige im Industrieclub, um vor dem Neujahrsempfang wenigstens zwanzig Minuten mit seinem Gönner sprechen zu können. Er reservierte zu diesem Zweck das Henkelzimmer im zweiten Stock. Zu seiner großen Erleichterung erhielt er nach langem Warten die Bestätigung des Termins aus dem Sekretariat des Dr. Hüttel. Jetzt würde sich sicherlich alles zum Guten wenden.