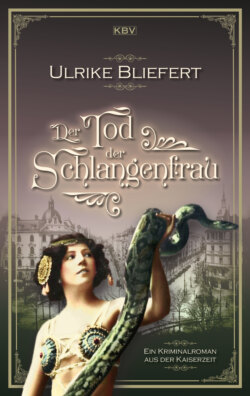Читать книгу Der Tod der Schlangenfrau - Ulrike Bliefert - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 4
ОглавлениеHe, Gustchen! A penny for your thoughts!« So wortkarg und in sich gekehrt wie an diesem Abend hatte Henrietta ihre Nichte selten erlebt. Charlotte Paulus war blutjung gewesen, im selben Alter wie Auguste. Da war es nur verständlich, dass der Tod einer Gleichaltrigen Auguste nachhaltig beschäftigte. »Wer könnte so unheimlichen Hass auf sie gehabt haben, dass er sie umbringt?«, murmelte sie, »ich meine: Was kann man als Frau schon Schlimmes anrichten?«
»Schönheit war schon immer ein Motiv für Neid und Eifersucht«, stellte Augustes Vater achselzuckend fest. »Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei den alten Griechen wegen einer schönen Frau sogar ein jahrelanger Krieg vom Zaun gebrochen worden.«
»Unsinn, Julius!« Henrietta warf klirrend ihr Messer auf den Abendbrotteller. »Das mit der schönen Helena und Troja und dem ganzen Drum und Dran hat sich der alte Homer doch bloß ausgedacht! Wahrscheinlich ging’s den Griechen in ihrem hölzernen Gaul nur um das Übliche.«
»Und das wäre?«
»Macht und Geld. Außerdem gehört Kriegführen bei euch Kerlen doch sowieso zum guten Ton.«
»Aber Charlotte Paulus war eine Frau und hatte, wie es aussieht, keinerlei Ambitionen in Bezug auf Macht und Geld«, warf Auguste ein, bevor sich ihr Vater und Tante Hattie einen längeren Schlagabtausch liefern konnten. »Ich versteh das Ganze einfach nicht.«
»Na, warten wir es erst mal ab«, lenkte Henrietta ein, »vielleicht findet dein flotter Kriminalassistent ja ganz schnell die Lösung.«
Während Auguste Tante Hatties Formulierung geflissentlich überhörte und betont ausgiebig an ihrem Schinkenbrot herumsäbelte, machte sich »ihr« Kriminalassistent auf den Weg nach Treptow: die Behrenstraße entlang mit der Elektrischen bis zum Haupteingang III der Gewerbeausstellung. Als er dort ankam, schloss diese soeben ihre Pforten, und Sigismund Brändel, der als eine Art Hausmeister für die auf dem Gelände befindliche Kolonialausstellung fungierte, empfing Wilhelmi mit einem bärbeißigen »Ick dachte schon, Sie komm’ nich mehr«.
Die »Berliner Gewerbeausstellung von 1896« – von den Veranstaltern gern als verhinderte Weltausstellung bezeichnet – war die Sensation des Jahres! Auf einem Areal von rund neunzig Hektar tummelten sich mehr als dreieinhalbtausend Aussteller. Über die üblichen Werkschauen hinaus boten sich den Besucherinnen und Besuchern etliche Restaurants und Brauhäuser zum Verweilen an, und es gab jede Menge Attraktionen wie Rundfahrten mit venezianischen Gondeln, Bartschneidenlassen bei einem »Muzajin« – einem veritablen ägyptischen Barbier – oder in die Luft gehen mit »Zekeli’s Riesen-Fesselballon«. Sogar eine Sternwarte hatte man gebaut. Allerdings hatte deren Riesenfernrohr auch vier Wochen nach der Eröffnung noch niemand zum Funktionieren gebracht. Zum pädagogisch wertvollen Amüsement gehörten außerdem die Nachbildungen deutscher Kriegsschiffe, die auf der Spree paradierten und brave kleine Matrosenanzugträger von einer Zukunft als Marineoffizier träumen ließen. Besonderer Anziehungspunkt jedoch war die »Erste Deutsche Colonialausstellung« am Treptower Karpfenteich, mit »Original-Negerdörfern« und »Straßen und Gassen in Kairo«.
Bis dorthin waren es vom Eingang III aus nur wenige Schritte, doch Sigismund Brändel führte Jakob Wilhelmi nicht wie erwartet zum entsprechenden Ausstellungsareal, sondern weiter abseits zu einer Reihe grob gezimmerter Baracken.
»Die könn’ wer leider nich in ihre Negerhütten übernachten lassen. Sterben ei’m bei dem Regen ja sonst weg wie die Fliegen, versteh’n Se?«
»Natürlich. Ich hab gehört, dass tatsächlich einer der Afrikaner vorgestern Abend gestorben ist. Völlig überraschend, hieß es.«
»Da ham Se richtig gehört. War aber nich vor Kälte, sondern war ’n Unfall. Kann jedem passieren. Aber wenn Se mich fragen, ham die hier sowieso nischt verloren: Alle naslang fällt einer wejen Dünnpfiff aus, weil die Berliner Küche nu mal nich aus Vogelfutterpampe mit Kängurukotelett besteht!«
Jakob Wilhelmi verkniff sich die Bemerkung, dass das gemeine Känguru in Afrika selten bis gar nicht anzutreffen war und von daher vermutlich auch nicht auf den entsprechenden Speisekarten anzutreffen sein dürfte.
»Versteh’n Se mir nich falsch«, schwadronierte Sigismund Brändel weiter, »aber die soll’n doch bleiben, wo der Pfeffer wächst! Meine Meinung!«
Gut, der Pfeffer ist korrekt in Afrika verortet, dachte Jakob. »Aber …«
Doch Brändel ließ ihn gar nicht erst zu Worte kommen. »Dumm, faul und unordentlich – wenn Se mich fragen! Verfressen, tückisch und verlogen! Und kaum hat einer von denen ’n bissken Hüsterken – zack! – hat er ’t uff der Brust. ’n paar von denen liegen immer flach! Und denn wird zu irgendeinem Affengott oder wat weeß ick jebetet und sich über den Karbolgeruch beschwert! So, da wär’n wer.« Brändel machte keinerlei Anstalten, Jakob weiter als bis zu dem Gatter, das den Eingang der Barackensiedlung markierte, zu begleiten. »Viel Jlück, wa?«
»Danke, Herr Brändel. Und schönen Abend noch.« Wenn Jakob angenommen hatte, den Schwätzer endlich los zu sein, dann hatte er sich getäuscht: Brändel rührte sich nicht von der Stelle. »Jawoll ja, Jlück wer’n Se brauchen, weil …«, er senkte bedeutungsvoll die Stimme, »… die Kaffern seh’n doch alle gleich aus. Und da drin sind mehr als hundert von denen. Wie Se da Ihre Verbrecher rausfinden wollen, is mir ’n Rätsel.«
»Die Herren sind keine Verbrecher, sondern Zeugen«, versetzte Jakob, doch Brändel winkte ab: »Sind doch allesamt irgendwie nich richtig im Kopp«, erklärte er und verfiel wieder in seine übliche Sprechlautstärke. »Besonders die Hottentotten. Machen hier uff feine Pinkel, versteh’n Se? Sind sich zu vornehm für nackig und Baströckchen. ›Herero- und Hottentottenkarawane‹ in Hut und Anzug? Wo jibt’s ’n so wat?«
»Das weiß ich leider nicht.« Wilhelmi zuckte mit den Schultern. »Vielleicht da, wo die Herrschaften herkommen. Waren Sie denn schon mal dort?«
»Nee.« Sigismund Brändel hatte offenbar wenig Gespür für Ironie. »Aber sich für teuer Jeld aus ihrem Kral hierherbringen lassen und denn nich mal ’n bissken nackte Haut zeigen? Wenn Se mich fragen: Da sind unsere Zuschauer mit Recht sauer!«
»Ach, sind sie das?«
»Na ja, wie man munkelt, wohl eher die Zuschauerinnen«, Brändel grinste obszön und stieß Jakob plump-vertraulich seinen Ellenbogen in die Rippen. »Manche Weiber sind ja janz verrückt nach die Wilden, weil: Die Kerle soll’n da unten rum so einijes zu bieten haben. Aber kleene braune Kinder machen is nich. Wir schicken die janze Mannschaft einmal die Woche in ’n Puff, und fertig. So!« Er stieß das Gatter auf, das die Barackensiedlung umgab. »Anschließend nur kurz klingeln, denn lass ick Ihnen raus«, und damit drehte er sich um und stapfte auf ein schmuckes kleines Blockhaus zu, das ihm während der sechs Monate, die die Ausstellung laufen sollte, offenbar als Hausmeisterwohnung diente.
Jakob näherte sich mit gemischten Gefühlen einer Gruppe von Afrikanern, die sich im Innenhof der Barackensiedlung um eine Feuerstelle scharten. Bis auf einen – offenbar der Älteste von ihnen – trugen alle europäische Kleidung. »Guten Abend!« Der doppelt geschlungene Wollschal wollte nicht so recht zu seinem Umhang aus bedrucktem Kattun passen. »Berlin ist kalt«, erklärte der Mann und deutete lächelnd auf seinen Hals. »Können wir irgendwas für Sie tun?«
»’n Abend. Danke, ja. Mein Name ist Jakob Wilhelmi, Kriminalassistent.«
»Angenehm. Natchaba, Koffi. Koffi ist der Vorname«, setzte der Schwarze lächelnd hinzu. »Wir gehören zur Togo-Truppe«, die anderen Männer nickten höflich, »morgens landestypisches Handwerk und nachmittags wilde Tänze und Kriegsspiele.«
Wilhelmi schaute betreten zu Boden. Koffi Natchaba sprach so gut wie akzentfrei Deutsch und war eindeutig alles andere als der exotische Wilde, den ganz Berlin seit Anfang Mai mit einer Mischung aus Schauder und Faszination zu begaffen pflegte.
»Verzeihen Sie die Störung, aber ich würde gerne drei …«, Wilhelmi suchte nach den richtigen Worten, »… drei … Kollegen von Ihnen sprechen. Zwei Mitglieder der ›Herero-und-Hottentotten-Karawane‹: Frans und Cornelius Morenga und einen Herrn, der offenbar nicht hier wohnt …« Wilhelmi las den ungewohnten Namen von seinem Büchlein ab: »… Aleeke Mambila.«
»Stimmt. Mambila gehört nicht zu uns. Der ist beim Auswärtigen Amt angestellt. In der Kolonialabteilung. Sitzt drüben im Verwaltungsgebäude. Nur: Da dürften Sie um die Zeit niemanden mehr antreffen. Wie ich Mambila kenne, ist der in der Oper oder im Ballett oder sonst wo unterwegs. Aber die Morenga-Brüder finden Sie gleich ein Haus weiter. Die Herren sind übrigens Nama.«
»Aha?« Jakob kratzte sich am Kinn, und auf Koffi Natchabas Gesicht breitete sich ein gutmütiges Grinsen aus. »Die Nama wegen ihrer Sprache Hottentotten zu nennen, ist etwa so höflich wie einen freundlichen Berliner Eingeborenen wie Sie wegen Ihres Riechorgans als Spitznase zu bezeichnen.«
Unwillkürlich griff Jakob an seine Nase.
Koffi lächelte immer noch. »Eindeutig … scharfkantiger als meine, was?«
»Ähm. Ja.«
»Aber Nase ist Nase, oder?«
»’türlich. Klar.« Bevor seine Verwirrung überhandnehmen konnte, verabschiedete sich Jakob und ging auf die angegebene Baracke zu. Dass ein offensichtlich hochgebildeter Schwarzer als »Wilder« auftrat und den Berlinerinnen und Berlinern irgendwelche Stammesriten vorführte, von denen er zuvor womöglich noch nie etwas gehört hatte, war mehr als irritierend. Und die Sache mit der Nase, den Nama und den Hottentotten verstand Jakob erst recht nicht.
Immerhin: Die beiden Morenga-Brüder zu finden war nicht schwer. Sie erkannten den jungen Kriminalassistenten sofort wieder und gaben mithilfe eines Dolmetschers bereitwillig Auskunft: Sie kannten Ndeschio Temba, den Hotel-Pagen, vom Sehen, denn schließlich mussten sie auf dem Weg zu den abendlichen Varietévorstellungen am Eingang des Central-Hotels vorbei. Aber darüber, wo er sich zurzeit aufhielt, konnten sie beim besten Willen keine Auskunft geben. Nach dem Darsteller, der für den verstorbenen Kollegen eingesprungen war, gefragt, zuckte der Dolmetscher mit den Achseln. »Jeder kennt hier Aleeke Mambila. Der teilt die Leute ein und setzt die Auftrittszeiten an und so weiter. Aber der wohnt natürlich nicht hier bei uns.«
Wieso das »natürlich« war, erschloss sich Jakob nicht so recht, aber offenbar bekleidete Mambila eine Stellung, die mit Privilegien verbunden war. Dass er – genauso wie die beiden Morenga-Brüder – die Kolonialausstellung als Adresse angegeben hatte, war allerdings insofern logisch, als er davon ausgehen konnte, dass Polizeibesuche nur während der normalen Arbeitszeiten zu erwarten waren.
Sigismund Brändel öffnete die Tür zu seinem Blockhaus nur einen Spalt breit, als Jakob klingelte. »Wo der Mambila wohnt, kann ich nich sagen«, brummte er. Und ansonsten solle der Herr Unterkommissar gefälligst morgen wiederkommen, weil er, Sigismund Brändel, jetzt Feierabend habe.
Mit dem mageren Ergebnis seiner Nachforschungen alles andere als zufrieden, kehrte Jakob Wilhelmi zum Alexanderplatz zurück. Für heute war auch für ihn Feierabend, und morgen würde man dann eben weitersehen.
Professor Straßmanns Obduktionsbericht war scheinbar kurz vor Dienstschluss noch auf von Barnstedts Schreibtisch gelandet. Daraus ging zweifelsfrei hervor, dass es sich beim Tod von Charlotte Paulus um einen Mordanschlag gehandelt hatte.
Jakob konnte sich angesichts der Momentaufnahme, die ihm die resolute Fotografin überlassen hatte, keinen Reim darauf machen, dass Ndeschio Temba erwiesenermaßen nicht mehr in sein Zimmer im Central-Hotel zurückgekehrt war. Auf dem bewussten Foto kniete er vor Charlotte Paulus auf dem Boden und hatte den Deckel des Schlangenkorbs in den Händen. Das hieß, er war ganz offensichtlich nicht der Täter. Doch sein Verschwinden war merkwürdig und machte ihn natürlich verdächtig.
»Strophanthin?« Max von Jadow runzelte kopfschüttelnd die Stirn. »Wieso sollte jemand einem Tingeltangel-Mädchen einen solchen Tort antun?«
Von Barnstedt zuckte mit den Schultern und winkte dem Kellner, um eine Flasche Roederer Carte Blanche zu ordern. Ein Souper im »Hiller« war das Mindeste, was er seinem alten Internatsfreund zur Begrüßung bieten musste: Schließlich war Max von Jadow erst vor ein paar Monaten aus Ost-Afrika zurückgekehrt, und es lag ganz in Kommissar von Barnstedts Interesse, dass er sich möglichst schnell wieder heimisch fühlte: Beziehungen konnte man nie genug haben, und dass sein alter Kumpel als Baron in der Adelshierarchie erheblich höher angesiedelt war als er selbst, war sicher nicht von Nachteil.
»Wir werden sehen.« Nachdem er auf von Jadows Wohl getrunken hatte, beschloss der Kommissar, ein wenig mit dem Fall, den er seit heute auf dem Schreibtisch hatte, anzugeben. »Stell dir vor: Das Mädel war schwanger! Wer weiß, vielleicht sogar von diesem Neger, der sich im Handumdreh’n verdünnisiert hat! Die beiden müssen sich gekannt haben, sonst hätten die sich nicht in dieser Negersprache miteinander unterhalten können.«
»Verstehe …« Von Jadow sah, ganz offensichtlich interessiert, von seinem Croquembouche, einer köstlichen Windbeutelpyramide, auf. »Und weiß man denn, um welche Negersprache es sich handelt? Davon gibt’s schließlich Hunderte. Wenn nicht sogar noch mehr.«
»Na, hierzulande kann dieses Kauderwelsch doch sowieso keiner unterscheiden. Und ist ja schließlich auch egal.« Von Barnstedt war nicht mehr zu bremsen. »Es ist mir einfach schleierhaft, wieso der Leichenfledderer nicht aufgeschrieben hat, ob das arme Wurm im Bauch von unserer Toten denn nun weiß war oder braun.«
»Den Schleier kann ich dir aus eigener Erfahrung lüften.« Von Jadow grinste überlegen. »Ob so ein Bankert schwarz, weiß oder braun sein wird, kann man mitunter nicht mal kurz nach der Geburt feststellen.«
»Was? Max, komm, verkohl mich nicht! Das ist jetzt nicht dein Ernst!«
»Mein voller Ernst. Weil sich die Haut manchmal erst später dunkel färbt.«
»Und woher weißt du das?«
»Glaubst du vielleicht, wir würden uns in Afrika das eine oder andere gut gebaute Negerweib entgehen lassen?« Von Jadow zwinkerte von Barnstedt zu und lachte leise. »Und wo gehobelt wird, da fallen Späne.«
Von Barnstedt ging nicht weiter darauf ein. Es war ihm peinlich, dass von Jadow offen mit Affären prahlte, obwohl er sich die schöne Sidonie geangelt hatte, den Schwarm der ganzen Oberprima. Aber von Jadow war schon damals ein verdammt gut aussehender Kerl gewesen, und keiner aus der Klasse wäre je auf die Idee gekommen, ihm bei der Werbung um die schöne Sidonie im Weg zu stehen. Dass diese Elfe ihren Mann trotz ihrer zarten Kondition ins ferne Afrika begleitet hatte, machte sie in von Barnstedts Augen zu einer wahren Heiligen. Und dass der undankbare Kerl sich dort trotzdem mit schwarzen Frauen …
»Wenn du mich fragst«, unterbrach von Jadow die Gedanken seines Gegenübers, »dann hat der Täter sich für seine Tat ein reichlich kompliziertes Mordszenario ausgedacht.«
»Wie auch immer.« Von Barnstedt war im Namen seiner Jugendliebe Sidonie verschnupft und nicht gewillt, das Thema »schwarze Konkubinen« weiterzuverfolgen.
Die Rechnung, die er eine halbe Stunde später zu begleichen hatte, war deutlich höher als geplant, und er war fest entschlossen, wenigstens das Geld für eine Droschke einzusparen und zu Fuß nach Haus zu gehen. Doch Max von Jadow ließ es sich nicht nehmen, ihn in seiner Motorkutsche heimzufahren. »Wo darf’s denn hingeh’n?«
»Kreuzberg. Fichtestraße 2«, brummte von Barnstedt. Ganz sicher, dachte er, wohnt Max in einem herrschaftlichen Haus mit allem Drum und Dran. Womöglich sogar in der Villenkolonie im Grunewald, wo nur die Allervornehmsten sich ihre Häuser bauen lassen. Seine Parterrewohnung in der Fichtestraße konnte da nicht mal im Ansatz konkurrieren, auch wenn es dort ein kleines Gärtchen gab. Dort prangte an der Wand – hinter dem vierflügeligen, hübsch verzierten Plumpsklohäuschen – ein grandioses Landschaftsbild: Da gab es eine Burg und Berge und einen Mann zu Fuß und einen Mann zu Pferde. Es hieß, es handle sich um eine Szene aus der Oper »Don Giovanni«. Das Bild erstreckte sich über die gesamte Rückseite des Nachbarhauses. Wenn Kommissar von Barnstedt sich – in sicherer Entfernung vom Toilettenhäuschen – auf seiner weiß gestrichenen Holzbank niederließ, dann dachte er sich die Berge einfach weg und träumte, seinen Feierabendschoppen in der Hand, von seinem Heimatdorf in Mecklenburg.
Der Daimler ruckelte beim Anfahren und riss von Barnstedt unsanft in die Gegenwart zurück. Der Lärm, den Max von Jadows pferdelose Kutsche auf dem Kopfsteinpflaster machte, war zwar nicht intensiver als das jedermann vertraute Hufgetrappel, doch als sie in die weniger belebten Nebenstraßen kamen, hagelte es Schimpftiraden aus den Fenstern.
»Verzieh dir bloß mit deine Rumpelkiste!«
»Den Krach brauch keener sich jefallen lassen!«
»Jenau! Die Dinger braucht keen Mensch! Die sind nur jut zum Dicketun!«
»Det sag ick ja! Und nischt dahinter!«
Von Jadow schien den Aufruhr zu genießen – bis irgendwann der Tank leer war. Die schicke, neue Motorkutsche blieb ganz einfach stehen und tat keinen Wank.
Von Barnstedt half seinem Freund, aus einer mitgeführten Kanne Treibstoff nachzufüllen. Anschließend warf er einen Blick auf seine Taschenuhr und stellte fest, dass er mit einer Pferdedroschke längst zu Hause wäre. Sein Mantelärmel war verschmutzt, und seine Hände rochen nach Benzin. Er hoffte inständig, dass diese nichtsnutzigen Motorkutschen ganz schnell aus der Mode kämen. Genauso wie Musketen und gepuderte Perücken.
Als sie am Mietshaus in der Fichtestraße ankamen, klopfte von Jadow seinem Schulfreund kräftig auf die Schulter. »Adieu, mein Lieber. Und komm bitte möglichst bald einmal zu uns.«
Von Barnstedt schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass keiner seiner Nachbarn ihn beim Aussteigen aus Max von Jadows Knatterkasten sah und sich womöglich anderntags bei ihm beschwerte. Kaum hatte er die Wohnungstüre aufgeschlossen, brach es auch schon aus ihm heraus. »Ach, weißt du, der von Jadow ist im Grunde ja kein schlechter Kerl. Und eine Mitgliedschaft in seinem noblen Herrenclub – das bedeutet: Beziehungen, von denen man als kleiner Polizeibeamter sonst nur träumen könnte. Natürlich kann er Sidonie viel eher all das bieten, was ihr zusteht. Nur, weißt du: Ich hab trotzdem niemals damit aufgehört, an sie zu denken.« Er öffnete die Tür zur Speisekammer und fand ein Restchen frische Sahne. »Na, Mullemaus, ’n kleines Leckerchen, bevor wir beide in die Heia geh’n?«