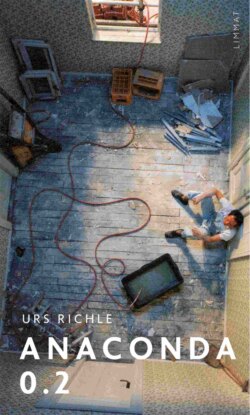Читать книгу Anaconda 0.2 - Urs Richle - Страница 6
2
ОглавлениеAls wir im Krankenhaus ankamen, war Leo bereits in den Operationssaal gebracht worden. Wir hatten Zugang bis vor die letzte Tür: Hände desinfizieren, grüner Kittel, gelbe Kappe auf den Kopf, durchsichtige Plastikhüllen über die Schuhe — Heuschrecken in einem sterilen Kühlhaus. Die Krankenschwester war freundlich und besänftigend, ließ jedoch nicht von uns ab, bis wir vorschriftsgemäss gekleidet waren. Mona war außer sich, marschierte den Korridor rauf und runter, entlud ihre Wut an einem Stuhl, am Wasserverteiler.
— Was machen die denn? Was tun sie ihm an? Ich will ihn sehen! Ich habe ein Recht darauf! David, unternimm doch was!
Was konnte ich schon tun? An die Tür klopfen? Sie öffnen? Die Sicherheitszone übertreten und einen Alarm auslösen? Und was hätte das unserem Sohn gebracht? Die Ärzte mussten wissen, was sie taten. Mona riss mir die olivgrüne Schürze vom Leib, schlug mir mit ihren beiden Fäusten auf die Brust, stieß mich rückwärts, bis ich in einen Leder bezogenen Sessel fiel.
— Warum informieren sie uns nicht? Was soll dieses Schweigen? Was ist ihm zugestoßen?
Man hatte uns nur gesagt: Herr Conda? Sind Sie Leos Vater? Ihr Sohn ... Lange Pause ... ein Unfall während der Demonstration. Das war alles, und die Adresse des Krankenhauses, der Name des behandelnden Arztes, Polane, und die Bitte, so schnell wie möglich zu kommen.
Es war mitten am Nachmittag. Ich musste ein Stück Code unfertig stehen lassen und einige Arbeitsberichte auf später verschieben, ich hätte mir einen anderen Grund gewünscht, um mich mitten am Nachmittag von der Arbeit fortzustehlen.
Ich schwang mich auf mein Fahrrad, raste durch die Stadt und erreichte das Krankenhaus vor Mona, die von zu Hause mit dem Auto losgefahren war. Und dann standen wir vor der großen Tür des Operationssaals, ohne Nachricht seit über einer Stunde. Jede Minute, die verstrich, verschlechterte den Fall unseres Sohnes, nagte an unserer Zuversicht, jede Sekunde fraß ein Stück unserer Hoffnung. Als die Krankenschwester uns vom anderen Flurende her endlich ein Zeichen machte, war von der Revolte, der Wut, dem Protest gegen die unerträglichen Umstände nur noch eine matte Erschlagenheit übriggeblieben.
— Ihr Sohn ist in ein Zimmer gebracht worden. Der Arzt möchte Sie sprechen. Bitte folgen Sie mir.
Eine einladende Geste. Noch ein Lug, noch ein Betrug. Während wir unseren Sohn vor uns hinter der Tür auf dem Operationstisch glaubten, war er in Wahrheit in diesem Labyrinth der chirurgischen Humanmechanik längst weitertransferiert worden.
— Lebt er?, fragte Mona, unfähig, sich zu erheben.
— Ja, er lebt. Kommen Sie.
Ich nahm sie unter den Armen wie ein Kind und zog sie zu mir hoch. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Das Warten hatte sie um einige Jahre altern lassen.
Der Arzt knöpfte seinen Kittel auf, streckte uns die Hand entgegen. Leo war versteckt unter den Decken und Laken, zwischen Schläuchen und Maschinen. Ich musste mich zum Kissen hinunterbeugen, um seinen Kopf zu sehen. Man hatte ihm die Haare abrasiert, ich sah Blutspuren, hörte die künstliche Beatmung, die über einen durchsichtigen Schlauch durch die Nase zugeführt wurde. Mona klammerte sich an meinen Arm.
— Wir haben unser Bestes getan, erklärte der Arzt, aber sein Zustand bleibt kritisch. Wir können nichts versprechen.
Dann erklärte uns der Chefchirurg Polane die Situation im Detail. Ich sah die Bewegungen seines Mundes, betrachtete den Berg an Kissen und Maschinen, der unser Sohn sein sollte. Die Worte des Arztes waren Nebengeräusche, Kulissen eines makabren, absurden Films.
Leo war im Koma, so viel hatten wir verstanden, eine Tatsache, gegen die weder unser Wille noch unsere Imagination etwas konnte, so wie er dalag, unter diesem weißen Kissenberg.
— Ich komme später wieder, sagte Doktor Polane noch, bevor er das Zimmer verließ, vor unserer Taubheit kapitulierend. Und dann, als er die Zimmertür hinter sich zugezogen hatte, nahm ich das regelmäßige Ticken der Maschine wahr, die Leos Herzrhythmus aufzeichnete.
— Hörst du das?
Mona hatte sich neben dem Bett auf einen Stuhl gesetzt. Wir durften die Kabel, Röhren und Schläuche nicht berühren; Haltung bewahren, sich nicht gehen lassen. Ich betrachtete dieses elektronisch angetriebene, hydraulische System und vergaß Leo dabei, als wäre er noch an der Demo, irgendwo auf der Straße mit seinen Freunden, und käme später nach Hause in die Küche an den Tisch.
— Erzähl keinen Unsinn, keine falschen Hoffnungen!
— Das sind keine falschen Hoffnungen. Sie haben ihn operiert. Schau, Mona, man sieht die Vernähung an seinem Kopf, alles wird gut werden.
Die Schnittwunden an Leos Hinterkopf entflammten Monas Verzweiflung, zerschnitten ihre Sprache.
Das Signal von Leos Herzschlag erklang in einem zügigen, konstanten Rhythmus, und wir klammerten uns an dieses einzige noch gebliebene Lebenszeichen unseres Sohnes. Wir waren allein, zum Glück, nur wir und unsere Katastrophe, die in unsere Welt eingeschlagen war.
Zwei Stunden später kam Doktor Polane zurück, und diesmal hörten wir ihm zu: Er sagte Kunststoffgeschoss, er sagte Flashball, er nahm Wörter wie Benützungsvorschriften und Waffenhersteller in den Mund. Er verwies uns auf Polizeireglemente und Bedienungsanleitungen und zitierte die Minimaldistanz von fünf Metern daraus. Die Kugel hatte Leo vorschriftsgemäß auf die Brust getroffen. Aber die Schlagkraft der Kugel war so stark gewesen, dass der Aufprall auf Leos Brust einen kurzen Herzstillstand provoziert haben musste. Für einige wenige Sekunden hatte er wohl das Bewusstsein verlor. Er fiel nach hinten, stürzte und prallte mit dem Hinterkopf auf die Bordsteinkante des Trottoirs. Der Schlag auf den Stein verursachte eine Hirnblutung. Aus diesem Grund musste notfallmäßig operiert werden.
So viel zu den Erklärungen.
— Alles hängt nun davon ab, ob die Blutung hat gestoppt werden können oder nicht und welche Bereiche des Hirns verletzt worden sind. Im Augenblick kann ich noch nichts sagen.
Doktor Polane wandte sich zur Tür, und damit ließ er uns allein.
Man brachte uns zwei Klappbetten, das Zimmer war groß genug, um uns alle drei zu beherbergen. Nadine rief an und fragte nach Leo. Sie hatte Selma von der Schule abgeholt.
— Ist was zu essen da? Kann ich uns eine Pizza holen? Wie lange muss ich Selma hüten?
Ich beschrieb ihr den Kissenberg vor uns und beruhigte sie.
— Er ist operiert worden. Alles ist gut. Mach dir keine Sorgen.
— Warum? Sollte ich mir denn Sorgen machen? Was haben sie operiert?
— Nichts, meine Liebe, nichts. Hol dir eine Pizza.
Beim Wort Pizza schrie Selma im Hintergrund auf vor Freude. Aber den Abend über riefen Nadine und Selma immer wieder an, wollten Neues wissen, wollten herkommen, wollten Leo sehen.
Die Krankenschwester stellte das Herzsignal leiser, zuerst auf null, aber Mona wollte es hören, und ich auch. Dieses kleine Geräusch beruhigte uns, das einzige Zeichen unseres Sohnes, der im Schlund von Panik und Angst verschwunden war, wir wollten es hören wie damals, als es sich auf dem Monitor des Ultraschallgerätes zum ersten Mal angekündigt hatte, unfassbar wie jetzt.
Es war um vier Uhr sechsunddreißig, ich konnte es beim Erwachen auf dem kleinen Radiowecker auf dem Nachttisch sehen, als Leos Herzschlag den Rhythmus wechselte. Mona saß auf einem Stuhl neben dem Bett.
— Wie kannst du schlafen!
— Was ist los?
Die Krankenschwester kam in zu schnellen Schritten und zu nervös ins Zimmer, als dass uns das hätte beruhigen können. Ohne ein Wort ging sie an die Maschine, tippte auf Knöpfe, druckte Resultate auf einem kassenzettelgroßen, fast durchsichtigen Papier aus, rief den Arzt um Hilfe und bat uns, vom Bett Abstand zu nehmen.
— Bleiben Sie da, bitte, man wird Sie abholen!, schnippte sie und schob das Bett mitsamt den Kissen und Schläuchen und Geräten an uns vorbei zur Tür hinaus.
— Was ist los, David? Was machen sie mit ihm?
Und schon war der Materialberg, den wir nun ganz für unseren Sohn nahmen, in den Gängen des chirurgischen Labyrinths verschwunden. Zwischen unseren beiden Klappbetten hingen Kabel da und dort herunter wie abgerissene, ausgetrocknete Nabelschnüre.
— Wo haben Sie ihn hingebracht? Was passiert mit ihm?, schrie Mona, als die Nachtschwester zurückkam, um die unnütz gewordenen Apparaturen aufzuräumen.
— Beruhigen Sie sich, Frau Conda, die Ärzte machen ihr Bestes, Ihr Sohn ist in guten Händen.
— Aber was ist mit ihm?
— Ihr Sohn hat einen Rückfall. Die Hirnblutung konnte gestoppt werden, aber sein allgemeiner Zustand hat sich verschlechtert. Sie haben wahrscheinlich auch gehört, wie sein Herzrhythmus plötzlich unregelmäßig wurde. Ich will Ihnen keine falschen Hoffnungen machen, Frau Conda, aber glauben Sie mir, Herr Polane ist ein sehr guter Arzt. Er weiß, was er zu tun hat, und er macht seine Sache sehr gut.
Sie bat uns, das Zimmer zu verlassen, ihr durch die verlassenen Gänge zu folgen, über Treppen und Lifte und weitere Flure. Sie brachte uns in ein Büro in einem anderen Gebäude, bat uns, dort wiederum zu warten, Geduld zu haben, bot uns Kaffee und Tee an, trockene Brötchen des Vortages, aber weder ich noch Mona konnte etwas anderes schlucken als Wasser, als wäre jegliche Nahrungsaufnahme ein Verrat an der Zeit, die wir hatten stillstehen lassen, als hätten wir kein Recht darauf, weiterzuleben, bevor Leo nicht wieder aus diesem Schlund der Unterwelt entkommen und nach Hause zurückgekehrt war.
Dann ließ sie uns allein in diesem von Ordnern und administrativem Kram überfüllten Raum, Formulare auf den Tischen, Ferienpostkarten an den Wänden. Die Geräusche der Schritte auf dem Linoleum draußen im Gang ließen uns regelmäßig aufschrecken. Aber niemals kamen sie bis zu uns in das Büro, niemals brachten sie Erklärungen und Lösungen. Die Ärzte hatten uns aufgegeben, die Krankenschwestern vergessen. Polane war vom Erdboden verschwunden.
Gegen halb sechs rief Nadine an, um nach Leo zu fragen.
— Ihr seid nicht mal nach Hause gekommen! Sie war um fünf aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen, wollte ins Krankenhaus kommen. Du musst Selma zur Schule bringen, und du selbst hast heute auch Kurs. Mach, was du zu machen hast!
Aber eine Stunde später, als bereits alles vorüber war, kamen die beiden trotzdem ins Krankenhaus, angetrieben vom schwesterlichen Instinkt, mit Recht befürchtend, dass man ihnen die letzte Stunde mit ihrem Bruder stehlen könnte. Sie wollten ihn sehen, wollten sein Gesicht berühren, seine Hände, seinen entspannten Mund, seine bleichen, grauen Lippen. Selma blieb wie versteinert neben dem Bett stehen. Ihr Gesicht war fahl und leer geworden. Nadine nahm Leos Hand, wie wir es vor ihr getan hatten, nachdem Herr Polane endlich gekommen war, um uns mitzuteilen, was wir bereits wussten, aber nicht wahrhaben wollten:
— Frau Conda, Herr Conda, es tut mir sehr leid, wir haben unser Möglichstes getan.