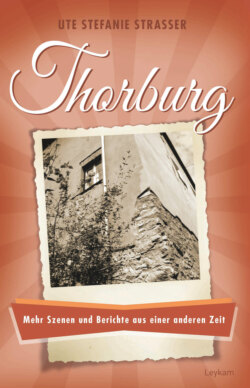Читать книгу Thorburg - Ute Stefanie Strasser - Страница 4
Zweites Kapitel Wir gehen durch die Thorburg
ОглавлениеGruselgang, eine Runde mit dem Großvater, das Gigerl, scharfer Geruch, ein Wesen, Türen knallen und da Pracka, do dastickst, Shabby Chic, Rapunzel lässt ihr Haar hinunter, und so weiter – zum Beispiel: eine falsche Blondine takelt sich auf
Die Thorburg hat vier Ebenen: die erste mit den Kellerräumen liegt auf der Höhe des Hinterhofes, von dem eine Stiege hinunter in den Garten führt, die zweite liegt auf der Höhe der Alten Straße, die dritte Ebene ist das Oberge-schoss und die vierte, das ist der Dachboden. In den Fünfzigerjahren lebten auf diesen vier Ebenen in acht Wohneinheiten auf einer Fläche von allerhöchstens150 Quadratmetern siebzehn Personen, denn noch zehn Jahre nach Ende des Krieges war Wohnraum knapp.
Jetzt nehme ich Sie, lieber Leser, an der Hand und wie ich Sie früher einmal zu den Häusern des Feenthals und kürzlich durch unsere Wohnung geführt habe, so führe ich Sie jetzt durch die Thorburg. Folgen Sie uns bitte, liebe Leser!
Wir kommen von der Straße her, steigen drei Stufen hinauf und gehen durch eine zweiflügelige Haustür – ein Flügel steht außer im Winter tagsüber immer offen – in das Vorhaus (den Flur), einen dunkeldüsteren Gruselgang, der geradeaus zum Ortgang führt, vor dem wieder eine fast immer offene Tür ist. Auf der linken Seite des Vorhauses befinden sich die Tür zum Wohnraum meiner Großeltern, der Hausbrunnen, an dem alle ihr Wasser holen, und die Stiegen hinunter zum Keller und hinauf in den Oberstock; auf der rechten Seite sind drei Türen.
Wir gehen durch die erste Tür links zu meinen Großeltern Ama und Jo, den Eltern meines Vaters. Sie wohnen in einem großen Zimmer, darin viele Möbel und Dinge stehen; es ist, wie unser Wohnzimmer, ein Multifunktionszimmer: Esszimmer Schlafzimmer Büro Empfangszimmer. Dahinter liegt noch ein Kabinett, Turmzimmer wird es mein Ehemann später nennen. Im Zentrum des Zimmers steht der Esstisch mit den vier Stühlen, der Mittelpunkt des täglichen Lebens. An ihm wird gegessen, mit Gästen geplaudert, Zeitung gelesen, Karten gespielt und dabei gestritten. Während meine Großmutter am Tisch sitzt und ein Kreuzworträtsel löst, spaziert mein Großvater gerne im Uhrzeigersinn um ihn herum. Wir werden ihn auf einer Runde begleiten und uns umschauen, was es da zu sehen gibt. (Sollte Sie das nicht interessieren, gehen Sie gleich weiter zum nächsten Absatz, zur Frau Roth gegenüber den Großeltern.)
Wir gehen an der Eingangstür los. Gleich links in der Ecke steht auf einem runden Tischchen das schwarze Telefon. Es läutet selten und es wird keinesfalls täglich benutzt. Von Zeit zu Zeit kommt ein Mieter aus dem Haus und bittet, ob er telefonieren darf. Anschließend legt er einen Schilling in eine kleine Schüssel. Das Telefon ist ein schweres schwarzes Prachtstück. Schon interessant: Die Telefone sind immer kleiner und leichter geworden, man hat sie mit Tasten ausgestattet, weil das Drehen der Drehscheibe so aufwändig, dann wurden sie schnurlos – wie praktisch! Und jetzt? Jetzt blickt manch ei-ner sehnsüchtig zurück zu den großen schweren Schwarzen oder Weißen, wie man sie in alten Kinofilmen sieht und bei Manufactum für 250,– Euro kaufen kann (Warenkatalog 28, 2015).
Nicht in jedem Haus stand ein Telefon, im Feenthal stand das einzige im Grubhof. Wenn in den umliegenden Häusern oder Bauernhöfen jemand plötzlich krank wurde oder sich verletzt hatte und man einen Arzt benötigte, musste man zum Grubhof rennen, um ihn anzurufen. Und es dauerte, bis der mit seinem Jeep oder sogar der weiße Rettungswagen, die Rettung, vorfuhr. Wie weit weg sind doch diese langsamen Zeiten vom Heute mit den allzeit verfügbaren Handys!
In den frühen Sechzigern erst bekamen meine Eltern ihr erstes Telefon – ein Vierteltelefon, es gab auch Halbtelefone. Das bedeutete, dass vier Teilnehmer bzw. zwei Teilnehmer, die sich untereinander nicht kannten und von denen jeder seine eigene Telefonnummer hatte, an einer Leitung hingen. Diese die Grundgebühr verbilligenden Sammelanschlüsse hatten den Nachteil, dass die Leitung jeweils nur von einem genutzt werden konnte; wenn einer telefonierte, war sie für die anderen besetzt. Das hätte bei einem Notfall ein Pro-blem geben können, war im Normalfall aber nicht weiter störend, denn kein Sparsamer mit einem Viertel- oder einem Halbanschluss führte lange und also teure Telefongespräche.
Jetzt gehen wir die Zimmer-Nordwand entlang, wo zwischen den beiden Fens-tern zur Straße hin die schwere Pendeluhr hängt. Freitags wird ihr Glastür-
chen geöffnet und das Uhrwerk aufgezogen, dann tickt die Uhr wieder bis zum nächsten Freitag in das Zimmer hinein. Ihr Schlagwerk wird nur an Silvester für die zwölf Schläge zur Begrüßung des Neuen Jahres in Betrieb gesetzt. Unter der Uhr steht eine dunkle Kommode mit Bett- und Tischwäsche.
In der nächsten Ecke steht ein großer Schreibtisch mit vielen Schubladen. Auf dem Schreibtisch liegen ein Atlas, ein Lexikon und ein Wörterbuch (das ist die Bibliothek meiner Großeltern), liegen Papier und Papiere, Stempel und Stempelkissen, Heftmaschine Locher Löschwiege und anderer Krimskrams. An manchen Samstagnachmittagen sitzt mein Vater an diesem Schreibtisch und erledigt Büroarbeiten für die Großeltern. Ich stehe herum und lauere darauf, ihm mit einem Stempel oder der Löschwiege zur Hand zu gehen. Die Heftmaschine überlässt er mir nur widerwillig, denn damit stelle ich mich ungeschickt an und er muss anschließend die schräg verbogene Klammer wieder entfernen, mit den Fingern, dabei sticht er sich in die Fingerkuppen.
In der nächsten Wand gibt es gleich am Anfang das Fenster nach Osten und danach stehen der Wand entlang die graue Bettbank, auf der Amas kleine Großnichten sitzen, wenn sie zu Besuch sind, und direkt im Anschluss daran das Lotterbett. Das Lotterbett hat nichts mit Lotterleben zu tun, es dient keinem Müßiggänger als Liegestatt, es dient tagsüber der Ablage von Kleidern und des Nachts meiner Großmutter zum Schlafen. Und an Ostern finde ich dort hinter einem Kissen ein Osterhasi und ein Schokolade-Ei und am sechsten Dezember finde ich dort ein Nikolausi in einem Schokolade-Stiefel.
Das Lotterbett ist bis in die dritte Zimmerecke geschoben; rechts davon ist die Eingangstür in das Kabinett, der nach Süden hin gelegenen Schlafkammer meines Großvaters. Nach dieser Tür steht ein Kleiderschrank und vor ihm steht die Singer Nähmaschine und auf der steht zu Weihnachten der Weihnachtsbaum – ja, da staunt man, wie viel auf so wenig Platz stehen kann.
Die vierte Zimmerecke wird vom hohen hellgelben Kachelofen ausgefüllt, an dessen wohlige Wärme sich Ama gerne lehnt. Rechts vom Kachelofen, an der vierten Zimmerwand (Zimmer-Westwand), hängt der runde Spiegel. Vor ihm macht der Großvater öfters eine Pause bei seiner Zimmerrunde, besichtigt sich darin, cremt sich ein, rückt sich die Pullmankappe zurecht, und jedes Jahr zu Weihnachten probiert er vor ihm seine neue auf und zupft an ihr herum, weil sie partout nicht so sitzen will wie die gute alte, die die Großmutter gerade neben ihm ins Feuer des Kachelofens schmeißt.
Rechts vom Spiegel steht eine dunkle Kredenz mit Geschirr und Gläsern drin. In ihrer Nische stehen eine rechteckige schwarze Blechdose und eine runde Porzellandose in Türkis mit Sternenmuster. Nach der Kredenz sind wir wieder bei der Eingangstür – unsere Sightseeing-Rundtour ist zu Ende, wir scheren aus. Der Großvater spaziert weiter, wie aufgezogen rundum und rundum, bis ihn die Großmutter anfaucht, dass er sich setzen soll. Er gehorcht und setzt sich.
Wir gehen weiter. Gegenüber den Großeltern wohnt in einem einzigen klei-nen Raum die blondgelockte Frau Roth mit ihrem Buben, der ist ungefähr fünf Jahre alt und hat immer kurze Hosen an. Mit den beiden wohnt der Herr Bortwisch – glattes dunkles Haar, mit Frisiercreme (Brisk) gefettet und seitlich gescheitelt; Gesichtsverzierung: kein Schnauzer und keine Bürste, sondern ein feines Oberlippenbärtchen, wie angeklebt. Wegen der verschiedenen Namen wissen wir, dass diese drei Personen als Familie nicht echt sind.
Herr Bortwisch verlässt jeden Morgen gegen neun Uhr das Haus – heller Anzug, Hut und Spazierstock. Wohin er sich begibt, wissen wir nicht. Ich sehe ihn die Alte Straße hinaufeilen und seinen Spazierstock schwingen; dieses Bild erinnert mich an den geschmeidigen Kater Bartl, von dem Marlen Haushofer erzählt, dass er, wenn er über die Straße läuft, aussieht wie ein Mann in den besten Jahren, der es eilig hat in sein Geschäft zu kommen, nur dass ihm die Aktentasche fehle. Die fehlt auch dem Herrn Bortwisch, und überhaupt – der Herr Bortwisch schaut nicht aus wie ein pflichtbewusster Büromensch. Aber wie ein ehrlicher Arbeiter schaut er auch nicht aus, finden die Frauen im Haus. Ja, sie finden ihn in seinem Aufzug ein wenig anrüchig und sie rätseln, wo er wohl den ganzen Tag herumstrawanzt, denn er kommt erst gegen Abend wieder nach Hause; und sie spekulieren, wie er sein Geld verdient, mit welchen G’schäftln, ob er überhaupt welches verdient. Hinter vorgehaltenen Händen nennen sie ihn ein Gigerl, einen eitlen Geck und einen Luftikus, und sie verdächtigen ihn, dass er auf Kosten der Frau Roth lebt. Die wiederum verdächtigen sie, dass sie älter ist als er; bestimmt ist sie das. Und bestimmt ist sie eine Kriegerswitwe und lebt mit ihrem Sohn von einer Rente und er, der Herr Bortwisch, lebt da mit. Woher kommt der eigentlich? Also ein Hiesiger ist er bestimmt nicht, so wie er redet, wenn er redet. Redet eh kaum was. Ist der überhaupt ein Österreicher?
Und sie, die Frau Roth, diese gelockte Blondine – weder die Locken noch das Blond echt, mutmaßen die Frauen –, die takelt sich auch täglich auf, putzt sich heraus und geht ebenfalls weg, gegen Mittag und mit dem Kind; die kocht nix. Wohin die wohl gehen? Dazu werden diverse Mutmaßungen ausgetauscht.
Eines Tages brachte der Herr Bortwisch einen Hund mit, eine Art Pudel, von dem Ama behauptete, dass er Tag und Nacht kläffe. Gott sei Dank zog diese unechte Familie bald nach dem Einzug des Hundes mit dem Hund aus. Jetzt zog Ama mit ihrer Küche aus dem zweiten Raum rechts, genau gegenüber dem Hausbrunnen, in dieses frei gewordene Zimmer. Der verlassene Raum bekam den Namen Alte Küche und diente fortan als allgemeine Waschküche.
Wir kommen zum dritten Raum rechts, da wohnt Katharina Fröhlich. Hinter dem wohlklingenden Namen verbirgt sich eine dürre Gestalt, die ein dunkles Kopftuch und knöchellanges Schwarz trägt. Ihrem Zimmer entströmt ein scharfer Geruch, denn die Kathi, wie sie im Haus genannt wird, ist unten nicht mehr ganz dicht; oben angeblich auch nicht. Einmal am Tag schlurft sie in Pantoffeln mit einem leeren Kübel zum Hausbrunnen und holt frisches Wasser, und einmal am Tag schlurft sie mit einem vollen Kübel durch den Gruselgang nach vorne zur Straße und entleert ihn in den Straßengraben. Unser Haus ist noch nicht kanalisiert, alle müssen ihr Schmutzwasser nach draußen leeren. Hat sie festere Bestandteile in ihrem Kübel, geht sie damit zum Plumpsklo, denn die darf frau nicht in den Straßengraben entsorgen, das weiß auch die Kathi.
Kathis Gesichtshaut ähnelt zerknittertem weißem Seidenpapier, ihre langen Zähne stechen gelblich davon ab. Wenn sie mich sieht, schenkt sie mir ein freundliches Lächeln, das bei mir als schauriges Totenkopfgrinsen ankommt. Sie freut sich, wenn sie mich sieht, aber ich gönne ihr diese Freude nicht, ich fliehe sie, wenn ich kann, oder schaue weg, wenn wir uns begegnen – Kinder sind so ohne jedes schlechte Gewissen grausam.
Einmal reichte sie mir mit ihren knochigen Fingern eine Bensdorp Schokolade, ich nahm sie mit Grausen entgegen und warf sie in den Abort. Eine arme Frau, sagte meine Mutter. Ama hielt sich die Nase zu und zog eine Grimasse, wenn die Kathi erwähnt wurde. Heute frage ich mich: Was hat diese Frau gegessen? Wer hat für sie eingekauft? Gekocht? Gewaschen? Welches Schicksal hat sie in dieses Elend und in diese Verlassenheit gebracht? Ich erinnere mich nicht, dass sie Besuch bekommen hätte. Wie alt war sie eigentlich?
Irgendwann war die Kathi plötzlich verschwunden, ob ins Krankenhaus, ins Altersheim oder schon ins Jenseits, weiß ich nicht. Ihr Zimmer direkt hinter dem Ortgang, von dem aus es durch ein Fenster einsehbar war, wurde ausgeräumt und gründlich renoviert. Ein neuer Boden wurde gelegt, Wände Tür Fenster wurden frisch gestrichen – alles neu! Und Ama zog mit ihrer Küche dorthin. Meine Mutter fand das irgendwie ungustiös und behauptete noch jahrelang, an feuchten Tagen rieche es dort nach Kathi, beziehungsweise nach ihrem … naja, muss ja nicht ausgesprochen werden.
Solange die Kathi dort gewohnt hatte, war ein Vorhang am Fenster gewesen, aber typisch: Ama machte keinen dran, es sei dort dunkel genug. Auf dem Weg zum Abort konnte man deshalb in ihre Küche hineinschauen. Wenn drinnen das Licht brannte – tat es meistens, weil: Stromsparen kennen die ja nicht –, sah man auf einem Stuhl die Lavur mit der eingeweichten Wäsche stehen – vom Einweichen ist noch keine Wäsche sauber geworden. Oder man sah den Großvater beim Geschirrabtrocknen, das kommentiert meine Mutter mit: Also, normal mocht a Mau a sou a Orbeit net, also da Vata dadat souwos nia (ihr Vater täte so etwas nie).
Nachdem Ama mit ihrer Küche zum zweiten Mal umgezogen war, wurde ihre zweite Küche, das ehemalige Roth-Bortwisch-Zimmer, ein Büro, denn meine Großeltern waren beide selbständig und Hausbesitzer. Da gab es stets irgendwelche Schreibarbeiten zu erledigen, zum Beispiel mussten für die Mie-ten, die ihnen jeweils am Monatsersten in bar übergeben wurden, Bestätigungen ausgestellt werden. Ein paar Jahre später zog ich in dieses Zimmer ein – ich sollte in Ruhe lernen können.
So, das Erdgeschoss sind wir durch. Vielleicht noch zu erwähnen ist der über den Ortgang zu erreichende Abort, einer für fast alle im Haus. Davor stehen häufig Dschrawodlerinnen, weshalb einem dort nicht die Inspirationen kommen können, von denen Tanizaki Jun’ichiro und Nabokov schreiben. Was Tanizaki Jun’ichiro schreibt, können Sie bei ihm oder in Feenthal nachlesen; Nabokov schreibt: … von dieser Ecke des Hauses aus (dem Abort) konnte man den Abendstern sehen und die Nachtigallen hören, und an diesem Ort verfasste ich meine unumarmten Schönen gewidmeten jugendlichen Verse. Ehrlich gesagt, mir kamen auf unserem Abort, auch nachts ohne Dschrawodlerinnen vor der Tür, keine Verse in den Sinn. Ich stierte traumverloren vor mich hin oder durch das Fensterchen in die Schwärze, begann zu frieren und rannte ins Bett zurück.
Übrigens, was es doch alles gibt zu dem Thema Abort. Vor einiger Zeit las ich in der Frankfurter Rundschau: Tempo sucht Deutschlands öffentliche Vorzeigetoilette. Bitte fotografieren. Einsendeschluss: 28.2.2013. Aus dem Internet toilettenpapier.tempo.net/Vorzeigetoilette erfahre ich, dass die Tempo-Jury aus den zehn meistgewählten Toiletten drei Sieger auswählen wird. Die erhalten dann eine Auszeichnung in Form einer Plakette, da steht drauf: Stilvollstes stilles Örtchen 2013. Dieser Titel wird – grammatikalisch gesehen fälschlicherweise – dreimal vergeben, und dazu erhalten die Titelträger noch je tausend Rollen des neuen 4-lagigen Tempo Klopapiers.
Dazu möchte ich anmerken: Erstens, unser Thorburg-Abort war öffentlich, nicht nur die Hausbewohner, sondern jeder, der von der Straße in großer oder kleiner Not herbeigeeilt wäre, hätte ihn und hat ihn benutzen dürfen. Zweitens, ich besaß damals schon einen Fotoapparat mit den Einstellungen Sonne und Wolke und nah und fern und hätte unseren Abort fotografieren können, zum Beispiel vom Garten her mit einem ins Bild hineinragenden Zweig. Aber leider: Wieder einmal habe ich von nichts gewusst und bin zur falschen Zeit (damals statt heute) am falschen Ort (Österreich statt Deutschland) gewesen. Dabei hätten wir uns über echtes Klopapier von der Rolle statt der harten Zeitungspapierblätter, die man immer erst lange und vorsichtig weich rubbeln musste, alle gefreut, und auch über eine glänzende Plakette. Die hätten wir außen an die Tür schrauben können, da hätte sie nächtens ein wenig geblinkt, da wäre ich nicht, wie einmal geschehen, tramhapert (verschlafen) gegen den Türstock gerannt und mit blutiger Nase zu mir gekommen. Ach ja, hättenhättenhättewäre !
Wir gehen weiter durch die Thorburg – sollen wir aufi oder obi? Gehen wir obi, die enge gewundene Holzstiege hinunter zu den Kellerräumen. Vom Keller-Vorhaus führt die hintere Haustür nach draußen in den Hof und die Kellertür nach hinten in die drei Gewölberäume ohne elektrisches Licht, mit Fußböden aus gestampfter Erde und eisernen Ringen an den Wänden, deren Zweck wir nicht mehr kennen. In diesen Räumen sind Kohlen und Erdäpfel und unser Regal mit den Vorräten in Gläsern. Rechts und links vom Vorhaus liegt noch einmal jeweils ein Raum mit einem Fenster zum Hof. Im kleineren der beiden Räume wird Holz gelagert; früher war darin Opa Rumplers Schusterwerkstätte. Dort ist er gesessen und hat die Weiße Frau vorbeihuschen sehen, und dann hat er durch das Fenster gesehen, wie sie sich draußen im Hof aufgelöst hat – ihr Fading-away hat er gesehen, ganz deutlich. An der Seitenwand des kleinen Raumes, nach Osten zum Gassl hin, gibt es ein jetzt zugemauertes Riesenfenster. Vielleicht wurden da früher einmal die kaputtenSchuhe hinein- und reparierten Schuhe hinaus- und des Schusters Lohn hinein- und das Wechselgeld hinaus- und die neuesten Neuigkeiten hinein- und hinausgereicht.
Im größeren der beiden Räume hausen Herr und Frau Steiner, ein Ehepaar. Die beiden gehen und kommen über die hintere Haustür und haben ihren eigenen romantischen Abort im Hof. Ich sehe sie selten. Wenn ich sie grüße, geben sie mir keine Antwort, schauen so komisch vor sich hin und durch mich durch. Die zwei sind mir nicht geheuer, ich drücke mich hurtig an ihnen vorbei. Der Mann, schwarzborstig und braunhäutig – a schiacha Louta, sagt meine Mutter – schaut dem Bierführer ähnlich, der Amas Gasthaus im Feenthal beliefert hat, aber er ist ein Rauchfangkehrer (Schornsteinfeger) und er lacht nie. Seine Frau trägt das glatte aschblonde Haar ganz kurz und hat auf einer Wange ein großes Feuermal. Sie übt den Beruf eines Maurers – ei-ner Maurerin aus. Wüsste man nicht, dass sie des Rauchfangkehrers Frau ist, könnte man sie für einen kleinen Mann ohne Bartwuchs halten – also auch nicht eindeutig Mann. Ein fremdartiges Wesen in Hosen, das ist sie für mich gewesen.
Diese beiden, die ich stets nur in Arbeitskleidung gesehen habe, zogen bald aus. Ihr Name blieb dem von ihnen bewohnten Raum erhalten, der hieß fortan
Steiner-Keller. Meine Großeltern und meine Eltern nutzten ihn zur Lagerung alter Möbel – als ein Mobiliendepot hinter dem Hof, unterscheide davon das Hofmobiliendepot (Wien).
Bevor wir jetzt treppauf zurückgehen, machen wir einen kurzen Abstecher in den Hof hinaus. Wir lümmeln uns aufs Geländer über der Stützmauer, an die sich ein Aprikosenbaum lehnt, und schauen in den sommerlichen Garten hinunter: Blumen, Gartenbeete mit Salat und Gemüse, Beerensträucher, Leinen für die Wäsche, ein Apfelbaum mit Tisch und Bank darunter, eine saftige Wiese – Augenweide. Wir genießen den Ausblick und die frische Luft, denn durchs Haus ziehen nicht immer frische Gerüche.
Wir gehen die Stiege wieder aufi und weiter die gleiche enge gewundene Holzstiege in den ersten Stock. Dort wohnen wir, ich und meine Eltern, und wie wir dort wohnen, habe ich schon erzählt. Uns gegenüber in zwei Räumen, der größere ist wie bei uns abgeteilt, aber bei denen nur mit einem Vorhang, wohnt die Familie Trappl: Vater, Mutter und zwei halbwüchsige Söhne, etwas älter als Hemu & Wene und ganz desinteressiert an mir. Wenn diese Buben miteinander raufen, hören wir’s poltern, und in das Holterdiepolter hinein
schreit die Mutter, droht ihnen Schläge mit dem Pracker (Teppichklopfer) an. Wenn sie tatsächlich hinhaut, erwischt sie keinen, denn vor dem mütterlichen
Schlag springen die beiden behände auseinander, und da Pracka schnalzt ins Leere. Woher ich das weiß? Vielleicht habe ich durch die halboffene Tür gespäht oder durchs Schlüsselloch oder gar durch die Wand – Kinder können so etwas. Der erzieherische Einfluss, den Frau Trappl mit ihrem Geschrei unter Zuhilfenahme des Prackers nimmt, geht also ins Leere, die Herren Söhne lassen sich durch die mütterliche Intervention immer nur kurz vom Raufen abbringen. Wenn die Buben heimkommen oder fortgehen, lassen sie die Tür beim Schließen los und geben ihr einen Schubs, da fällt sie zu und es tut ei-nen Schlag. Bei dem Schlag zucken wir, die wir gegenüber wohnen, jedes Mal zusammen. Einmal ging meinem Vater doch wirklich der Hut hoch, obwohl er gar keinen aufhatte, so krass war der Schlag gewesen. Da ist mein Vater hinübergegangen und hat den Buben gezeigt, wie sie die Tür bitte ordnungsgemäß schließen könnten. Doch auch diese Intervention, das Einschreiten meines Vaters, blieb ohne positives Ergebnis, die Buben gewöhnten sich keine leisere Türschließtechnik an. Wir waren es, die sich an die Schläge gewöhnen mussten, und an ihr Getrappel durchs Stiegenhaus, und ans Gepolter in ihrer Wohnung.
Frau Trappl ist umgänglich und eine hübsche Frau. Aber sie trägt im Haus immer so einen grauen Geschäftsmantel, wie ihn manche Verkäufer und Verkäuferinnen anhaben, und ihr langes dunkles Haar hat sie aufgeknotet und mit einem nach oben gebundenen Kopftuch bedeckt. Einmal die Woche geht sie mit ihren Fleckerlteppichen (Flickenteppichen) und dem Pracker in den Hof hinunter. Sie hängt einen Teppich über die Teppichstange und haut drauflos, dass es durch die Gärten und durch die Alte Straße knallt, und man es noch unten in der Bachgasse und oben in der Burggasse hören kann. Der Schweiß rinnt ihr übers Gesicht, immer wilder haut sie zu, ich glaube, sie denkt dabei an ihre Söhne, vielleicht nicht nur. Nachdem sie ihre drei Teppiche durchgehauen hat, ist sie ganz gelöst und dschrawodelt und lacht mit den Nachbarn.
Herr Trappl ist auf Frühschicht oder auf Nachtschicht; wenn er zu Hause ist, schläft er einen tiefen Schlaf. Wir können ihn ab und zu durch die Wand schnarchen hören. Was sein Äußeres betrifft, kann man ihn mit den Herren Egger und Pi aus dem Feenthal in eine Schachtel stecken: drei Pykniker mit Hut und mit Bart zwischen Oberlippe und Nase, und alle drei haben sie eine größere Ehefrau – einer sogar quasi zwei, beide größer als er.
Im Obergeschoss der Thorburg gibt es noch eine dritte Wohnung, sie liegt, wenn man die Treppe hochkommt, gleich geradeaus. Sie besteht wie die der unechten Familie und die der Kathi im Erdgeschoss und die der Eheleute Steiner im Kellergeschoss und die der Großtante im Dachboden aus einem einzigen Raum; wir, die Großeltern und die Familie Trappl sind im Vergleich dazu flächenmäßig privilegiert. In diesem einzigen Raum, der Küche Esszimmer Wohnzimmer Schlafzimmer Bad ist, wohnt ein kinderloses Ehepaar, der ehemalige Kleidermacher O. und seine Frau. Herr O. hat einen voluminösen Schnauzer wie mein Großonkel Peter und im Mund eine Pfeife wie mein Opa K., und wie diese beiden schmunzelt er, wenn er mich sieht.
Dieses Schmunzeln alter Männer, gibt es das heute noch? Mir kommt vor, ich habe so ein Schmunzeln und dazu den verschmitzten Blick aus meist schon ziemlich versteckten Augen lange nicht mehr gesehen. Das könnte freilich daran liegen, dass es vor allem ein Geschenk an Kinder und junge Leute ist – ich meine ganz junge Leute, nicht solche wie ich. Es könnte aber auch daran liegen, dass so ein Schmunzeln einen gelassenen Ruhezustand des Produzenten voraussetzt. Der Schmunzler sitzt oder steht oder spaziert gemächlich dahin und schaut sich um. Heute, die älteren Herren, die joggen, fahren mit dem Rad, strampeln auf dem Hometrainer, ertüchtigen sich. Da bleibt wenig Muße zum Schauen und zum Schmunzeln.
Herr O. sitzt täglich auf dem Schemel auf dem Ortgang und schmunzelt mich an. Manchmal spricht er mich an, oder er redet mit der Katze, die auf seinem Schoß schläft, oder er sagt etwas zu seiner Frau, wenn sie bei ihm vorbeikommt. Verstehen tu ich ihn nie. Seine Wörter bleiben im Schnauzer hängen und seine Artikulation ist durch die Pfeife im Mund beeinträchtigt und vermutlich auch, weil er törisch (taub) ist. Und spindeldürr ist er wie’s Schneiderlein im Märchen. Herr O. ist von seiner Frau auf den Ortgang verbannt, sie erlaubt ihm nicht oben bei ihnen zu rauchen, außerdem sitzt er ihr dort nur im Weg herum. Ihr Wohnraum hat keine fünfzehn Quadratmeter, Gott sei Dank ist er günstig, nämlich quadratisch, geschnitten. Es steht darin, was sie unbedingt brauchen: ein Herd, in dem täglich eingeheizt wird, weil frau darauf kocht, ein Tisch und zwei Stühle, ein Kasten fürs Gewand und eine Kredenz fürs Geschirr.
Einmal bekam das Ehepaar O. eine neue gebrauchte Kredenz geschenkt, sehr gut erhalten. Die Frau vom O. konnte sich aber nicht von der alten trennen, die war ja noch gut. Deshalb standen fürderhin zwei Kredenzen nebeneinander. Das ging? Ich kann es mir nicht mehr recht vorstellen, obwohl ich es mit eigenen Augen gesehen habe; nicht gesehen habe ich, was in die zweite Kredenz hineingeräumt wurde. Vielleicht Schuhe, denn einen Schuhschrank haben sie nicht, brauchen sie nicht für ihre zwei bzw. vier Paar Schuhe. Jahr-aus jahrein tragen sie hohe Schnürschuhe und zu besonderen Anlässen ihre guten Halbschuhe, die die übrige Zeit säuberlich geputzt und in Schachteln verpackt unter den Betten stehen, zumindest dort gestanden sind bis zum Einzug der zweiten Kredenz.
Das Ehepaar O. ist im Shabby Chic-Stil eingerichtet: Jedes Möbelstück ist von Hand gefertigt und hat seine eigene Geschichte. Und weil nichts so richtig zusammenpasst, passt es wieder – sie haben’s gemütlich; und schlank, wie sie sind, können sie die engen Pfade durch ihre Möbellandschaft begehen ohne anzuecken.
Bücher? Haben sie Bücher? Bestimmt, mindestens drei: ein Gebetbuch, denn die Frau vom O. ist eine emsige Kirchengängerin, ein Doktorbuch, Der Hausarzt oder so ähnlich, und ein Kochbuch. Letzteres hat die Frau vom O. zur Hochzeit geschenkt bekommen und ungefähr einmal im Jahr schaut sie hinein. Zusätzlich, als Lesestoff für abends im Bett, hat sie die Romanheftchen, die ihr Nachbarinnen schenken; und regelmäßig lesen sie und ihr Gatte die Wochenschau – immer die von der Vorwoche, die meine Großmutter an sie weitergibt.
Das Ehepaar O. hat auch ein Kind – ein Katzenkind, die graue Murli. Dass du dich an den Namen noch erinnerst!, wundert sich meine Freundin Margret. Aber das ist nicht schwer, denn viele Katzen hießen damals so, oder so ähnlich. Die Murli hat ihr Milchschüsserl im Vorhaus. Streicheln lässt sie sich nicht von mir, sie flieht mich, wie ich die Kathi – so gleicht sich alles aus im Leben. In die hintere Haustür ist eine Luke geschnitten, durch die kann sie kommen und gehen, wie es ihr beliebt. Nachts ist sie unterwegs, auf der Jagd nach Mäusen im Keller und in den Gärten; erwischt sie gegen Morgen einen Vogel, wird sie von meiner Mutter als Kanaille beschimpft. Wenn es ihr draußen zu kalt oder zu nass ist oder es ihr aus anderen Gründen nicht mehr passt, stellt sie sich vor die Tür ihrer Eltern und fordert jämmerlich maunzend Einlass. Dann schimpft sie mein Vater ein Mistviech. Tagsüber schläft das Murli-Mistvieh gern auf dem Schoß vom Herrn O. oder im Ehebett.
Einmal, die Frau vom O. war bereits die Witwe vom O., da schlug ihr meine Mutter bei einem Plausch am Ortgang vor, das zweite Bett doch wegzugeben, damit sie mehr Platz hätte. Nein, sagte die Witwe vom O., unmöglich, das zweite Bett brauche sie für ihren Mittagsschlaf. Das hörte sich für meine Mutter zu verrückt an und sie fragte nach. Ja, wegen der Katze, die sei es gewöhnt, um die Mittagszeit in einem Bett zu schlafen, und wenn sie nur mehr ein Bett hätte, könnte sie sich für ihren Mittagsschlaf nicht mehr lang legen.
Die Frau vom O. war bestimmt um die zwanzig Jahre jünger als ihr Mann. Wahrscheinlich war sie nicht wesentlich älter als meine Mutter, doch wirkte sie viel schwerfälliger, denn sie hatte ein komisches Gstöi (Gestell/Körperbau); allerdings war es anders komisch als das meiner Großmutter Ama.
Es ist ja so (ganz frei nach Tolstoi): Alle schönen Menschen ähneln einander (sieht man von Haar- und Augenfarben ab), jeder Nichtschöne ist dagegen auf seine eigene, ganz persönliche Art nicht schön. Schönheit liegt in einem vom Zeitgeist akzentuierten Ebenmaß, die Kategorie des Schönen ist schmal, Abweichungen davon gibt es viele. Im wirklichen Leben kann uns menschliche Schönheit faszinieren – erzählerisch gesehen gibt sie viel weniger her als Nichtschönheit.
Wie sah nun der Frau vom O. ihr komisches Gstöi aus? Sie hatte nicht Amas dünne Beine, mit denen sie geschäftig dahinschritt, sondern kräftige, die sie gemächlich am Boden entlangzog; sie hatte nicht Amas breite Hüften, sondern eher schmale, obzwar seitlich hoch aufgepolstert, und sie hatte nicht Amas zierlichen Oberkörper, sondern einen eher dominanten; und ihre besondere Besonderheit war ein imposanter Busen, der, bereits altersgerecht gesenkt, ihre Vorderfront dominierte. Ba dera, sagte mein Vater, ba dera – do dastickst (bei der, da erstickst du; nebenbei bemerkt: der Steirer verwendet statt der Vorsilbe er gern die Vorsilbe da – dasticken statt ersticken, dawortn statt erwarten, daschlogn statt erschlagen). Er meinte damit, dass man, würde man von einer so vollbusigen Frau herzlich umarmt und gedrückt, dass man dann, wenn’s dumm zuginge, mit Nase und Mund in die Furche zwischen ihre Brüste (die Alan Bennett als Elfjähriger für eine pektorale Vagina hielt) geraten könnte, und dass man, dadurch am Atmen behindert, womöglich der Gefahr des Erstickens ausgesetzt wäre. Meine Mutter spielte auf die reife Schwere des nachbarlichen Busens an, indem sie uns vorspielte, wie ihr die Frau vom O. einmal Verdauungsprobleme geschildert hatte. Meine Mutter stand auf, ließ ihre flache Hand um den Nabel kreisen und sagte, die leise raue Stimme der Frau vom O. nachahmend, es täte ihr da unter der Brust so weh.
Die Frau vom O. hat ihren Stolz, sie lässt sich nichts schenken, außer alten Zeitungen und Romanheftchen, die nimmt sie gerne. Einmal schenkte ihr meine Mutter Winterstiefel, weil sie sich selbst neue gekauft hatte, modernere. Doch die alten waren noch gut, zu schade zum Wegwerfen. Die Frau vom O. hat sie angenommen, gesehen haben wir sie nie an ihren Füßen. Vielleicht hat sie sie in eine Schachtel gepackt und unter das Bett oder in die Kredenz gestellt, falls sie sie doch einmal braucht. Meine Mutter hat das gestiert (geärgert), dass sie diese noch guten Stiefel nicht trug. Wenn sie das vorher gewusst hätte, hätte sie sie behalten, denn für Schiach wären sie noch lang gut gewesen.
Wenn meine Mutter am Freitag eine Mehlspeis (Kuchen) backte und der Frau vom O. zwei Stück davon anbot, sagte die Neindanke, sie könne selbst backen. Hin und wieder hängte ihr meine Mutter zwei Stück Gugelhupf oder Ähnliches in einem Sackerl (Tüte) an die Türschnalle (Türklinke), die Frau vom O. hängte es zurück an unsere Tür. Und wenn meine Mutter Pech hatte, war sie noch dazu pikiert. Das äußerte sie, indem sie meiner Mutter aus dem Weg ging und wegschaute, wenn die beiden sich trotzdem begegneten. Es dauerte, bis meine Mutter endlich begriff, dass ihre gut gemeinten Gaben als beleidigende Almosen aufgefasst wurden. Bemerkenswert ist, dass meine Mutter nie auf die Idee kam, das Ehepaar O. zu uns einzuladen, was aus meiner heutigen Perspektive naheliegend gewesen wäre, wenn man jahrelang so nah bei-
einander wohnt. Das kam aber nicht in Frage, denn das Ehepaar O., das wa-ren fremde Leute und anders geartet als wir. Und kommen würden sie eh nicht, weil sie sich ja nicht mit einer Gegeneinladung revanchieren könnten, allein aus Platzgründen nicht. Auch später, als die Frau vom O. schon seine Witwe war, wurde sie nie zu uns gebeten; schon gar nicht an Weihnachten – denn Weihnachten ist ein Familienfest.
Der Haushalt der Frau vom O. ist klein und schnell getan, weshalb sie bereitwillig Putz- und Gartenarbeiten für Ama erledigt. Und Ama schickt sie gern einkaufen, denn Großvater Jo, der willig, wenn auch nicht freiwillig, Küchendienst verrichtet, verhält sich beim Einkaufen störrisch. Er kommt lange nicht zurück und dann bringt er das Falsche mit, statt einem Kilo
Äpfel zwei Kilo Birnen, statt der Glühbirne eine neue Nachttischlampe, statt Semmeln dunkles Brot. Plausible Begründungen für sein langes Ausbleiben und seine etwas anderen Einkäufe hat er, aber Ama will frische Semmeln und kein Schwarzbrot, auch wenn er dessen Kauf begründen kann. Die Frau vom O. erledigt die Einkäufe schneller und bringt nicht nur genau das Verlangte, sondern auch Neuigkeiten aus der Stadt mit. In ihr hat Ama ein billiges Dienstmädchen gefunden, nach ihr hören wir sie regelmäßig durchs Haus rufen. Sie rief freilich nicht Frau O., sie rief selbstverständlich deren vollen Namen, den ich an dieser Stelle verrate, denn er ist so schön passend im Sinne des nomen est omen. Frau Orthelfer!, rief Ama nach ihrer Helferin. Laut rief sie es von unten nach oben und rief noch dazu, sie möge doch kurz kommen. Und die Frau Orthelfer öffnete oben ihre Tür und rief: I kumm glei!
Meine Mutter fand diese Hin-und-Her-Schreierei unmöglich – kein Benehmen habe meine Großmutter, ihre Schwiegermutter; die Frau Keidel, mei-ner Mutter Ex-Arbeitgeberin in Wien, hätte so etwas nie – niemals gemacht. Überhaupt gebärde sich Ama immer so laut im Haus. Nachdem sie mit ihrer Küche in Kathis Zimmer hinter dem Ortgang umgezogen ist, hören wir sie häufig durch den langen Flur hin und her stöckeln (sie trägt schwarze halbhohe Stöckelschuhe mit Schnürsenkel), und alle paar Tage ruft sie dabei laut und in für sie ungewöhnlich hoher Tonlage Hatschi. Sie muss niesen. Sie tut es in Serie und mit Genuss, einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg, oder sie niest zweimal auf dem Hinweg und keinmal auf dem Rückweg, oder dreimal auf dem Hinweg und noch einmal – ich hör schon auf. Es ist meiner Mutter ein Rätsel, warum die gerade immer im Flur niesen muss, und es
ärgert sie. Ich glaube, die Hausgespenster hat es auch geärgert und sie haben sich wegen des forschen Taktak-Gestöckels und der herzhaften Hatschis meiner
Großmutter aus dem dunklen Vorhaus, diesem Gruselgang, in den noch dunkleren Keller zurückgezogen.
Wenn Ama also nach der Frau Orthelfer schrie, empörte sich meine Mutter: Wos wü sie denn jetz scho wieda von da Orthöferin? Wenn man Frauen nachnamentlich erwähnte, hängte man oft ein In an – ganz modern, oder? Man sagte nicht, gestern habe man die Frau Pichler gesehen, sondern gestern habe man die Pichlerin gesehen. Und so nannten meine Mutter und Ama die Frau vom O. familienintern die Orthöferin; aus der Helferin wurde auf Steirisch eine Höferin, wodurch das nomen es omen nicht mehr stimmt.
Die Orthelferin steht gern am Ortgang, lieber noch steht sie vor der Haustür an der Alten Straße. Sie steht da und schaut, wer vorbeigeht. Sie freut sich, wenn sie angesprochen wird und ein wenig Unterhaltung hat – was Neues erfährt. Neuigkeiten schnappt sie außer beim Einkaufen auch bei ihren Kirchgängen auf, vor der Kirchentür, versteht sich. Sie weiß Bescheid über Hochzeiten Schwangerschaften Geburten Unfälle Todesfälle Begräbnisse, und sie erzählt alles meiner Großmutter und meiner Mutter weiter, sie ist unsere Lokalreporterin. Was die Schwangerschaften und die Geburten betrifft, interessieren besonders die unehelichen. Und von denen sind wiederum diejenigen am interessantesten, bei denen der Vater des erwarteten oder schon vorhandenen Kindes nicht bekannt ist. Da darf spekuliert werden nach Herzenslust. Und wenn es gelingt, den Verdacht auf einen biederen Familienvater aus unserer kleinen Stadt zu lenken, wird es wirklich aufregend, der Verdächtigte und seine Ehefrau werden gründlich durchgehechelt. Ein Dschrawodln im Sinne eines Konsensplauschs ist das nicht, mehr ein Tratschen, bei dem die Meinungen geteilt sind und bleiben.
Wenn mein Vater am Nachmittag heimkommt und sich zum aufgewärmten Mittagessen setzt, setzt sich meine Mutter zu ihm und erzählt: Stöi da vur, wos ma die Orthöferin dazöit hot: Die Putzi Meier – keinnst eh –, dei hot a Kind kriagt! Und stöi da vur, wos die Leit reidn: Da – sie schaut zu mir und flüstert ihm einen Namen zu –, der sui da Vota sein. Na, deis glab I oba net! (Übersetzung:
Stell Dir vor, was mir die Orthelferin erzählt hat: Die Putzi Meier hat ein Kind gekriegt. Und stell Dir vor, was die Leute reden: Der … soll der Vater sein. Das glaub ich aber nicht!) Mein Vater hört sich das an und kommentiert es mit: Jojo, die Leit reidn vü. Die Leute reden viel, das Thema uneheliche Kin-der ist nicht so sein Interessensgebiet. Meine Mutter lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, sie ergeht sich jetzt im Aufzählen von Argumenten gegen die Annahme einer Vaterschaft des von den Leuten verdächtigten Herrn und sie ergeht sich weiter in Spekulationen über Alternativen. Mein Vater schaut in die Gegend, kaut sein Essen, denkt an dies und das und dann und wann wirft er meiner eifrigen Mutter ein A-geh-a-sou-a-Bledsinn! (Blödsinn!) entgegen. Oder er bemerkt, wenn sich meine Mutter zu sehr ereifert, dass das alles, gemessen an den Dimensionen des Universums, doch völlig unwichtig sei. Diesen Vergleich brachte er öfters einmal, daran habe ich mich erinnert, als ich den Buchtitel las: Letztendlich sind wir dem Universum egal.
Oje, jetzt bin ich von unserer Gerüchteküche bis ins Universum gekommen und war doch noch gar nicht fertig mit der Führung durch die Thorburg. Her mit dem roten Faden und weiter geht’s!
Wir verlassen den Oberstock, wo wir so lange hängen geblieben sind, und gehen über eine gerade Treppe nach oben in die vierte Ebene des Hauses, in den Dachboden mit den Wäscheleinen. Gleich nach der Treppe steht rechts an die Giebelwand des Hauses gebaut ein Holzhäuschen mit Flachdach, eine hölzerne Schachtel. Darin befindet sich ein Dachstübchen, in das irgendwann Amas verwitwete Schwester, meine Großtante Mitzi, und ihre etwa dreizehnjährige Tochter Mitzi eingezogen sind, und zwar aus dem gleichen Grund, weshalb des Großvaters Bruder damals mit seiner Familie ins Weiße Haus im Feenthal eingezogen ist. Auch die alte und die junge Mitzi befanden sich in einer wirtschaftlichen Notlage. In diesem Fall war es kein Blitzschlag in eine Kuhherde, sondern der Tod des Ehemannes – ein liederlicher Trinker, der die Tante mittellos zurückgelassen.
Die junge Mitzi geht noch zur Schule. Sie hat braunes Haar von der Farbe frischer Rosskastanien, das ihr bis zu den Oberschenkeln reicht. Sie hat es in zwei dicke Zöpfe geflochten, die sie über die Schultern nach vorne legt und mir zum Spaß miteinander verknotet. Hochstecken kann sie das Haar nicht, dazu ist es zu schwer. Alle vier bis acht Wochen wird es gewaschen, an einem Sonntagvormittag, damit es vor dem Schlafengehen trocknen kann, das ist vor allem im Winter wichtig. Meine Mutter hilft der Großtante bei dieser Arbeit. Ich will auch helfen, aber es heißt: Geh, geh dauni! Und lieber aufpassen soll ich, dass ich nicht nass werde. Ama ist auch mit von der Partie, sie und ich, wir sitzen auf dem einzigen Bett im Raum und schauen zu. Setzen Sie sich zu uns, liebe Leser – nein, bitte nur einer!
Schon vorher ist kübelweise (meine Mutter und Ama haben dafür Kübel zur Verfügung gestellt) Wasser vom Hausbrunnen ins Stübchen geschleppt und der Holzfußboden mit alten Wochenschauen (von der Frau Orthelfer, schon gelesen) ausgelegt worden. Jetzt schöpft die Großtante mit einem Krug heißes Wasser aus dem Schiff im Herd und gießt es in die Lavur, die auf einem Stockerl in der Mitte des Raumes steht. Anschließend schöpft sie kaltes Wasser aus dem Kübel und schüttet es dazu bis die Temperatur passt. Die junge Mitzi sitzt, oben herum nur mit einem Hemdchen bekleidet, auf einem Stuhl vor dem Stockerl. Sie beugt sich nach vorne und lässt ihr Haar kopfüber in die Lavur hinunterfallen. Weil sie so ihr Haar nicht zur Gänze nass machen kann, wird ihr noch von oben aus dem Krug lauwarmes Wasser über den Kopf gegossen. Jetzt werden Kopfhaut und Haar gründlich mit Schichtseife – Shampoon gibt’s hier nicht – eingeseift, und die beiden Frauen, die Großtante und meine Mutter, eine rechts und eine links, reiben und drücken und wringen das Haar wie ein Stück Wäsche. Die junge Mitzi jammert dazu, weil ihr trotz eines um den Hals gelegten Handtuchs Wasser in die Ohren und über Schultern und Brust rinnt. Das kitzelt und brennt, behauptet sie. Danach wird die Seife gründlich ausgespült. Aus dem Krug wird dreimal lauwarmes Wasser über den Kopf gegossen und dem letzten Spülgang mit kaltem Wasser – da schreit die junge Mitzi auf – wird Essig beigegeben, für den Glanz. Nach dem Waschen und nach jedem der Spülgänge wird das gebrauchte Wasser in den Schmutzwasser-Kübel geleert. Und jedes Mal, wenn der voll ist, geht meine Mutter damit hinunter vors Haus und entleert ihn in den Straßengraben. Zum Schluss wird das Haar mit einem am Herd angewärmten Handtuch möglichst trocken gerubbelt und anschließend ölt die alte Mitzi der jungen Mitzi die Kopfhaut mit Klettenwurzelöl ein – für den gesunden Haarwuchs. Dann wird das Haar unter beidseitigem Gezeter mit einem Kamm frisiert, und die junge Mitzi setzt sich mit einer Illustrierten an den Herd oder in den Garten, je nach Wetter und Jahreszeit.
Liebe Leser, vielleicht hat Sie das Lesen dieser Prozedur, das erlesene Zu-schauen, gelangweilt, aber ich hoffe, Sie haben dadurch eine Vorstellung davon bekommen, wie umständlich und zeitaufwändig gewöhnliche Verrichtungen in den Fünfzigerjahren sein konnten. Sie füllten das Alltagsleben der Menschen aus, weshalb sie des Fernsehens und dergleichen Zerstreuungen noch nicht bedurften.
Irgendwann freilich wurde den beiden Mitzis diese Reinigungsprozedur zu umständlich, das Haar wurde abgeschnitten: moderne Kurzhaarfrisur. Auf die war die junge Mitzi stolz, und froh war sie, die Last vom Kopf zu haben. Ich war traurig über den Verlust ihrer Haare, denn ich war stolz darauf gewesen, eine Verwandte mit Haaren wie Rapunzel zu haben. Nur einmal noch habe ich so lange und dichte rotbraune Haare gesehen, bei Marcia in Chile. Marcia mussten die Haare abgeschnitten werden, weil sie so schwer waren, dass sie ihr den Kopf nach hinten unten zogen und dadurch Kopfschmerzen verursachten. Über Kopfschmerzen hat die junge Mitzi nie geklagt, woraus ich schließe, dass sie keine hatte. Das verdankte sie womöglich ihrer verhältnismäßig großen Nase, deren Gewicht dem Gewicht ihrer Haare entgegenwirken konnte. Das ging bei Marcia nicht, denn die hatte eine Nase wie Kleopatra, die legendäre Königin mit der hübschen Nase. Und diese so zierliche Nase konnte ob ihrer Leichtigkeit die Schwere der Haare nicht ausgleichen, Marcias armer Kopf wurde ungebremst nach hinten unten gezogen.
Nebenbei bemerkt: Die Mitzi und die Marcia gehörten zu den weiblichen Wesen, deren Haare so prachtvoll sind, dass ich die Sitte, sie mit einem Tuch zu bedecken, damit ihre erotische Strahlkraft die Männer nicht verwirre, nachvollziehen kann.
Es war kein bequemes Wohnen dort oben unter dem Dach, es war eine Notlösung, bis man was Richtiges fände. Ich aber ging gerne zu den beiden Mitzis, ich fühlte mich wohl bei ihnen im Shabby Chic-Dachstübchen mit Herd Kredenz Kleiderkasten Tisch Stuhl Stockerl und dem einen Bett, das sie sich teilen mussten.
Hier nun, liebe Leser, ist meine Führung durch die Fünfzigerjahre-Thorburg zu Ende. Wir haben uns Räume und Leute angeschaut und ein wenig von deren Alltag erfahren. Wie ich es schon für das Feenthal beschrieben habe, hatten auch hier alle einen annähernd gleichen Lebens-Rhythmus: das Wäschewaschen am Montag und am Dienstag, das Flicken und Bügeln am Mittwoch und Donnerstag, das Putzen am Freitag, das Backen mit seinem Wohlgeruch am Samstag, und am Sonntag – die Stille. Und in den Nächten schliefen selbst die Halbwüchsigen. Am Samstagabend spät heimkommen hieß gegen Mitternacht. Das ist die Zeit, wo die jungen Leute heute weggehen, denn: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, dass was geschieht …
Also wenn das möglich wäre, würde ich Ihnen dieses fröhliche Lied zum Abschluss des Kapitels vorsingen.