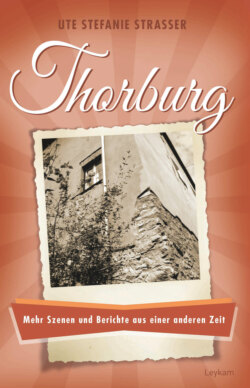Читать книгу Thorburg - Ute Stefanie Strasser - Страница 5
Drittes Kapitel Auf d’Nacht und in da Nacht
ОглавлениеDie Großmutter trägt Zöpfchen und dem Großvater entfallen die Zähne, ich verteile meine Kleider und schlafe darüber ein, eine Königstochter isst Delikatessen, russische Silvester, eine rassige Person; meine Eltern gehen auf den Ball, anfangs mit und dann nur noch ohne T.Resa, und warum dies, erzählt mir meine Mutter; sie erzählt mir auch sonst noch allerhand von Seinerzeit, und so weiter – zum Beispiel: ich – äh, pinkle auf Mehlspeisen
Der späte Nachmittag, der Vorabend, begann bei uns um fünf Uhr. Um sechs Uhr gab es das Abendessen. Den anschließenden Zeitraum bis zum Schlafengehen um acht Uhr nannten wir nicht Abend, sondern auf der Nacht – kürzer: auf d’Nacht. Auf d’Nacht ging man an gewöhnlichen Tagen nicht mehr aus dem Haus.
Bald nach unserem Umzug in die Thorburg bildete sich ein abendliches Ritual heraus: Ich ging nach dem Abendessen – es war in der Regel ein Abendbrot –
einen Stock tiefer zu den Großeltern. Die saßen am Tisch im Wohnzimmer und spielten Schnapsen, dieses Wirtshaus-Kartenspiel. Häufig gewann der Großvater; weil er besser schummeln kann, behauptete Ama. Wenn sie sein Schummeln bemerkte, rief sie empört: Jo, Schnecken! (mit Jo meinte sie Ja, nicht meinen Großvater). Bei diesen Schnecken handelt es sich nicht um die im Garten kriechenden, sondern um die Mehrzahl von Schneck, womit im Osten Österreichs ein Stück verdickter Nasenschleim (Raunga Rammel Wuzl Popel) bezeichnet wird (Robert Sedlaczek). Der Ausruf Schnecken bedeutet, etwas sei nichtiger Nasendreck, ein Nichts, durch die Verwendung der Mehrzahl zu einem totalen Nichts gesteigert. Wenn meine Großmutter Schnecken rief, meinte sie: Nichts da! Das gilt nicht! Da wird nichts draus! Und in Konsequenz: Ich lass mich von dir nicht beschummeln! Der Großvater grinste vergnügt in sich hinein.
Wenn ich bei ihnen ankomme, nehme ich alsogleich einen Kamm und zwei Bürsten, eine normale Haarbürste und eine Babybürste, aus der Stofftasche, die unter dem Spiegel in der Nische zwischen Kachelofen und Kredenz hängt, und lege sie rechts von Ama auf den Tisch. Aus der Blechdose, die in der Nische der Kredenz steht, nehme ich Schleifen Kämmchen Haarspangen Haarklammern Haarnadeln Gummiringe und lege sie dazu; dann stelle ich mich hinter Ama und gehe ans Werk. Als erstes entferne ich die u-förmigen Haarnadeln aus ihrer Nackenrolle, löse eine Art borstigen Lockenwickler heraus und lege ihn in die Blechdose. Ich fasse diesen Rollenfüller mit Widerwillen an, denn er enthält Verunreinigungen, deren nähere Beschreibung ich mir und Ihnen, liebe Leser, hier nicht antue. Als nächstes nehme ich die normale Bürste zur Hand und beginne vorsichtig Amas schwarzes schulterlanges Haar zu bürsten, und Ama beginnt zu gurren und zu schnurren, um mir zu signalisieren, welches Behagen ihr diese Berührung bereitet. Vielleicht, denke ich heute, waren es die einzigen Streicheleinheiten, die sie erhielt, denn wer streichelt schon eine alte Frau. Was sage ich da: alte Frau? Sie war damals jünger als ich es jetzt bin, kaum sechzig. Und selbstverständlich bin ich keine alte Frau; schon erstaunlich, dieser Unterschied, meinen Sie nicht?
Wenn ich finde, dass ich Ama lange genug gebürstet habe, tausche ich die Bürste gegen den Kamm. Mit dem ziehe ich ihr einen Mittelscheitel, teile ihr Haar und flechte zwei dünne Zöpfe oder, wenn es besonders lustig sein soll, vier ganz dünne. Die binde ich an den Enden mit Gummiringen und klammere oder stecke sie mit den u-förmig gebogenen Nadeln zu einer Gretlfrisur hoch. Oder ich flechte nicht, sondern ich binde mithilfe von Schleifen zwei Schwänzchen, eines über dem rechten und eines über dem linken Ohr, und nenne meine Großmutter Pipi Langstrumpf; oder ich binde ihr einen Pferdeschwanz und nenne sie eine kesse Göre (diesen Ausdruck habe ich aus der Zeitschrift Bravo); oder ich lasse ihr das Haar offen hängen, stecke hier und da ein Kämmchen hinein und sage, mit der Frisur könne sie auf den Ball gehen. Jaja, auf den Federnball (ins Bett) lacht sie. Ich flechte und klammere und stecke und binde und begutachte sie jeweils von allen Seiten – perfekt. So irgendwie zurechtgemacht lasse ich sie sitzen, nehme die Babybürste zur Hand und wechsle meinen Standort. Ich stelle mich hinter den Großvater, nehme ihm die Pullmankappe ab und bürste seine Glatze und die Härchen drumherum. Zum Abschluss der Bürsterei suche ich sein Narbenschüsselchen am Hinterkopf, taste mit dem Zeigefinger die Ränder ab und kann es nicht lassen hineinzutasten. Da erfühle ich unter der dünnen Haut dieses Loch im Knochen und es graust mir. Schnell ziehe ich meinen Finger zurück. Mein Großvater setzt sich seine Pullmankappe wieder auf und rückt sie zurecht. Ich wechsle abermals meinen Standort, stelle mich erneut hinter die Großmutter und befreie sie von Klammern, Kämmchen und so weiter, löse Verflechtungen und Bindungen und bürste das Haar noch einmal für eine Weile. Für die Nacht bleibt es dann so – offen.
Nicht immer werde ich die noch herumliegenden Frisierutensilien weggeräumt haben, denn um Viertel vor acht wird oben im ersten Stock unsere Wohnungstür geöffnet und meine Mutter ruft nach mir, das bedeutet: Zeit zum Schlafengehen. Ja, meine Mutter schreit mich herbei, obwohl sie Amas Herbeischreien der Orthelferin so unhöflich, ja unmöglich findet. Scheint’s, dass im Umgang mit Kindern die zwischen Erwachsenen geltenden Höflichkeitsregeln nicht gelten.
Ich gebe Ama ein Eili – bei einem Eili wird die Wange kurz an die Wange des Gegenübers gelegt, damals eine Geste der Liebkosung zwischen Menschen, die sich nahe stehen. Vergesse ich, weil in Eile, das Eili, fordert sie es ein. Gib a Eili, sagt sie und hält mir ihre weiche Wange hin. Nach dem Eili steht sie auf, wendet sich zur Kredenz, nimmt den Deckel von der Porzellandose und entnimmt ihr ein Bettsteigerl (Betthupferl). Das überreicht sie mir, wenn ich vom Eiligeben beim Großvater auf dem Weg zur Tür wieder an ihr vorbeikomme. Ich sage Danke und Gute Nacht, stecke mir das Bettsteigerl in den Mund und gehe nach oben. Dort muss ich mich waschen und für die Nacht umziehen, um acht Uhr soll ich im Bett liegen. Bei uns wurde früh schlafen gegangen, einmal, weil mein Vater schon um halb fünf aufstehen musste, und zum anderen, weil meine Eltern ausreichenden Schlaf als eine notwendige Voraussetzung für Wohlbefinden und Gesundheit erachteten.
Die Großeltern gingen nicht so früh schlafen. Sie verbummelten die Abende bei Kartenspiel Lektüre Kreuzworträtseln und Radiohören. Wie schon früher einmal erwähnt, war Großvater Jo abends hin und wieder aushäusig, und hin und wieder blieb er aushäusig und Ama bereitete ihm bei seiner Heimkehr am nächsten Tag einen lautstarken Empfang: Schrei-Zack-Klescha.
An den Abenden seiner Aushäusigkeit war sie jedoch keinesfalls schlecht gelaunt. Wenn ich gegen halb sieben nach kurzem Anklopfen das großelterliche Wohnzimmer betrat, saß sie am Tisch und löste ein Kreuzworträtsel. Ich fri-sierte sie, sie blätterte in einer Illustrierten und las mir das eine oder das andere daraus vor. Danach spielten wir Mikado. Da muss man aus einem Haufen von einundvierzig Stäbchen, die wie hölzerne Stricknadeln aussehen, eines herausholen und darf mit dem Herausholen von Stäbchen so lange fortfahren, bis dabei ein Stäbchen, das man gerade nicht herausholen will, auch in Bewegung gerät. Da muss man aufhören und der andere kommt dran. Jedes Stäbchen hat einen bestimmten Punktwert und wer am Ende, wenn der ganze Haufen abgeräumt ist, mehr Punkte hat, ist der Sieger. Es geht hier um Fingergeschicklichkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration. Wir spielen schweigend. Nur die Pendeluhr redet ihr igga-igga-igga (oder iggá-iggá-iggá – so oder so kann ich es hören) in die Stille hinein, und wenn sich ein Stäbchen durch das Niederdrücken eines Endes mit dem rechten Zeigefinger am anderen Ende hochschwingt, sodass es mit der linken Hand vorsichtig abgehoben werden kann, gibt es ein leises Sirren von sich. Und freilich, immer wenn sich ein falsches Stäbchen bewegt, schreien wir beide auf.
Einmal kam der Großvater vom Besuch bei den Freunden schon nachts nach Hause und es war ihm schlecht. Er erbrach sich und mit seinem Mageninhalt entfielen ihm auch seine Zähne und plumpsten ins Plumpsklo (kleine Sünden straft der liebe Gott sofort), und plumpsten weiter durchs lange Rohr nach unten bis in die Jauchengrube im Garten. Weil mein Großvater ein sparsamer und eher armer Mann war und am Vertrauten hing, schöpfte er am nächsten Tag mit einem großen hölzernen Schöpfer die Jauche aus dem betonierten Schacht unter der Gartenstiege und entleerte sie in den vorfrühlingshaften Garten. Meine Mutter und ich standen am Fenster und schauten ihm zu, am Fenster unter uns stand die schadenfrohe Ama, die uns bereits über den Zweck des großväterlichen Tuns aufgeklärt hatte. Meine Mutter schimpfte über diese Sauerei, abgesehen vom Gestank sei das verboten wegen der krank machenden Keime. Aber sie ging nicht hinunter und wies ihn zurecht. Nein, tat sie nicht, denn der Großvater, stur wie er war, hätte bestimmt ungerührt weiter in der Scheiße gerührt. Als er sein Gebiss endlich fand, hatte er schon die halbe Jauchengrube ausgeschöpft. Die andere Hälfte ließ er jetzt drin, gab die hölzerne Abdeckung wieder in den Betonrahmen und lehnte den Schöpfer in die Ecke. Sein Gebiss klaubte er auf – Pfui Deifl!, rief meine Mutter am Fenster dazu –, wickelte es in dafür bereitgelegtes Zeitungspapier und trug es nach oben. Er wusch es unter dem fließenden Wasser am Hausbrunnen, kochte es anschließend zur Desinfektion in Wasser aus und setzte es mit einem Klack wieder ein. Pfui Deifl, sagte meine Mutter viele Male, als sie meinem Vater am Abend vom Verlieren, Suchen und Wiederfinden, und von der Wiederverwendung des Gebisses erzählte.
Ja, bei uns ging es noch irgendwie mittelalterlich zu: hinterm Haus die Scheiße und vorm Haus die Pisse. Denn angeblich, so das Gerücht, wurde vom ersten Stock des Hauses neben uns allfrühmorgendlich der Inhalt eines Nachttopfes auf die Alte Straße entleert.
Mein Vater war auf d’Nacht bis auf sehr wenige Ausnahmen (Betriebsausflüge) nie allein aushäusig. Meine Eltern gingen gleich nach mir gegen halb neun zu Bett. Ob sie da schon schlafen konnten? Ich jedenfalls lag meist noch lange wach und lauschte den in unregelmäßigen Abständen vorbeifahrenden Autos hinterher. Lesen durfte ich nicht, als Unterhaltung blieb mir das Den-ken. Ich erfand mir Denk-Spiele.
Bei einem Denkspiel sortierte und zählte ich meinen Gewandbestand: Unterhemden Unterhosen Strümpfe Schals Hauben Pullover Röcke Kleider. Ich legte alles nebeneinander, versammelte arme nackte Kinder um mich und kleidete sie damit ein. Dann ließ ich sie wie bei einer Modenschau an mir vorbeidefilieren, arrangierte hier und da etwas um und zählte mit, wie viele ich hatte einkleiden können. Wenn ich dabei nicht einschlief, führte ich die nun Bekleideten zu einer (tatsächlich existierenden) Holzhütte im Feenthal, die ich mit Möbeln aus unserem Mobiliendepot ausstattete, und mit Geschirr aus unserer Kredenz, und mit Decken und Kissen, die brauchten sie ja auch. Ich verteilte mein und unser Weniges und es erfüllte mich mit Behagen, wie viel es war, darüber schlief ich ein.
Ein anderes Denkspiel war das Schön-Denken, wie ich es bei mir nannte; in einer Version entrückte ich mich in eine Villa am See. Dort wandle ich in prächtigen Kleidern durch prächtige Räume und habe jede Menge Hauspersonal. Ein attraktiver Mann besucht mich, er sieht aus wie Gerhard Riedmann oder wie mein aktueller Schwarm vom Eislaufplatz oder ganz anders – aber immer attraktiv. Mit dem Mann spaziere ich um den See. Wir plaudern, er legt seinen Arm um mich, zieht mich an sich, beugt sich zu mir herab und legt seine Lippen auf die meinen. So stehen wir da, lange. Ich sinke an seine breite Brust, wir seufzen und stehen immer weiter so da, bis ich einschlafe. Wenn ich nicht einschlafe, muss ich die Szene wiederholen, wenn nötig mehrmals und etwas variiert.
Ein ganz anderes Denkspiel war das Schlimm-Denken. Da dachte ich mir zum Beispiel aus, dass ich in die Konditorei Weiss ginge und mich dort ganz unmöglich verhielte. Nämlich wie? Ja so: Ich stelle mich breitbeinig vor die Vitrine und entlasse wie ein Bub einen frechen Strahl auf die dort liegenden Mehlspeisen mit Rauchgeschmack – im Klartext: Ich pinkle drauf. Eigentlich ja höchstens eine lässliche Sünde, aber ein Tabubruch vom Feinsten. Und der Hauptspaß dabei sind die entsetzten Gesichter um mich herum, die aufgerissenen Augen und Münder, die Schreie voller Ekel und Abscheu. Ha, denen hab ich’s gezeigt! Ähnliches, vermute ich, haben die Wiener Aktionisten (Otto Muehl u. a.) bei ihrer Uni-Ferkelei am 7. Juni 1968 empfunden. Freilich, ihre Provokation war Kunst, meine nur eine phantasierte Ferkelei, weshalb ich mich nicht als eine Vorläuferin des Wiener Aktionismus bezeichnen kann.
Kürzlich erzählte mir meine Freundin Monika, dass sie eine Zeit lang, auch etwa im Alter von zehn Jahren, von der Vorstellung verfolgt wurde, bei einem Gottesdienst nackt durch den Mittelgang zu rennen. Ein richtiger Zwangsgedanke sei das gewesen, verbunden mit der Angst, es eines Tages wirklich zu tun. Natürlich hat sie es nie getan, wie auch ich nie auf Mehlspeisen gepinkelt habe – weder auf verrauchte noch auf nicht verrauchte, weder öffentlich noch privat.
Schön-denken, Anders-denken. Denken war Flucht in den Kopf, in die Freiheit (Ulla Hahn), das hatte ich wohl nötig angesichts der deprimierenden Situation um acht Uhr abends fremdbestimmt im Bett liegen zu müssen.
Ich erinnere mich noch an ein mittägliches Denkspiel. Wenn ich während der Woche mittags nur mit meiner Mutter zu Tisch saß, hatte sie sich im Nu abgespeist. Sie stand auf, räumte ihren Teller und ihr Besteck ab, begann hin und her zu gehen und dies und das zu tun. Ich saß weiter am Tisch mit der Aufgabe aufzuessen, damit hatte ich aber nicht selten Schwierigkeiten. So wie sich das Tor zum Schlafen nicht öffnen wollte, so wollte sich hier mein Hals nicht öffnen, es war da so eine Enge, das Essen konnte kaum durchrutschen. Da begann ich zu spielen.
Als erstes sortierte ich mein Essen auseinander – ein Häufchen Kartoffel, ein Häufchen Gemüse, ein Häufchen Fleisch. Als nächstes schuf ich innerhalb der jeweiligen Häufchen Muster – einen Kreis, eine Schlange, ein Viereck, dabei aß ich schon etwas auf, damit es passte. Und jetzt dachte ich mir, dass ich eine Königstochter bin – immer Tochter, nie Königin (die ist tot) – und dass auf meinem Teller die erlesensten Speisen liegen. Mein Vater, der König (Astrid Lindgren), hat seine Diener in aller Herren Länder geschickt, um diese Delikatessen zu erwerben; denn das Beste ist gerade gut genug für mich, die ich krank bin an Leib und Seele (warum, das spielt hier keine Rolle) und gesund werden soll. Ich sitze da und spieße jede Erbse einzeln auf die Gabel, führe sie mir bedächtig zum Mund, lege sie mir auf die Zunge und lutsche sie, sie schmeckt golden. (Wie Gold schmeckt? Gold schmeckt fantastisch!) Ich zelebriere ein Mahl der Kostbarkeiten. Mein Vater, der König, sitzt bei mir und schaut mir lächelnd zu, und um uns steht der Hofstaat und schaut mir ebenfalls lächelnd zu. Alle freuen sich, dass ich esse und also nicht sterben werde. Nur meine Mutter, die keine Ahnung hat von goldenen Erbsen, schüttelt den Kopf und jammert, auf diese Weise würde ich nie fertig werden, und überhaupt, alles sei ja schon ganz kalt, wie ungesund! Dann verlässt sie mich, geht ins Wohnzimmer oder hinunter zum Ortgang, weil sie mir im Unterschied zu König und Hofstaat bei solchem Essen nicht zuschauen möchte.
Wenn ich woanders aß, hatte ich nie Probleme mit dem Schlucken. Es kam vor, dass ich bei meinen täglichen Besuchen der Großeltern noch in deren Abendessen hineingeriet, das sie vor dem Kartenspielen einnahmen. Ama stellte mir dann einen Teller hin und ich durfte mitessen. Hunger hatte ich eigentlich keinen mehr, aber bei ihnen zu essen war interessant. Es gab eine kalte Platte mit Schinken und Wurst und Käse und Essiggurken und von Ama selbst zubereitete Salate: Kartoffelsalat mit Zwiebeln, Gurkensalat mit Zwiebeln, Bohnensalat mit Zwiebeln – keine Blattsalate, das war ihr zu viel Arbeit mit dem Putzen und dem Waschen. Amas Salate waren Erlebnissalate; wenn ich sie aß, reisten meine Geschmacksnerven durch unerwartete Sensationen: Im Sauren überraschte ein süßes Inselchen, im Wässrigen ein scharfer Knall, durchs Ölige zog sich eine salzige Spur. Ein dissonantes Miteinander war das – Öl Essig Salz Pfeffer Paprika und andere mir unbekannte Zutaten. Ich wurde von Geschmacksempfindung zu Geschmacksempfindung geworfen, salatlang ins Ungewisse hinein. Im Vergleich dazu waren die mütterlichen Salate in ihrer süßsauren Harmonie langweilig. Meine Mutter fand die Salate ihrer Schwiegermutter selbstverständlich fürchterlich. Die haue da einfach alles Mögliche drauf und mische das Ganze nicht einmal durch – zu faul dazu! Und obendrauf diese grob geschnittenen Zwiebeln – grauslich! Meine Mutter schüttelt sich; was würde sie erst zu den Salaten von Gregs Opa gesagt haben: Bohnen, Gurken und ein Haufen Kresse drauf, und das alles schwimmt in einer Schüssel voll Essig.
Es kam vor, dass mir abends im Bett ein wenig übel war, vielleicht vom doppelten Abendessen oder von Großmutters Zwiebel-Salat. Da war dann nix mit Denkspielen, da schlich ich mich zum Sekretär und öffnete die gläserne Schiebetür, wo im oberen Fach Mutters selbst Angesetzter stand. Dabei handelte es sich um einen klaren Korn auf Wacholderbeeren, Kalmuswurzel und ich weiß nicht was noch. Von diesem würzigen Schnaps nahm meine Mutter einen Schluck, wenn ihr der Magen drückte, oder wenn sie meinte das Herannahen einer Erkältung zu spüren. Irgendwann hatte ich herausgefunden, dass dieser Schnaps auch mir gegen Magenbeschwerden half und mir darüber
hinaus ein gewisses Wohlbefinden bescherte. Hätte ich nicht befürchtet, meine Mutter könnte – ja, würde den Schnapsschwund bemerken, hätte ich mir allabendlich einen Schluck aus der Bottle gegönnt. Meistens machte mich der Schnaps müde, hin und wieder machte er mich munter. Dann schlich ich mich abermals zum Sekretär, öffnete die gläserne Schiebetür und kramte von hinter den Büchern das Doktorbuch heraus. Damit ging ich zum Fens-ter, stellte mich zwischen Scheibe und Vorhang, betrachtete beim Licht der Straßenlampe die sich darin befindenden Bilder und las kreuz und quer im Text herum – ich schmökerte; schlau wurde ich nicht daraus. Zwischendurch schaute ich zum Fenster hinaus in die gähnende Leere einer Kleinstadt der Fünfzigerjahre, wo höchstens einmal einer eilig oder schwankend, oder eilig schwankend die Alte Straße hinunter ging, vom Wirtshaus nach Haus. Nicht immer, wenn mich der Schnaps munter gemacht hatte, ermunterte er mich zum Aufstehen. Nein, ab und zu blieb ich schnapslustig im Bett liegen und rezitierte Sprüche wie: Heut bei der Nacht hat der Bettpfosten kracht, ist der Scherm (Nachttopf) explodiert, sind die Mäus aufmarschiert; und das stellte ich mir lebhaft vor. Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht zu laut lachte, das hätte womöglich meine Mutter herbeigerufen, die hätte gefragt, was los sei, und dabei meine Schnapsfahne errochen.
Sogar an Silvester gingen wir vor Mitternacht ins Bett, wozu aufbleiben? Ich durfte aber Radio hören, bis um zwölf Uhr die Pummerin vom Stephansdom ins Land läutete und der Donauwalzer erklang. Da liege ich also im Bett, während dort in Wien bildschöne Frauen in wunderschönen Ballkleidern in den Armen eleganter Männer zur inoffiziellen österreichischen Hymne tanzen. Da liege ich im Bett und bin nicht dabei – und niemals würde ich dabei sein. Ich werde sentimental und weine ein bisschen. Nach dem Donauwalzer erscheint meine Mutter im Nachthemd, sagt Prost Neujahr und schaltet mir das Radio aus. Jetzt lieg ich im Finstern, und während die Schönen und die Reichen weiter durch die festliche Neujahrsnacht tanzen, schlafe ich ein – schlaf ein …
Als wir später den Fernseher im neuen Wohnzimmer hatten (die Familie Trappl war ausgezogen und wir hatten uns räumlich ausgedehnt), feierten wir (meine Eltern und ich, die Großeltern und Frau Lauri, eine Bekannte) Silvester im Halbkreis um diese Attraktion. Wir tranken Russischen Tee mit Stroh-Rum und aßen Russische Eier auf Endiviensalat. Um Mitternacht beim Donauwalzer stießen wir mit einem Glas Sekt an, danach gingen unsere Gäste heim und wir ins Bett. Am ersten Januar aßen wir zum Frühstück am späteren Vormittag wieder Russisches, nämlich die Russen, das sind sauer eingelegte Heringe. Wir aßen sie als Mittel gegen den Kater, weil wir nachts ja ein Glas Sekt getrunken, und meine Eltern davor schon ein Glas Wein und einen Obstler.
Mit Silvester wurde die Faschingszeit und die Ballsaison eröffnet, und meine Eltern besuchten jedes Jahr mindestens einen Ball. Sie konnten mich jetzt mit den Großeltern im Haus ja bedenkenlos allein lassen.
Am Vormittag des Balltages ging meine Mutter zum Frisör, zur Frau Erna. Frau Erna war eine stattliche Person, vollschlank und sehr dunkel, mit schwarzen Locken, einem Bartflaum über der Oberlippe und Haaren an den hohen Bei-nen unter den Seidenstrümpfen mit Naht. Igitt! oder wööaa! wird sich jetzt der eine oder die andere denken, doch glauben Sie mir, liebe Leser, das ist Gewohnheitssache. Die heute angestrebte Ganzkörper-Haarlosigkeit bei Erwachsenen hätte man eher mit der rosaroten Nacktheit eines Hausschweins denn mit menschlicher Schönheit in Verbindung gebracht. Nur Haare auf den Zähnen fand man abstoßend, um eine damit Ausgestattete machte man lieber einen Bogen. Frau Erna wurde als rassig bezeichnet, sie hatte Sex-Appeal, wie man später im Zuge der Amerikanisierung unserer Sprache sagte. Sie war ein Augenschmaus, wenn sie in der Aura einer gewissen Distinguiertheit stolz einherschritt; und wenn sie mit samtiger Stimme sprach, war dies ein Ohrenschmaus und eine reizvolle Alternative zum harmlosen Zwitschern der Blondgelockten in den Filmen.
Nachdem die Haare meiner Mutter gestylt waren, eilte sie nach Hause und wärmte das Vorgekochte auf. Nach dem Essen hielten meine Eltern einen Mittagsschlaf, ein Vorausschlaf sollte das sein. Danach tranken sie echten Bohnenkaffee und meine Mutter legte die Ballkleidung zurecht, dabei gab es einiges zu besprechen. Zwar war die Auswahl nicht groß, aber ein paar Varia-tionen waren möglich: Welcher Selbstbinder (Krawatte), welches Hemd – das eine ist ein bisschen zu klein und das andere ist ein bisschen zu groß –, das schwarze Kleid oder der schwarze Rock mit der weißen Bluse, welche Halskette? Man wird es kaum glauben, aber sie diskutierten oft lange. Nach dem Abendessen rasierte sich mein Vater und meine Mutter schminkte sich: Augenbrauenstift und Lippenstift, Rouge für die Wangen und Puder für die Nase, damit diese in der Hitze des Balles nicht zu leuchten begänne. Zum Schluss tupfte sie sich etwas Tosca hinter die Ohren. Dann kleideten sie sich an. Um halb acht kamen T.Resa und Onkel F., auch schwarzweiß gewandet, um sie abzuholen. Und bevor sie nach Ermahnungen an mich, nicht zu lange aufzubleiben, feierlich gestimmt loszogen, genehmigten sie sich ein Stamperl Schnaps im Stehen.
Irgendwann wollte mein Vater nicht mehr mit T.Resa und Onkel F. auf den Ball gehen, das heißt eigentlich mit T.Resa wollte er nicht mehr. Zur Vermeidung des gemeinsamen Ballbesuchs produzierte er Kopfweh Magenweh Knieweh und dergleichen mehr Weh. Es war nämlich auf dem letzten Sängerball Folgendes passiert: Mein Vater tanzte mit T.Resa eine Polka, und während sie sich schwindlig drehten, habe meine Tante auf einmal laut Juchhu gerufen und meinen Vater wie toll ins Kreisrund gerissen, fast seien sie gestürzt. Mein armer Vater, ein krebsroter, von T.Resa gepeitschter Kreisel, wollte in den Boden versinken. Aber T.Resa, nun voll in Führung, habe noch einmal gejauchzt, schamlos in die staunende Hautevolee hinein – wohlhabende Geschäftsleute, Ärzte und Rechtsanwälte mit ihren Gattinnen. Die Gattinnen hätten pikiert geschaut (Was für ein Weib!) und die Männer grinsend (Was für ein Weib!). Da hat mein Vater beschlossen, nie mehr mit seiner Schwägerin zu tanzen. Aber freilich, bei einem gemeinsamen Ballbesuch hätte er dies als seine Pflicht angesehen; und selbst, wenn es ihm gelungen wäre, sich davor zu drücken, hätte sie ihn bestimmt bei der Damenwahl erwischt – so eine war das. Lieber also nicht mehr auf den Ball mir ihr, denn die Zähmung dieser widerspenstigen Tänzerin traute er sich nicht zu.
Diese Geschichte hat mir meine Mutter erzählt, und sie hat sie folgendermaßen kommentiert: Es stimme schon, dass die Tante tänzerisch zuweilen etwas wild werde und auch, dass sie vor Vergnügen jauchze, aber wenn mein Vater glaube, alle würden zu ihnen hinschauen und darüber reden, täusche er sich. Am Ball sei dermaßen ein Lärm und ein Gedränge, da wisse niemand so genau, wer gejauchzt hat; und dass ein Paar zu fortgeschrittener Stunde überdreht tanzt, sei üblich und nichts Besonderes. Ein paar werden halt geschaut haben, na und?
Die Stunde vor dem Abendessen, der Vorabend, war besonders im Herbst und im Winter meiner Mutter Nähstunde, und ich saß bei ihr. Wenn mein Vater im Schwimmbad (Hallenbad) oder allein auf Stadtrunde oder unten bei seinen Eltern war, gehörte diese Stunde uns beiden allein und meine Mutter erzählte mir, wie sie das schon im Feenthal getan hatte, gerne Geschichten von Seinerzeit.
Nicht selten höre ich Geschichten mehrmals, ganz gleich aber nie – meine Mutter variiert, schmückt aus, fügt neue, mir bis dahin unbekannte Details hinzu, verschiebt Handlungsschwerpunkte. Bei der Ballgeschichte etwa variiert sie die Anzahl der Jauchzer und die Größe der Gefahr, dass die beiden, mein Vater und die Tante, tatsächlich hingefallen wären. Sie erzählt mir von den Streitigkeiten ihrer Eltern, besonders eine Geschichte erzählt sie öfters, sie findet wohl, ich bin jetzt alt genug für diesen Schlag in die gemütliche Erzählstunde. Die Geschichte geht ungefähr so: Nach Entsorgung der beiden kleineren Schwestern zur Urgroßmutter sei sie, meine Mutter, von ihrer Mutter, meiner späteren Oma Rosa, zu einer Nachbarin mitgenommen und dort zurückgelassen worden – die Mutter müsse etwas erledigen. Meine Mutter half der Nachbarin ein wenig bei der Hausarbeit und spielte mit deren klei-ner Tochter. Nach gut zwei Stunden kam ihre Mutter zurück, trank mit der Nachbarin schnell einen Kaffee im Stehen und machte sich dann mit der Tochter schnellschnell auf den Heimweg. Unterwegs mussten ja noch die kleinen Schwestern abgeholt werden. Inzwischen aber war die flotte Resi der Urgroßmutter entwichen und nach Hause gelaufen. Ihr Vater, mein späterer Opa K., der nicht wusste, wem sie davongelaufen war, weil die Resi das nicht so genau sagen konnte, nahm sie an der Hand und ging seine Ehefrau suchen.
Sie begegneten sich mitten auf der Gasse, der Vater mit einem Mädchen an der Hand und die Mutter mit einem Mädchen an der Hand. Feindselig standen sie einander gegenüber. Meine Mutter vorab instruiert zu bezeugen, dass sie und ihre Mutter den ganzen Nachmittag über gemeinsam – ja, gemeinsam bei der Nachbarin gewesen seien, stellte sich vor Aufregung ungeschickt an: Sie schrie das Zeugnis angesichts des Vaters sofort ungefragt heraus und sie heulte dabei. Durch dieses ihr Verhalten erhärtete sich des Vaters Verdacht gegen seine Ehefrau. Und da passierte es: Der Vater gab der Mutter eine Ohrfeige – mitten auf der Gasse. Dann drehte er sich um und ging davon, die Resi ließ er zurück. Jetzt heulten sie heimzu, die Mutter und ihre beiden Töchter; die Resi heulte, weil ihre Mutter und die große Schwester (meine Mutter) heulten. Zu Hause hatte das Familienoberhaupt vor Zorn die Tür hinter sich zugesperrt, die drei mussten sich draußen herumdrücken; zur Urgroßmutter, von wo die Jüngste noch abgeholt werden musste, trauten sie sich so verheult nicht. Ein Glück, dass es Sommer war. Endlich, nach ungefähr einer Stunde verließ der Vater die Wohnung und ließ die Tür unversperrt.
Fürchterlich sei das alles gewesen, sagt mir die Tochter von damals, meine Mutter, unter keinen Umständen würde sie ihrem Ehemann, meinem Vater, so etwas antun – Liebe hin, Liebe her, womit sie meint, selbst dann nicht, wenn sie einen anderen lieber hätte als ihn.
Und meine Mutter erzählte mir von ihren und von meines Vaters Jugendfreunden und Jugendfreundinnen, sie redete von ihnen wie von guten Bekannten, die am nächsten Tag bei uns vorbeikommen könnten. Sie erzählte vom feschen Ludwig, Sohn reicher Winzer, der sie so gerne geheiratet hätte, aber sie war ja schon mit ihrem ersten Mann verlobt; und sie erzählte von der feschen Salzburgerin, der Fastverlobten meines Vaters, deren Fotografie ich noch immer besitze. Ich habe nicht das Herz sie wegzuwerfen. Die Helma trägt darauf eine Frisur und eine Spitzenbluse, mit der sie heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts ganz aktuell zurechtgemacht wäre, und auf die Rückseite hat sie geschrieben: In Liebe Deine Helma, 31. Juli 1941.
Ich kannte die Helma und den Ludwig schon von früher, denn ihre Bilder lagen in der Schuhschachtel bei den losen Fotografien, die ich oft angeschaut hatte, aber erst jetzt erfuhr ich von der Sonderstellung dieser beiden innerhalb des Freundeskreises meiner Eltern.
Ich glaube, meine Mutter sehnte sich nach ihren Freundinnen und Freunden von vor dem Krieg. Sie hätte sie gerne einmal wieder getroffen, aber die Wege zueinander waren so weit, und Reisen und Telefonate viel zu teuer, und das Briefeschreiben so aufwändig. Ach, wie einfach können wir Heutigen doch zueinanderkommen! Wirklich? Doch, doch – wir simsen, wir chatten, wir mailen, wir telefonieren, wir setzen uns ins Auto und fahren hin. Wir pfeifen auf die Sehnsucht!