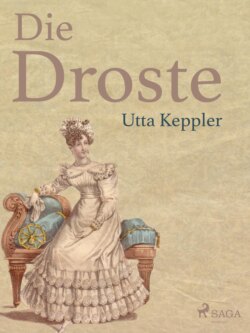Читать книгу Die Droste - Biografie von Annette von Droste-Hülshoff - Utta Keppler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Kindheit und Jugend
ОглавлениеMan hat ihr erzählt, daß sie ein jämmerliches Würmchen gewesen sei, als die Mama sie zu früh geboren habe, als Achtmonatskind, noch in Westfalen. Man hatte bei ihr sogar weniger Hoffnung, als wenn sie vier Wochen früher geboren wäre; man war aufgeregt und verzweifelt wie über ein ganz mißglücktes Beginnen, am meisten die Mama: Da lag ein winziges, zierliches rotes Geschöpf, das kaum behaarte Köpfchen mit gekniffenen Augen über dicken Säcken, einem greinenden Mündchen und Fingernägeln nur wie Haut, und das Rückgrat entlang feine blonde Härchen.
Da ist nichts von einem strahlenden strampelnden Baby, wie es sich die Mutter gewünscht hat, dieses sabbernde Würmchen, dem man nur Flanelltücher umzulegen wagt statt der vorbereiteten Hemdchen und Jäckchen, und das mit altklug verkniffenen Lippen alle Nahrung verweigert.
Die Mama ist enttäuscht und in ihrer Schwäche beinahe schon verbittert. Ungeduldig ist sie auch, denn die immer wiederholten Versuche, das verschlossene Mündchen dem warmen Milchstrom zu öffnen, brauchen viel Zeit und nutzen nichts.
Und endlich meint man, das Geschöpf sei nicht zum Leben geboren, nicht zum Bleiben.
Es gibt eine rasche Taufe, während der der Kaplan mehr Zutrauen zu dem scheuen Seelchen hat als die eigene Mutter, Zutrauen, daß es in dem schmächtigen rötlichen Körperchen sich durchsetzen und zum zähen Bestehen durchdringen werde.
Die Mama findet dann, daß eine Amme her müsse, eine prallbrüstige Webersfrau, die Kathinka Pettendorf, die ihren eigenen Jungen neben dem kläglichen »Frölen« aus dem Schloß wohl nähren könnte.
Aber zuerst, meint diese, vertrage das »Vögelchen« ihre fette Milch nicht – also läßt sie es an Kamillensäckchen lutschen und streut einen Hauch Zucker dazu. Sie ist selber glücklich, als die strichschmalen blauen Lippen sich regen, wölben, spitzen, und ein winziges Zünglein anfängt zu probieren.
Die Mama, die Schloßherrin, Therese von Droste-Hülshoff, ist erleichtert, das mühsame Locken und Probieren loszusein; sie hat nur widerwillig ihre vielerlei Anordnungen und Übersichten im Schloß und im Gut und Garten zurückgestellt. Es dauerte alles viel länger als bei Jennys Geburt, die »zur Zeit« und »wie es sich gehörte« ankam und aufwuchs. Als Therese dann aufstehen und herumgehen konnte und endlich auch auf den Gartenwegen auf- und abwanderte und Knechte und Mägde kontrollierte, war das winzige, halbtot geborene Kind schon so weit erholt, daß es als ein Menschlein gelten konnte.
Und da die Mama, fromme Katholikin, des Glaubens war, solch ein Seelchen sei im Himmel und von Gott ausgewählt für dieses und gerade dieses Haus und Elternpaar, hielt sie es endlich auch für wichtig und dringlich, daß man es sorgsam aufziehe und mit ein wenig Wärme umhege, zumal die Pettendorfsche mit einem zärtlichen Seufzer sagte, das allerkleinste und kaum lebensfähige Kind spüre, wie man es aufnehme und umsorge, und werde erst gedeihlich und »wohlhäbig«, wenn es fühle, daß es geliebt sei.
Annette hockt jetzt in ihrer Sofaecke im »Gehäus« in Meersburg und zieht die Decken um sich herum, wie Schalen und Windungen eines Schneckenhauses.
Sie sieht sich selber als Vierjährige mit dem wenig jüngeren Bruder um den Wassergraben herumtappen, Hand in Hand zuerst, bis sie sich losmacht, neugierig an den Rand des schwarzen Kanals herangeht, sich darüberbückt, und sie – die Alternde – ist’s jetzt selber, wie sie da in das blasige Sumpfloch schaut und das weißlich verquollene Gesicht der Wasserfrau auftauchen sieht, mit bleichen Fingerspitzen herauflangend. Und zugleich ist sie gewiß, daß die nicht da sein kann – die Schwankende, Zauberische, Verborgene – nicht damals und nicht jetzt.
Damals, vor so vielen Jahren, ist sie, den Bruder mitziehend, in den flachen Sumpf hineingewatet, langsam, Schritt für Schritt, und hat gewartet, ob das Gesicht noch einmal auftauche. Der Junge hat dann den weichen schwammigen Boden unter den bloßen Füßen gleiten gespürt und sie zum Umkehren überredet. Gern ging sie nicht mit, aber aus Angst vor der Strafe der Mutter trat sie in die schnell quellenden Fußstapfen des Kleinen; und doch blieb der Sog und Zug wie eine unwiderstehliche Strömung in ihr und um sie her, immer als Lockung und Drohung und Gefahr und, ja, als unwiderstehliches Verlangen.
Kathinka hat es gut verstehen können, was Annette schon als Mädchen aus dem Heidemoor steigen sah, Unerlöste und Irrlichternde und düstere mörderische Gespenster, und auch die schwebend-schwankenden Wasserjungfern, die immer auf- und eintauchen und Irrlichter zünden, wenn sie die Menschen locken wollen.
Kathinka, Katharina – war die eigentliche »Mutter«. Drüben im Salon saß die Mama, Spitzen häkelnd oder mit dem Rechenstift über dem Kassenbuch. Aber Kathinka, die liebe alte Frau war’s, deren breite warme Brust das Vögelchen angenommen und gewärmt und genährt und allezeit, auch als ihr eigenes Söhnchen fünfjährig gestorben war, als »ihr« Kind behalten und gepflegt hatte, sogar mit einem kühnen rechthaberischen Widerspruch gegen die Mama gehütet, manchmal auch aus dem naiven halbheidnischen Glauben mit märchen- und bildersatten Visionen gefüttert hatte.
Die Mama war der Gegenpol: die strenge Ordnung, die Selbstdisziplin. Dazu erzog sie Annette, das war das nötige Rückgrat für das überquellende, von Ängsten und Ahnungen phantastisch-gefährdete Wesen der Tochter.
Vierjährig erzählt Annette ihren Traum der Schwester Jenny: Sie sei – und sie habe sich stolz als Siebenjährige gefühlt – eine lange schnurgerade Allee entlanggewandert, immer geradezu, und immer flankiert von kleinen Gräben und großen Bäumen, alles exakt und zielgenau; und hätte doch immer darauf gewartet, daß irgendwo etwas Neues, Unerwartetes auftauche und sie fordere zur Unternehmung, zur Tat, zu Angst oder Bewunderung – aber da sei nichts Ungewöhnliches gewesen, nichts Aufregendes oder Besonderes.
Das war damals, als sie mit dem Bruder Werner ausriß …
Ausreißen – heute muß sie darüber lachen: sich freimachen, ganz anders sein und doch immer wieder um- und einkehren in den warmen strenggeregelten, unentrinnbaren Kreis, der sie hervorgebracht und gehalten hatte, bisher und weiterhin – es brauchte nicht einmal der geraunten und geflüsterten Geschichten von Ahnentaten und Ritterkämpfen.
Sie gehörte dazu, sie war aus der alten Sippe, die schon seit dem Jahr 1000 im Münsterland saß; sie delektierte sich gern an den schön klingenden alten Namen, sagte sie sich vor und liebte, ohne ihn zu kennen, den Engelbert von Deckenbrock, der um’s Jahr 1200 Drost beim Münsterschen Domkapitel gewesen war … und daß »Drost« mit dem russischen Starost zusammenhänge, war ihre spielerische Wortphantasie; sie wußte wohl, daß das Wort mit »Truchseß« zu tun haben müsse.
Wasserschloß, Dunst und Kühle und feuchte Mauern … da wächst leicht aus dem harmlosen Husten ein wucherndes Übel – und daß Jenny gesund blieb, war beinahe ein Wunder – die praktische, fröhliche, nüchterne Jenny, die dennoch so hübsch aquarellierte, so »artig« zeichnete, wie der alte Goethe das nannte. Sie schlug nach der Mutter Art, und sie, Annette, Anna Elisabeth, wäre nur dem Vater nachgeartet?
In ihm war vielerlei zusammengeflossen, vielleicht war das Blut ein wenig zu alt, zu müde, und kein ritterlichkampffrohes Lebensgefühl konnte sich mehr darin halten: Clemens August II. war eine der weichen, beinah skurrilen Figuren, wie sie die Romantik oft hervorbrachte. Leute, die – ob sie arm oder reich waren – ihren manchmal verdrehten, verschnörkelten Neigungen nachgingen.
Clemens August von Droste-Hülshoff hatte einen Raum seines Hauses mit Sand ausstreuen und darin Bäumchen anpflanzen lassen, dazu eine Voliere mit allerlei zwitscherndem, flatterndem und kleckerndem Gevögel bestückt, ohne auf Schmutz und Geruch zu achten und auch nicht zum Entzücken seiner sorgsamen Frau.
Er geigte, der Vater, er zog seltene Planzen, er schrieb an einem »liber mirabilis«, in das er ungewöhnliche Begebenheiten und weitgeschwungene Gedankenketten eintrug, in einigen Sprachen und sogar gereimt, wie es ihn eben ankam, er beobachtete einfühlsam und immer bedacht die größeren Zusammenhänge. Von seinen Mineralien zu den seltenen Planzen, von Urtieren, Ammoniten und Medusenhäuptern zog er Fäden und Linien, die sie verbanden und zu Welt und Wissen führten.
Sein »liber mirabilis« blieb ein verschlossenes Geheimnis, in das er die »Vorschau« und Ahnung seiner halbentrückten Sinne und die Rätselgeschichten eintrug, die ihm seine Dörfler erzählten, und er verglich und maß solche im uralten Bilderdenken wurzelnden Vorstellungen mit den historischen Ereignissen. –
Wenn da die huschenden »Reiter auf Gäulen wie Katzen« durch die Hecke brachen, verstand man erst viel später, daß es die russischen Steppenreiter waren. Wenn Wolken wie Fledermausflügel über das Land hinklatschten, waren’s die bösen Tage der verlorenen Schlachten gewesen.
Er selbst, der beinah weiblich-anmutige Freiherr Clemens August von Droste, war kein »reicher Mehrer«, wie sein Name es ihm ansagte – er erblickte schaudernd Dinge und Gestalten, die ihn forderten, drängten und überforderten. Es ist nie ganz deutlich geworden, wie er starb – Annette weicht noch jetzt, jetzt eben, der Erinnerung aus.
Sie sieht ihn unter seinen Vögeln, wie er den einen und anderen auf dem gebogenen Zeigefinger trägt und ihm zuflüstert und zupfeift, wie er sich auf die winzigen Blumenkeime herunterbückt, die Wurzel fester in die Erde eindrückt oder den hingestreuten Boden mischt, den festgetretenen lockert.
Da blüht ein Strauch im ersten Frühling mit winzigen porzellanrosa Blüten, ein »Winterblüher«, und unter ihm duckt sich ein Igelchen, das seinen Winterschlaf schon aufgegeben hat, und läßt sich, ganz unglaublich, von der warmen, schön gepolsterten Hand des Vaters streicheln – ohne die Stacheln zu stellen.
Die Hände des Vaters sind magisch begabt, Magneten, mit denen er Tier und Pflanze zur Sympathie stimmt, wie er die seltenen Mineralien, die Drusen und Ammoniten und Steinlilien aufspürt unter dem Geröll und in den zerschrammten Wänden der Steinbrüche, und die Binsen und Riedgräser streift, zwischen denen die blitzenden Libellen schwirren wie fliegende Edelsteine. –
Die Mutter, zweite Frau des Freiherrn Clemens August nach einer ersten, kurzen Ehe, ist sehr nüchtern, selbstbewußt, eine tüchtige Wirtschafterin und Organisatorin und alles das, was Annette als Autorität empfindet, aber nichts Elementares, nichts Bergendes, kein Quellgrund.
Ausruhen, regenerieren, Wärme saugen – Annette ist, so wild sie sich im Austausch mit dem Gewachsenen, mit Fels und Moor und Sturm austobt, immer das zarte, unverschalte Wesen geblieben, das die Amme »mit Zucker und Kamillen« aufgepäppelt hat: Ganz offen für das Einströmende und immer gefährdet von dem Allzumächtigen, das sie bis in den Grund zittern machte. Was sie bewahrt hat, ist bloß dieser angeborene untrügliche Instinkt für das ihr Gemäße, unterstützt durch das klare Wesen der Mama.
An einem Tag, wo feucht der Wind,
Wo grau verhängt der Sonnenstrahl,
Saß Gottes hartgeprüftes Kind
Betrübt am kleinen Gartensaal.
Ihr war die Brust so matt und enge,
Ihr war das Haupt so dumpf und schwer,
Selbst um den Geist zog das Gedränge
Des Blutes Nebelflore her.
Und am Gestein ein Käfer lief,
Angstvoll und rasch wie auf der Flucht,
Barg bald im Moos sein Häuptlein tief,
Bald wieder in der Ritze Bucht.
Ein Hänfling flatterte vorbei,
Nach Futter spähend, das Insekt
Hat zuckend bei des Vogels Schrei
In ihren Ärmel sich versteckt.
Da ward ihr klar, wie nicht allein
Der Gottesfluch im Menschenbild,
Wie er in schwerer, dumpfer Pein
Im bangen Wurm, im scheuen Wild,
Im durst’gen Halme auf der Flur,
Der mit vergilbten Blättern lechzt,
In aller, aller Kreatur
Gen Himmel um Erlösung ächzt.
Wie mit dem Fluche, den erwarb
Der Erde Fürst im Paradies,
Er sein gesegnet Reich verdarb
Und seine Diener büßen ließ;
Wie durch die reinen Adern trieb
Er Tod und Moder, Pein und Zorn,
Und wie die Schuld allein ihm blieb
Und des Gewissens scharfer Dorn.
Der schläft mit ihm und der erwacht
Mit ihm an jedem jungen Tag,
Ritzt seine Träume in der Nacht
Und blutet über Tage nach.
O schwere Pein, nie unterjocht
Von tollster Lust, von keckstem Stolze,
Wenn leise, leis es nagt und pocht
Und bohrt in ihm wie Mad’ im Holze.
Wer ist so rein, daß nicht bewußt
Ein Bild ihm in der Seele Grund,
Drob er muß schlagen an die Brust
Und fühlen sich verzagt und wund?
So frevelnd wer, daß ihm nicht bleibt
Ein Wort, das er nicht kann vernehmen,
Das ihm das Blut zur Stirne treibt
Im heißen, bangen, tiefen Schämen?
Und dennoch gibt es eine Last,
Die keiner fühlt und jeder trägt,
So dunkel wie die Sünde fast
Und auch im gleichen Schoß gehegt;
Er trägt sie wie den Druck der Luft,
Vom kranken Leibe nur empfunden,
Bewußtlos, wie den Fels die Kluft,
Wie schwarze Lad’ den Todeswunden.
Das ist die Schuld des Mordes an
Der Erde Lieblichkeit und Huld,
An des Getieres dumpfem Bann
Ist es die tiefe, schwere Schuld,
Und an dem Grimm, der es beseelt,
Und an der List, die es befleckt,
Und an dem Schmerze, der es quält,
Und an dem Moder, der es deckt.
Der Sinn für das Gemäße – das ist Auswahl und Abwehr, ohne die das schallose Seelchen zugrunde ginge.
Aber doch muß so viel Einlaß gewährt werden, wie es das Überleben irgend erlaubt. Einlaß für Ströme und Stürme, die ungeformt anprallen und geformt werden wollen.
Ach, Annette weiß das schon und spürt es täglich stärker – es ist das gleiche, was die lebendige Muschel erleiden muß, wenn sie das kantige Sandkorn in immer neuen, immer schmerzhafteren Anläufen umkleidet, ohne es abweisen zu können: Formung heißt Verwandlung, Ausdeutung, bis aus dem billigen harten Splitter, gerundet und glänzend geglättet, eine Perle geworden ist, etwas so Kostbares, wie es ohne den quälenden Anstoß nicht hätte entstehen können. Vom Sandkorn weiß niemand mehr. Nur wenige wissen davon, daß ein unwertes, verworfenes Gebild mit der eigenen Substanz erst gestaltet und sinnreich werden kann. Annette läßt die alte Perlenschnur langsam durch ihre Finger laufen, ein Erbstück, mit zartem gelblichem Glanz. Ihr Vater hat ihr gezeigt, wie sich jeder der kostbaren Tropfen in Jahr und Jahren gebildet hat. Sie meint jetzt, das Geheimnis des Schönen zu erfassen und dem Schöpfer näher zu sein in einem ahnungsvollen Schauder – das ist ihr aufgetragen: Was ihr fragend und fordernd hingehalten wird, erfüllen: Was sie aufruft und manchmal anfleht, erlösen, das »Namenlose nennen«.
Dazwischen das Leben, das eigene Schicksal, das, was von außen kommt … die Muschelschale wird tanzend herumgeschleudert, im Wasser angespült, weggeschwemmt, verworfen und gehäuft mit anderen – und immer noch wächst in ihr das Gebilde, größer und größer werdend, wie ein Kind.
Ihre Sippe ist weitverzweigt, riesig verschachtelt und verfilzt, der Großvater mütterlicherseits hat ein zweites Mal geheiratet, und von dieser zweiten Frau stammt eine große Schar von Kindern, die, wenigstens die später Geborenen, in Annettes und ihrer Brüder Alter sind, Onkel, Tanten und Spielgefährten zugleich. Sie selber ist umgeben von Geschwistern, das Kind sieht die ältere Jenny als Freundin und Vorbild, den kräftigen Bruder Werner, den Erben, als Antrieb zum wilden Klettern, Wandern, Tollen – und den zarteren Ferdinand als geliebten kleinen Freund.
Mit »Nandeken« – so nennt man den Ferdinand zärtlich – verbindet sie unbewußt noch etwas anderes, eine unterschwellige Angst – die Krankheit.
Annette ist als Kind nicht eigentlich krank, aber das frühgeborene Mädchen ist trotz aller Lust am Steigen, Springen, Klettern zart und anfällig – ein hauchdünnes Gefäß, beim kleinsten Anstoß klingend wie ein Glas, mit einem sprühend-leidenschaftlichen geistigen Inhalt … Die Mama weiß das und sucht zu hemmen und zu dämmen, freilich ungeschickt und allzusehr von den Vorstellungen der Epoche und des Standes bestimmt: Wie vielen genialen Frauen beschneidet man Annette die freie Zeiteinteilung, die freie Wahl der Gefährten; Kleid und Schuh und Spielzeug und Raum sind vorgeschrieben und werden überwacht.
Der Traum von der schnurgeraden Allee kam damals aus dem Unterbewußtsein …
Sie wehrt sich energisch, aber sie hat keine logischen Argumente für ihren Widerstand, und der Vater, der sich die ihm angemessenen Formen gönnen kann, mag sie für ein Mädchen nicht gelten lassen.
Die Mama fragt ihn einmal, ob er glauben könne, daß das Kind, da es so viele knabenhafte Züge zeige, doch ein halber Sohn sei, wie sie ihn sich so glühend gewünscht hätte – körperlich ein Mädchen, seelisch-geistig so etwas wie ein Sohn –, und jedenfalls, das sagt sie sorgenvoll, das begabteste ihrer Kinder, so scharfsichtig und -sinnig, wie es sich eigentlich für ein Mädchen ihres Standes nicht schicke? Freilich zeigt sie sie gern bei Gästen, deren viele nach Hülshoff und Rüschhaus kommen, viele auch nach Bökendorf, wo die fromme Stiefgroßmutter wohnt und wohin Therese das halberwachsene Kind begleitet.
Man bewundert und beäugt das schmalgesichtige blasse Mädchen mit der Haarkrone, unter deren Fülle der schmächtige Hals schier gebeugt erscheint.
Aber man bestaunt sie doch eher wie ein Fabeltierchen, porzellanbleich und goldgekrönt, und doch befremdlich und vorsichtig zu beurteilen – einer hat später die gleiche Erfahrung gemacht, viel bitterer noch, als er schrieb: »Denen dein Wesen, wie du bist/Im Innern ein steter Vorwurf ist«, Hölderlin …
Bin ich nun hier auf der alten Meersburg, am Gitter und seh’ auf den nebligen süddeutschen See? Oder bin ich das Kind im Wasserschloß, in Hülshoff oder Rüschhaus, das man ein bißchen schonen muß, weil ihm die Aufregungen der Zeitläufte schaden könnten? Oder bin ich beides zugleich? Das ist mein Fluch und mein Segen, sagt sich die hinschwindende, schwache Frau, die da sitzt oder ab und zu geht zwischen Zimmer und Balkon, zwischen nebelhafter Feuchte und warmem, holzduftendem Gehäus und Einschlupf: so war es immer, das Dazwischensein, wechselndes Spiel, tragisches Spiel, kein vergnügliches, zwischen scharfsichtig registrierter Düsternis, schattenhafter Ungreifbarkeit und dem gesicherten, sichernden, uralten und so wohlbekannten Bannkreis, dessen Töne und Gerüche sie fast nicht mehr erträgt …
Annette liegt endlich in ihrem schmalen Bett, sinnt und träumt ein wenig vor sich hin, beobachtet den Mondstreif an der Decke, hört irgendeinen Nachtvogel fern gedehnt rufen, sieht das Biegen und Sichverschränken der Schattenzweige am Fenster – und endlich kann sie schlafen.
In ihren Schlummer schleicht sich vieles hinein, was früher war; sie klettert wieder als Zehnjährige auf den höchsten Punkt, den sie sich in der Wasserburg vorstellen kann, bis zu den Dachsparren des Turmes hinauf, die knarrende, steile, in der Hitze nach staubigem Holz duftende Treppe und bis zum Boden, wo das kleine runde Fenster hinausweist zu den Firsten ringsum, zu den Dohlenwohnungen und Krähenanflügen – und da irgendwo, unter einem Dachsparren, versteckt sie hastig etwas Goldenes: in Goldpapier gewickelt, ihr erstes Gedicht.
Sie spürt träumend und schauend einen unbändigen Stolz, keine Eitelkeit, aber Gewißheit: Sie hat gedichtet.
Und wie das mit Träumen ist – es bleibt ihr beim Erwachen ein Bild, eine Grundstimmung, eine Empfindung: begnadet, erwählt, bestanden.
Weiß Gott, bestanden? Hat sie denn getan, was ihr aufgegeben war? Mühsam richtet sie sich hoch, mit steifen, schmerzenden Gliedern, feuchter Schweiß dunstet den Rücken hinauf, die Augen sind noch eingeschleiert, trüb der Blick; es dämmert durch die Gardinen, sie hört Vogelschreie von drunten über dem Wasser.
Langsam steht sie auf, wäscht sich in der kleinen Porzellanschüssel – der Krug ist nur halbvoll, das Wasser kalt – so will sie vollends wach werden.
Sie zieht sich umständlich an – die vielerlei Unter- und Drüberhüllen sind lächerlich, die Tournure, die Schals – und zum Haareflechten kommt das Mädchen, das ihr ein Tuch umlegt und vorsichtig die angegrauten Strähnen kämmt und bürstet; sie reden kaum miteinander, der Morgen ist bleischwer.
Ich trage so viel Schicksal mit mir herum – was für ein großtönendes Wort – Geschick, Geschicktes …
»… solange noch das ew’ge Licht / Auf mich mit Liebesaugen blickt …« Das hat sie leise vor sich hingesagt, und das Mädchen hält einen Augenblick ein, es meint, sie bete.
Es war auch ein Trost, was sie sich da vorsprach, gegen den immer unterschwellig pochenden Vorwurf, sie habe nicht genug getan: der Mama nicht genügt, dem großen Anspruch ihrer Begabung, dem Leben.
Jetzt schaut sie hinaus in das aufsteigende Helle, über dem leise flutenden Element, dem gefurchten Wasserbett, sieht am Himmelsrand das Rote wachsen, das blitzende Gelb, in Streifen aus Ocker und Cadmium, Grün dazwischen, längsgedehnt über dem diesigen Grau. Da schwingen sich die Vögel in runden Bögen, als wollten sie ein lang geübtes Ornament tanzend aufzeigen, während vor ihnen, hinter ihnen und rings um sie herum die glühenden, blitzenden, schimmernden Lichtfunken springen, mit denen das große Wasser die Sonne grüßt. »Das ew’ge Licht« – da brennt es: Sonne, strahlende Königin, Bild und Thronsitz Gottes, mit dem Annette redet, graue Dohle, die sie ist, und doch sein Kind, sein gnadenvoll betautes Geschöpf.
Sie war wahrhaftig nicht immer »gnadenvoll betaut« gewesen, man hatte sie verächtlich die »Spillerige« genannt, weil sie mager, ungeschickt, unachtsam, tapsig und ungraziös genug war, um bei den Aufenthalten im »Krummen Timpen«, dem Münsterschen Stadthaus, keinen Ball ohne »kleines Debakel« zu überstehen, ohne Anstoßen oder Auffallen; und das westfälische Wort meinte auch ihre schmächtige Gestalt und das schmale, fast hagere Gesicht.
Die Mama sah ihr sorgenvoll nach, wenn man sie mühsam mit Schleifchen und Pölsterchen herausgeputzt zum Tanz mitnahm, obwohl sie mit den großen blauen »seetiefen« Augen hübscher war als Jenny …
»Gnadenvoll betaut« – das wußte eigentlich nur sie selber, und oft genug war sie sich dessen nicht sicher.
Das spürte sogar die Mama und forderte an den Leseabenden, wo man sang und musizierte, ihre Mitarbeit und Vorführung und machte sie damit manchmal verzweifelt und verstört und widerspenstig; nur wenn man sie bat, mit ihren Versen herauszutreten aus der verstockten Schüchternheit, riß es sie hin: Dann wurde sie nach den ersten Zeilen, die sie leise und stockend las, auf einmal ein anderes Geschöpf, glühend, sprudelnd, begeistert und sicher, und las im Fluß und Klang, als spräche ein anderes Wesen aus ihr. Nachher saß sie dann wie ausgeleert und erschöpft in der Sesselecke.
Im »Krummen Timpen« ist sie nicht so gern wie im Wasserschloß, obwohl es da trockener, wärmer, eigentlich behaglicher ist als draußen. Aber es ist »Stadt«, Häuser, von denen das Hülshoffsche eins der imposantesten ist, wo man Wagen vorbeikarren, -trappeln, -schleifen hört – Geräusche, keine Töne; Töne hat der Baum im Wind, die Blätter, die sprechen, die Zweige, mit denen jeder Baum anders reden will, und in denen kleine Vögel die Triller setzen zu einem leise gemurmelten Continuo, hüpfende schlüpfende Vögel, die über ihr die Blattkronen in ständiger Bewegung halten.
Und von unten, neben ihr, das glucksende Wasser, das still wartende, in dunklen Grüntönen und Braunschatten, auf dessen Fläche die Kreise aufbrechen, Rundbogen und konzentrische Bewegung, wenn ein schwarzer Fisch sein winziges Maul durch den Spiegel steckt oder eine Fliege auf dem Tümpel aufsetzt.
Die Mama betreibt freilich das andere, das Menschenwesen, das Gesellschaftsspiel und Formgetändel, andere Schönheiten, die Annette manchmal als Flitterkram sieht.
Jenny macht alles gutwillig und vergnügt mit, das umständliche Ankleiden mit geschnürter Taille, angesteckter Spitze, aufgetürmter Frisur und angenähten Seidenblumen.
Mitunter amüsiert es sie selber auch, die ernste Annette, die manchmal unmotiviert grell lacht, die immer irgendwo anders ist in Gedanken und Empfindung, andere Maßstäbe setzt, und die Leute um sich herum spüren läßt, daß sie sich eigentlich langweilt.
Dann sieht Frau von Droste zu ihr hinüber mit einem scharfen Blick aus sehr dunklen Augen, sie sagt nichts, schließt einen Augenblick die Lider, das Kind versteht …: Haltung, Würde, Benehmen, das alte Geschlecht, ein Adelsfräulein, die nötige erhoffte Heirat – alles in Rahmen und Schranke – jahrhundertelang erprobt und damit geheiligt. Die Mama nimmt dann nach solchen Abenden, genau beobachtend, das seltsame und eigentlich anstößige Talent des »Kindes« doch ernster und nicht nur als peinliche Absurdität.
Annette spürt das wohl, die vornehme Gerechtigkeit ihrer Mutter, den noblen Sinn, der keinem Unrecht tun will, wie die Freiin auch den Anvertrauten, Inst- und Dienstleuten, Flüchtigen und Armen als Verantwortliche gegenübersteht. Noblesse oblige – Adel verpflichtet.
Annette sieht das nicht bewußt, es ist ihr eingewachsen, wie es seit Jahrhunderten die Berechtigung bedeutet, über Land und Güter und Wälder und Weiden zu gebieten – Annette achtet das, verehrt die Mutter dafür, fühlt sich zugehörig und aufgehoben, sogar gehoben im Kreis einer erwählten Gesellschaft, der sie – von Gott – eingefügt worden ist. Nur: die Noblesse der herrscherlichen Mutter ist eine Duldung, fast widerwillige Langmut, hinter der die Zuversicht steht, das alles möge nur ein Übergang sein und »sich auswachsen«.
Annettes »Dichtereien« sind für sie scharfsichtige Spiegelungen der Wirklichkeit, keine Deutungen, nur Abbilder; und die lassen sich auch mit hübschen Aquarellen leisten, wie sie Jenny fertigt, mit feingekräuseltem Baumgewebe und exakten Perspektiven von Mauern und Türmen.
Am Vorhandenen, Gegebenen durfte ein Mädchen aus ihrem Kreis zustimmend teilhaben, nicht ergreifend, eingreifend, gestaltend, schöpferisch.
Aber endlich entdeckt Frau von Hülshoff, trotz aller vorsichtigen Scheu der Tochter, in Jennys Nähkasten ein Gedicht. Es ist nur ein Vers, kurz und vielleicht das Fragment eines langen Poems, das sie der lieben Schwester anvertraut hat, und Frau von Droste fühlt sich nicht sehr wohl dabei, ihn zu lesen – aber doch verpflichtet, es zu tun – Annette – ach, dieses bedrückende seltsame Kind!
Fesseln will man uns am eig’nen Herde,
Uns’re Sehnsucht nennt man Wahn und Traum,
Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde,
Hat doch für die ganze Schöpfung Raum!
Das tut nach Schiller: Versmaß und Rhythmus, auch der Gedanke ist schillerisch, denkt die Mama. Und seltsam männlich empfunden, das krasse realistische »kleine Klümpchen Erde« …
Sie haben bei ihren Leseabenden auch den »Don Carlos« gelesen – »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit« – und sind nicht so sehr der »Gedanken« wegen als vielmehr des riesenhaften, im Staatsganzen verderblichen Wortes »Gedankenfreiheit« ein wenig erschrocken. Man sollte nicht so weit gehen mit der Eigenmächtigkeit – und Annette, das Mädchen, schon gar nicht.
Aber es hat schon mancherlei Aufsehen gemacht, daß ihre Tochter, die sonst sonderlich, ja widerborstig schien, von belesenen Leuten wegen ihrer Reimerei bewundert wurde; und da man das nicht ungeprüft verwerfen und auch nicht kritiklos gutheißen konnte, fiel der Therese ein, den Professor Sprickmann beizuziehen, einen bekannten Literaten, der mit der Fürstin Gallitzin, höchster Dame des literarischen Münster, und sogar mit einigen ehemaligen Hainbündlern, halbverblühten Romantikern und Balladendichtern, verbunden war.