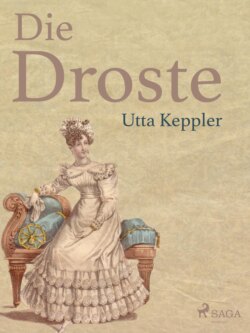Читать книгу Die Droste - Biografie von Annette von Droste-Hülshoff - Utta Keppler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
Der Weg zur Dichterin
ОглавлениеSprickmann, Anton Matthias, wohnte auf dem Krummen Timpen, dem Drosteschen Stadthaus gegenüber. Der würde, wenn er auch wohl das »Fesseln« in Annettes Vers nicht guthieß und nicht ernst nahm – das war tröstlich –, doch einen Ausweg wissen aus dem Irrsal, in dem sich die Tochter offensichtlich verfangen hatte, und das – erkannte Therese – konnte nicht ohne das Ventil des Dichterischen geschehen, sonst würde Annette kaum auf seine Lenkung eingehen.
Am Anfang des Jahres 1812, Annette war fünfzehnjährig, kam man bei einer Teevisite mit Sprickmann zusammen. Es war ein alter Herr mit rötlichem Gesicht, jugendlich aufmerksamen Augen, einem kleinen, schmalen Mund und einer auffallend hohen Stirn unter zurückgekämmten weißen Haaren.
Annette hatte ihn hie und da auf der Straße gesehen, und da er ihr nicht vorgestellt war, nicht gewagt, ihn auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt war sie sehr gespannt, ihn kennenzulernen.
Sie wurde unter Anleitung der Mama besonders sorgsam angezogen, und als sie sich im Spiegel betrachtete, lachte sie: dieser Aufbau von unten nach oben, auf breiter Basis mit vielerlei steifen Volants, Tüll und Gaze, in schmalem Dreieck nach oben getürmt bis zur hochgegürteten Taille mit den Schleifen zwischen Schinkenärmeln, und darüber, krönend, das winzige Kapotthütchen, das beim Tee nicht abgenommen wurde, zwischen den seitlich gebauschten Locken.
Aufgeputzt wie ein Paradepferd, nein, ein Zirkusgäulchen, dachte sie, fehlen nur noch die Glöckchen. –
Nun, der Professor saß behaglich zwischen dem rauschenden, aufgebauschten Damenflor und ließ gelassen Mißtrauen und Neugier um sich herum aufzüngeln, als Annette mit der Mama hereinkam.
Vorstellung, Knickse, Annette ist blaß, verlegen, besinnt sich dann, von der Mama nach vorn geschoben, und reicht dem alten Herrn die Hand, der sie aufschauend nimmt. Er sagt freundlich: »Fräulein von Droste – ich habe davon gehört, daß Sie dichten.«
Das klingt reichlich unverbindlich, und die Mama, die mißmutig und ungeduldig dabeisitzt, fällt ein:
»Wir haben einiges derart mitgebracht.«
Annette hätte sich am liebsten in den Boden verkrochen, so peinlich ließ sich alles an.
Aber sie sagte »ja« und bat dann sehr leise, zuerst und vielleicht überhaupt etwas auf dem Clavichord vortragen zu dürfen – alles falle ihr da leichter.
Man wunderte sich, die Mama war ärgerlich, aber Sprickmann nickte heftig: Da die Baroneß Gedichte schreibe, wisse sie wohl selber, daß Musik und Lyrik enge Verwandte seien, und auch die griechische Sappho habe ja die Leier geschlagen. Also bitte!
Annette schaute ratlos zur Mama hinüber, da sie weder Noten bei sich hatte noch das Instrument kannte; aber endlich setzte sie sich vor den unbekannten Kasten, der ihr beinah feindselig seine weißen Tastenzähne entgegenbleckte. Sie strich darüber, um sie sich bekannt und vielleicht doch gefügig zu machen, und schlug einen Ton an, dann einen Akkord.
Daß ein paar Damen amüsiert und gelangweilt-spöttisch hinter den Fächern lächelten, merkte sie nicht. Aber jetzt schien das tote Ding da vor ihr doch aufzuwachen, sich ihren Fingern anzuschmiegen und bereitwillig das in Tönen von sich zu geben, was Annette von ihm wollte.
Das tat wahrhaftig anders als die gewohnten gewöhnlichen Stückchen; es ließ sich leise, fast ängstlich an, zeichnete kleine dünne Arabesken wie Filigran oder Eisblumen am Fenster, und fuhr dann in lauten, wilden Bögen über die Hörer hin, rhythmisch, gewiß, in große Gruppen geordnet, tönend wie Wellen, regenbrausend, windpfeifend, und versickerte mit einem zierlichen Gegenornament, im hohen Diskant, wie ihn das Chlavichord sonst gar nicht hergegeben hatte.
Danach saß Annette, die gefalteten Hände zwischen den Knien, mit gesenktem Kopf auf ihrem Stühlchen, schwindlig vor ungeheurer Anspannung, bis Sprickmann aufstand und laut händeklatschend hinter sie trat, so daß sie entsetzt zusammenfuhr.
Jetzt fühlten sich auch die übrigen Gäste veranlaßt, mitzutun, man schlug die behandschuhten Händchen gegeneinander, die Herren taten ähnliches, murmelten beifällig, einer verneigte sich vor der Frau von Hülshoff und gratulierte ihr.
Als dann der Professor doch nach den Versen fragte, sagte Annette mit einer rauhen Stimme, gleichförmig, wie angelernt, sie werde ihm etwas schicken …
Was sie da gespielt hatte, war ihr einfach so eingefallen – einfach? Das freilich nicht – sie hatte oft gespielt im engeren Kreis, und oft genug auch aufgeschrieben, was sie komponiert hatte; Notenlinien waren ihr früh zugebracht, früh die Harmonielehre beigebracht worden – der Vater komponierte, die Schwester auch, sie sang, und in den altadeligen Häusern war es üblich und beinah zwanghafte Sitte, daß man – und vor allem die Töchter – malte, schrieb, reimte, musizierte – mehr oder weniger begabt, nie überragend.
Denn auch in die wasserverschlossenen, begrenzten und beengten Sitze sickerten Gedanken und Gefühle ein, die in der geistigen Welt schwelten, schwangen und strömten; Annette spürte das wie Luft und Wasser um sich und in sich, es forderte sie und griff nach ihr, aufgeregte und überhitzte Empfindungen, Schwärmereien, die in ihrem Alter lagen, und die sich als eine manchmal unbändige Treibhausluft auch in den Strebungen der Dichter, der Künstler, im Stil der Freundschaften bewegten – seltsames Gegeneinander von schwärmendem Vaterlandsgefühl und Fremdenhaß gegen den korsischen Eroberer, und darüber edelste religiöse Begeisterung und Versinken in einer oft nebulösen Mystik, Sehnsucht nach einer Heldenvergangenheit und zugleich nach der Unio Mystica.
Freundschaften, glühende Briefe und Reime, gefühlsschwere Musik und solch jugendlich beschwingte und übersteigerte Luft wehten auch in die streng katholisch bestimmte Welt der Annette hinein: Es war nichts Krankes oder Abartiges, aber das Schöpferische in ihr dehnte sich glücklich bewegt, und sie verehrte, liebte demütig und manchmal kritiklos kluge Frauen, musisch regsame Männer, in denen sich aus dem Zug zur verklärten Vergangenheit gelehrtes Forschen und wissenschaftliche Akribie entwickelten.
Sie lernte die Brüder Grimm kennen, hörte, von Sprickmann vermittelt, aus dem Göttinger Kreis die Namen Hölty, Bürger, Klopstock ehrfürchtig nennen, die ihr schon anklingend bekannt waren; sie fühlte etwas in sich selber antworten bei Höltys schwermütigen, todahnenden Gesängen, und daß Leisewitz, nachher auch Schubart, den »Räuberstoff« bewegten, führte sie immer näher Schiller zu, in Gedanken, in Rhythmen, in einem untergründigen Gefühl, das sie sicherer machte.
Stärker als die Lyrik, als die ihrer Jungmädchenweichheit verwandten Verse, packte sie, was Sprickmann ihr an Balladen zubrachte.
Er erklärte ihr vielerlei Theorien, die sie halb lächelnd, höflich zuhörend, annahm; aber das Eigentliche, das Dramatische, Erzählende, das mit einem treibenden Takt vorwärtsgepeitschte Geschehnis, das nicht bloß Ereignisse spiegelte, sondern magische Hintergründe durchscheinen ließ, fesselte sie und weckte alles, was an unterschwelliger Erinnerung in ihr war, an Gespür für Wesen und Erleben der Vorderen, an Ahnung und Vision und an Hang zum Unheimlichen, Bedrohenden, Tödlichen.
Bilder standen auf, die sie, scharf umrissen und ganz leibhaftig, in sich sah und außer sich zu schauen meinte.
O wunderliches Schlummerwachen, bist
Der zartren Nerve Fluch du oder Segen? –
’s ist eine Nacht, vom Taue wach geküßt,
Das Dunkel fühl’ ich kühl wie feinen Regen
An meine Wangen gleiten, das Gerüst
Des Vorhangs scheint sich schaukelnd zu bewegen,
Und dort das Wappen an der Decke Gips
Schwimmt sachte mit dem Schlängeln des Polyps.
Das westfälische Erbe, das schwer zu tragende eidetische Traumsehen, wurde der »zart’ren Nerve« als Fluch bewußt – und war’s nicht nur in der schlaflosen Nacht; da lebte sie mit den verschollenen, verwehten Gestalten, die in grauen Mauern umgingen, mit den Geistern, die auch der schwäbische Kerner beschworen hatte, den sie freilich nicht kannte und zu dem, als einem Bruder im Geiste, dennoch manche Wurzel in ihr hinzog … eine Welt hinter der Welt, ans Makabre streifend, ans Pathologische fast, aber mit ihrer Kraft, ihrem Humor, ihrer geschliffenen Intelligenz im Gleichgewicht gehalten: ein junges Mädchen – ganz »aus dem Rahmen gefallen«, so andersartigfremd, daß es den Ratlosen und »Befremdeten« – im eigentlichen Wortsinn – anstößig wurde und zurückstoßend.
»Spökenkiekerisch« – allenfalls die ungehobelten Bauern konnten das sein in ihrem heidnischen Aberglauben … und es dichterisch zu verklären, war töricht und verwerflich, da es damit beinahe salonfähig gemacht wurde.
Sprickmann aber fand das bedeutend, er hatte Sinn für die großartige Form, auch wo sie noch unreif war, und trieb an, lobte, statt zu modeln. Er ließ die Sagenstoffe freilich nicht auf ihrer überlieferten Form beruhen, sondern schwellte und schweifte mit und um sie und taufte sie mit goldnem Flitter.
Anton Matthias Sprickmann dichtete selber, er war unter lauter Dichtern aufgewachsen, nach seiner Pensionierung von Berlin nach Münster zurückgekommen – er war achtzigjährig und ging mühsam an einem Stock. Er hatte Jura gelehrt, aber als Annette von der Mutter an ihn verwiesen worden war, schien ihm schon selbst Leben, Dichten und Denken wie eine freundliche rosige Wolke zu verschwimmen und er traute sich nur manchmal ein scharfes Urteil, kaum noch eine Verurteilung zu. Er starb drei Jahre nach seinem Zusammentreffen mit Annette, hinterließ ihr manche freundlichen Hinweise, Anleitungen und Anregungen und eine verehrende Erinnerung, die sie kaum noch im Eigenen zu bestärken brauchte.
Die Mama suchte weiter, war sie doch überzeugt, daß Annette irgendeine andere, literarisch zuverlässige Richtlinie brauchte, andere Hilfen und Anregungen als etwa die »regelrechte« Jenny, die sich so reibungslos in die Vorstellungen der Umgebung einfügen ließ, wo es auch darauf ankam, auf die jungen Männer Eindruck zu machen, Beziehungen anzuknüpfen …
Nein, Frau von Droste wollte keine Liebelei anbahnen, keinen irgendwie gearteten Flirt möglich machen, da sie Annettens Andersart und Besonderheit als etwas Verpflichtendes empfand.
Schließlich kam sie, da die Tochter sich völlig passiv in ihre Eigenwelt verkroch, auf den jungen Privatdozenten der Philosophie, Christoph Bernhard Schlüter, der seit seinem 30. Lebensjahr allmählich erblindete.
Als Annette ihn kennenlernte, wurde von den Ärzten noch mühselig um die Erhaltung seines Augenlichts gekämpft – aber die Netzhautablösung infolge eines physikalischen Experiments in seinem achten Jahr ließ sich nicht beheben, die Sehschwäche nahm rasch zu und Schlüter warf sich, auf der Flucht vor der Verzweiflung, in eine übersteigerte mystische Frömmigkeit wie in ein heilendes Bad, ohne Kritik, ohne andere Linien auch nur zu erwägen; er war sanft und duldsam, gleichmütig gegen äußere Schläge und Bedrängnisse.
Ihn glaubte Frau von Droste als beruhigendes Gegengewicht ihrer unruhig umgetriebenen Tochter anhängen zu müssen – als wäre einer luziden Flamme durch engere Mauern und gedämpfte Schattentöne ihre Heftigkeit zu nehmen.
Schlüter wurde also eingeladen, allerdings nur zu einem Zweiergespräch mit der Mama, und das führte endlich dazu, daß er Annettes Verse zuvor lesen wollte – denn ohne die, sagte er, müsse er alle Einflußnahme ablehnen.
Es kam nun, wie es beinah zu erwarten gewesen war, zu einer heimlichen Sendung an Schlüter, heimlich, das bedeutete, ohne Nachfrage bei Annette, die also keine Auswahl treffen konnte, vielleicht sogar alles verweigert hätte.
Die Mama schickte also einiges an ihn, dem es vorgelesen wurde; aber er fand alles zu schwülstig, zu pathetisch, zu getragen und im Grunde laienhaft, und Frau von Droste, die ihre gutgemeinte Unternehmung der Tochter gestanden hatte, mußte die bittere Niederlage zugeben – eine heimliche Genugtuung verbarg sie taktvoll: Also doch nichts mit der Rechtfertigung dieses sonderlichen Gehabes, nichts mit dem Argument gegen den neugierigen Klatsch der Verwandten und Standesgenossen, keine Entschuldigung; in ähnlichen Fällen hätte man vielleicht von Krankheit gesprochen und das Absurde damit erklären können – und ähnlich wie eine Krankheit erschien ihr im Grund, wenn sie sich ehrlich selber fragte, das »Talent« des Kindes, wenn man schon so sagen wollte, das Wesensfremde, was ihre eigene Tochter da so beängstigend umtrieb.
Annette schrieb damals einen Vers, den die Mutter – glücklicherweise – nie zu sehen bekam:
So hab ich hundertmal gefühlt
Und tausendmal hab ich gesehn,
Daß nichts so hart am Herzen wühlt,
Wo seine tiefsten Adern gehn,
Als, zürne nicht!,
Die Lippen drück’
Ich sühnend auf der Lippen Rand –
Als eine liebe rasche Hand
In guten Willens Ungeschick.
Daß in diesem »Ungeschick« die eingeborene, »eingefleischte« Abneigung des Altadels gegen geistige, musische (und dabei gefürchtete) Disziplinlosigkeit steckte, wie sie seit langverschollener Zeit dem kämpferischen Ritterwesen gegenüber dem geistigen, geistlichen Stand eigen war, wurde der Mutter nicht bewußt.
Die hockenden Buchstabenknechte in den Klöstern, denen, weil sie lesen und schreiben konnten, Bildung und Gelehrsamkeit anvertraut waren, empfand man als die gegebenen Kontrastfiguren des Herrn, des Kriegers, des beweglich Einsatzfrohen, Mutigen; sie waren untergeordnete Dienstleute, die allenfalls Tradition aufschrieben und festhielten, aber nicht aus eigener Kraft schufen.
Freilich waren inzwischen die Uradeligen belesene, gebildete Leute.
Doch gab es auch solche, die sich »ritterbürtig« dünkten, ohne es eigentlich zu sein, solche, die ihre Vornehmheit durch Geist zu ersetzen glaubten, den sie besser Geistreichelei genannt hätten. –
Adelig war die Frau von Bornstedt, von der nichts anderes zu erwarten war, als daß sie sich irgendwann einmal an Annette heranmachte und sich an ihrer »Dichterei« – wie sie sagte – zu wetzen versuchte. – Eine im Grunde törichte, unbedeutende Person, die mit ihrer Beckmesserei und ohne Gefühl für Echtheit das allgemeine Urteil in den Kränzchen und Teezirkeln bestimmte und die mit ihrem Genörgel der Frau von Droste keine Ruhe ließ, ehe sie nicht noch einmal und diesmal durch die Mehrheit, ihr Urteil bestätigt sah, ihr Urteil, daß Annette ein unlogisches, willkürliches, verschwommenes Gebilde für Dichtung ausgebe, und daß sie besser schwiege.
Annette schwieg ohnehin. Sie bat die Mama, nie mehr irgendeins ihrer Gedichte öffentlich preiszugeben, sie nahm ihr bitter übel, daß sie das schon Schlüter gegenüber ohne ihre Zustimmung getan hatte, aber sie war töchterlich-gehorsam genug, um auch diese Bitten nur schüchtern und angedeutet zu äußern.
Frau von Droste verstand bei aller liebevollen Einsicht nicht allzuviel von den Versen ihrer Tochter, nichts schwang da mit, nichts blieb als untilgbare Melodie in ihren Ohren, nichts als unvergängliche Erschütterung, als Erkenntnis, als Signum für das Bedrohend-Ungenannte in ihrem Sinn, so scharf ihr Verstand, so hell ihre Logik auch waren. – Ihr fehlte die Melodie, das Sensorium, das schlafend als Empfindung in ihres Mannes skurrilen Spielereien lebte.
Annette verlangte nach Widerhall, nach Antwort und Kritik. Aber das »Walter-Epos«, ihr erstes größeres Werk, ein Rittergedicht, das sie 1812 verfaßte, war von Schlüter abgetan worden. Sie verlangte nach der Zustimmung der verehrten Mama, aber die gab sie nur halbherzig. Ihr war nicht wohl bei den ekstatischen Aufschwüngen, den brennenden Augen der vorlesenden Tochter.
Annette selber fand schließlich einen Weg für ihr unstillbares Verlangen: In Bökendorf lebte die Stiefgroßmutter, die man in den Dörfern eine Heilige nannte, und die ihre große Kinderschar mit einer immer gelassenen Zuversicht regierte, die sie aus ihrer starken Frömmigkeit zog.
Da ihre jüngeren Kinder im Alter der Hülshoffschen waren, las sie auch Annette aus der Bibel vor, und ihre ehrfürchtige Gläubigkeit machte der empfänglichen Annette tiefen Eindruck.
Diese Großmutter von Haxthausen, Maria Anna, wies das Mädchen auf ein Thema hin, das es beschwingte: Annette sollte das »Geistliche Jahr« in Versen verklärend beschreiben, alle Kirchenfeste und das Erleben der Gläubigen schildern, ein großes Epos oder einen ausgedehnten Gedichtzyklus gestalten.
Annette verehrte die Großmutter herzlich. Ihr Anliegen nahm sie willig auf und begann, das Kirchenjahr in Versen auszudeuten. – Und diese Verse endlich erschlossen Schlüter den Weg zu Annettes Dichtertum.
Erwacht! der Zeitenzeiger hat
Auf die Minute sich gestellt;
Dem rostigen Getriebe matt
Ein neues Rad ist zugesellt;
Die Glocke bebt, der Hammer fällt.
Wie den Soldaten auf der Wacht
Die Ronde schreckt aus dumpfer Ruh’,
So durch gewitterschwüle Nacht
Ruft uns die Glockenstimme zu:
Wie nennst du dich? Wer bist denn du?
Ist es ein schwacher Posten auch,
Auf den mich deine Hand gestellt:
So ward mir doch des Wortes Hauch,
das furchtlos wandelt durch die Welt,
Ob draus es dunkelt oder hellt.
Der Weckruf, den Annette in diesen Versen gestaltet und der sie so mächtig getroffen hatte wie er den erstaunten, erschütterten Schlüter berührte, kam aus ihrem Innern, ihrem religiösen Leben, dem Schlüter mehr und mehr aufhelfen wollte; er sah in solcher Hilfe die Rettung für ihre Unruhe, für ihr Genie, das ihm immer deutlicher aufging, und zugleich einen Weg im Sinn ihrer frommen Mama.