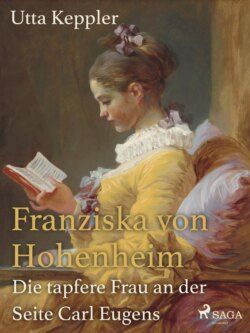Читать книгу Franziska von Hohenheim - Die tapfere Frau an der Seite Carl Eugens - Utta Keppler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pforzheimer Jahre
ОглавлениеAnfang Juli 1765 wurde die Hochzeit gefeiert. Franziskas Hand „war dem Freier gewährt worden“, wie es Frau von Bernerdin ausdrückte. Das Paar wurde in Adelmannsfelden getraut; die bescheidene Mitgift von 1500 Gulden hatte Leutrum ohne Kommentar hingenommen. Nach der Feier zog er mit seiner jungen Frau nach Pforzheim.
„Du mußt dich mit ihm arrangieren, Kind“, hatte Frau von Bernerdin beim Abschied geflüstert, als ihr Franziska weinend um den Hals fiel. Der Vater hatte ihr kurz die Hand gedrückt und den beiden „Gottes Beistand“ gewünscht; er verbesserte sich schnell und wünschte „Gottes Segen“.
Franziska sah sich angstvoll in der neuen Umgebung um. Sie hatte das Gefühl, der Atem sei ihr abgeschnürt, alles bedrückte sie: das Palais mit seinen vielen Zimmern, der kühle Luxus – nichts Wohnliches, Atmendes spürte sie, kein Behagen. Auch die Dienerschaft war nur korrekt und verhielt sich unpersönlich. In Adelmannsfelden hatte sie die Köchin seit den Kindertagen gekannt, Knechte und Mägde waren mit ihren Sorgen und Freuden gekommen, und jedes kleine Ereignis im engen vertrauten Kreis hatte man weitschweifig beredet. Die Schwestern waren da gewesen, zutraulich und nah, und sogar den steifen schüchternen Weber vermißte sie jetzt wie einen Bruder und betrachtete manchmal heimlich das Zettelchen mit seinen Versen, das sie im Schmuckkasten verwahrte.
Hier in Pforzheim mußte sie den ganzen Tag gesammelt und gefaßt sein, überlegte Befehle geben und sich halten wie die Dame eines großen Hauswesens, sicher, gelassen, ohne Gefühl fast … und sie war sechzehn Jahre alt.
Leutrum ließ sie viel allein. Manchmal kam er unangemeldet von der Jagd oder aus der Residenz zurück, mit mißtrauischen Augen. Sie fürchtete sein Auflauern; oft horchte sie lange, ehe sie einschlief, auf ein anschwellendes Wagenrasseln und zuckte zusammen, wenn das Hufgetrappel vor dem Haus anhielt.
Im Winter, wenn Schnee und Nässe auf den Gassen alle Laute verschlangen, saß sie noch gegen Mitternacht wach, in den Nachtrock gewickelt, und las in einem geistlichen Buch.
Jetzt, im frühen Februar, waren die Nächte feucht und stürmisch. Sie sehnte sich nach Schlaf, dem gesunden Kinderschlaf, den sie in ihrer Heimat ungesucht genossen hatte. Sie wünschte sich wenigstens ein Gespräch, zumindest einen Bericht, da sie doch von allem ferngehalten wurde, was ihr Louise tröstlich und ausgleichend vorgestellt hatte: von den Feiern bei Hof, von den Bällen und Redouten und Theaterabenden, die sie früh verachten gelernt hatte nach den Schilderungen des Vaters und die doch ihre Neugier lockten.
Leutrum nahm teil daran, mit einem ihr unverständlichen Eifer betrieb er alles, was den Hof anging; und dabei schien es ihm kaum Vergnügen zu machen. Vielleicht war es nur eine immer wiederholte Probe auf seinen Einfluß dort – und eine immer neue Enttäuschung, ging es ihr durch den Kopf.
Diesmal gab es eines der „großen Wiegenfeste“, eine Maskerade, wie Leutrum beiläufig erwähnt hatte, zu Ehren des „unsterblichen Carl“ und zum Lob seiner Geburt … Sie stellte sich den wirbelnden Glanz vor, den unübersehbaren Schimmer und Flitter, und dazwischen den Mann im violetten Schoßrock, gequält und quälend: den ihr vom Vater und von Gott verordneten Gemahl. Sie nahm das Buch wieder zur Hand, Gellerts „Geistliche Oden und Lieder“. Ächzend fing sich der Wind im Kamin. Die Kerze knisterte. Vor ihren Füßen schlief der große Setter, schnaufte im Traum und warf den dicken Kopf zur Seite. Er roch scharf, wie Hunde mit nassem Fell. Franziska bückte sich und rührte vorsichtig an seinen starken haarigen Nacken, ob er feucht sei. Jäh sprang das Tier auf die Füße und fauchte sie zähnefletschend an.
„Tyras!“ schrie sie, „kennst mich nimmer?“
Er schob sich schräg an ihren Stuhl, im Halblicht funkelten seine Pupillen, als glühten sie. Franziska zog die Füße auf den Sitz. Jetzt legte der Hund die Ohren flach, die steingelben Augen blieben unverändert auf sie gerichtet. „Komm doch her, du“, versuchte sie zu locken, wie sie das bei der Dogge zu Haus getan hatte, wenn sie knurrte. Aber dieser hier, Leutrums Eigentum, blieb unerreichbar, fremd. „Er ist verdorben“, dachte sie schaudernd, „vielleicht hat er ihn heimlich geprügelt und geplagt, und er hat mich nie als zugehörig empfunden.“
Tappend kreiste das Tier um sie, näher jetzt, und sträubte die Rückenhaare.
Da knarrte die Treppe. Der Hund drehte sich um und trabte zur Tür, die Leutrum von draußen aufriß. Franziska sank im Stuhl zusammen.
Leutrum jagte den Setter in die Ecke, dann kam er langsam an ihren Sessel heran. „Du brauchst dich nicht zu fürchten“, sagte er mit unsicherer Stimme, seine trockene Hand lag auf der ihren, sie sah erstaunt hoch; sein Hals war gestreckt, die schmalen Lippen klafften! „Nicht fürchten“, wiederholte er, „komm doch, bitte!“
Sie sah ihn starr an. „Komm her, du!“ hatte sie eben selber den Hund gelockt, während die Angst sie würgte. Hatte der da auch Angst? Wovor? Vor ihr, ihrer Abwehr? Sie kannte diesen scheuen Ton und hatte auf einmal Mitleid. „Du hast’s ihn nicht geheißen?“ flüsterte sie, bereit ihm zu glauben. Vor ihrem unfreien Lächeln schoß ihm der Zorn ins Gesicht. „Und wenn – wenn ich’s einen Hund heißen könnte, einen Funken aus meiner Frau zu schlagen, und wär’s vor Schrecken!“, keuchte er, „einen Funken, ein Echo aus deinem stumpfen, lahmen, faden Gleichmaß! Nichts, nichts! Man hat mir gerühmt, du seist lustig, voller Einfall und Narretei, was Blitzhelles hättest du, was Neckisches und Springendes und … und … bei mir …“
Franziska stand auf und strich über ihren Rock. „Gut Nacht, Reinhard“, sagte sie und ging ihm voraus, „ich geb’ mir ja Müh’, ich bin deine Frau.“ Leutrum machte keine Anstalten, seine Frau dem Herzog vorzustellen. Sie selber fragte nicht und ließ es bei seinen wortkargen Auskünften. Natürlich hörte sie trotzdem immer wieder von den „superben Lustbarkeiten“, sah Wagen und Tragsessel vor ihren Fenstern, die zu den Pforzheimer Banketten hasteten, erfuhr durch die Dienerschaft, was es in Ludwigsburg an Sensationen und modischen Extravaganzen gäbe. Schließlich erkundigte sie sich bei ihrem Friseur. Joseph Flasch schwatzte angenehm und machte dezente, beinahe überzeugende Komplimente, die Franziska Wohltaten; er kam aus Ludwigsburg und war an den Umgang mit den Damen des Adels gewöhnt.
„Flasch“, fragte sie eines Morgens, während er mit der Brennschere hantierte, „hat Er die Toscani schon gesehen? Man sagt, sie sei über die Maßen reizend!“
„Madame“ – Flasch zupfte an einer Locke – „die Toscani darf man nicht mehr als reizend ansprechen, seit sie hinter der Bonafini zurücktreten mußte! Das ist sogar schon eine ganze Weile her.“ „Ach, Bonafini? Den Namen hab ich doch schon gehört? Ich vergaß … Was ist eigentlich mit der?“ „Eine Sängerin italienischer Abkunft, die Serenissimus seit dem Frühling schon mit seiner Gunst beehren.“
„Gunst? Er meint doch nicht?“
„Oh, Madame …“, seufzte Flasch, erschüttert über ihre Unschuld. Franziska sagte nichts mehr; sie sah mit gesenktem Kopf von unten her in den Spiegel, wo sich Flaschs hagere Figur hinter ihrer rosa Morgenrobe dunkel abhob. Er flüsterte: „Die erwählten Damen tragen blaue Schuhe …“
Franziska wurde rot; sie wollte sich nicht vorstellen, daß ein Souverän, ein würdiger Vater seines Volkes, ein von Gott berufener Regent, ein … Schwabe sich wie ein Pascha benehmen sollte oder wie der französische Ludwig. Aber Flasch fühlte sich durch das Vertrauen der Baronin geehrt, er konnte der Versuchung nicht widerstehen, seine Hintertreppengeschichten loszuwerden, zumal ihn die Reaktion der naiven Frau belustigte. Serenissimus habe mehrere natürliche Söhne beim Heer, schwatzte er weiter, man rede von sechsen, und eine Anzahl Töchter im Lande. Auch seien Mädchen aus angesehenen Häusern einfach weggeholt und die Väter nachher dekoriert worden. Der Minister Graf Montmartin und sein Intimus Wittleder seien da brauchbare Instrumente.
„Ich kann mir das nicht länger anhören, Flasch“, sagte Franziska endlich erschöpft, „von den Gefangenen und den Verkäufen der Ämter habe ich erfahren, wenn auch nicht durch meinen Gemahl … der sagt nie etwas davon und will auch nicht darüber ausgeforscht werden. Aber jetzt muß ich ihn direkt fragen, ohne Umschweife! Wie soll ich denn an so einen Hof gehen und einen Knicks machen, wenn ich das weiß?“
Flasch schwieg erschrocken. „Euer Gnaden“, flüsterte er sehr förmlich, „vergeben mir Euer Gnaden gütigst, aber der Herr Baron von Leutrum dürfen in keinem Fall auch nur einen Schimmer von dem erfahren, was ich – etwas übertrieben und ausgeschmückt – der gnädigen Frau erzählt habe. Der Herr Baron sind Hofbeamter und ich …“
„Ach, Flasch, das laß Er meine Sorge sein, er braucht ja nicht zu ahnen, wer mir’s gesagt hat.“ „Madame, er wird es bald genug herausbringen, wenn Sie auch nichts verraten …“ Flasch trat bedrückt beiseite. „Wenn mich die gnädige Frau je ein bißchen geschätzt haben, meine treuen Dienste, dann bitt ich flehendlich um Ihr Schweigen! Mir steht noch das verzweifelte Gesicht meines Coiffeurmeisters vor Augen, des Reich, den man ohne Verhör und Verhandlung im September 56 hat verschwinden lassen, zuerst auf den Hohentwiel und danach auf den Asperg; er ist seit ein paar Jahren frei; ich weiß aber nicht, ob er noch lebt.“
„Der Reich?“ fragte Franziska erschreckt, „und warum ist der verhaftet worden?“
„Ich darf nicht noch mehr sagen, Frau Baronin. Ich fürcht, ich hab mich so schon ins Unglück geredet, der Reich hat damals nichts anderes getan als ich eben.“
„Flasch“, sagte Franziska erschreckt, „ich versprech’ Ihm, daß ich nicht nachfragen werd’, ich versuch’ das alles zu vergessen, als wär’s nie gewesen .. so gut ich’s halt kann.“
Sie stand vom Putztisch auf und entließ den blassen Flasch mit einem beruhigenden Lächeln.
Der Sommer ging hin. „Hier in Pforzheim hab’ ich nicht viel von Blumen und Bäumen, auch wenn du mich ausfährst, Reinhard“, sagte Franziska traurig, „laß mich doch einmal heim nach Adelmannsfelden, ich hab’ dort viel zu bereden, meine Kleider möchte ich selber in Ordnung bringen, und erst kürzlich ist mein Vater krank gewesen – wer weiß, wie lang er’s noch macht.“
„Unsinn, Frau“, Leutrum sah kaum auf und duckte den großen Kopf hinter einem Nachrichtenblatt, „dort ist nichts für dich zu lernen, was einer Dame von Stand zukommt, zwischen den Kühen und Geißen und Hennen – was willst du bei denen?“
„Du hast mich da herausgeholt und hast gewußt, woher ich kam“, sagte sie vor sich hin; dann hob sie die Augen, als hoffte sie, doch noch verstanden zu werden. „Es sind ja die Eltern und es ist ein altes, gutes Geschlecht – nichts Unrechtes haben sie mir mitgegeben.“
Leutrum wurde das Thema langweilig. „Geh, wenn’s dir so viel gilt“, warf er hin, „aber bleib nicht zu lang – ich mag mich nicht anstieren lassen, nur weil meine Frau nicht hier ist.“
Sie schaute auf, spürte seinen unsicheren Blick und fürchtete, er nähme die Zusage zurück. „Danke – das ist eine gute Aussicht –“, sprach sie schnell in sein Gesicht hinein. „Der Herbst ist schön bei uns, ein paar Wochen beim Äpfelpflücken … und die große Stube ist warm und gemütlich.“
Leutrum sagte nichts mehr. Er rief den Hund, der in der Ecke schlief, und ging hinaus. Unter der Tür drehte er sich um. „Du dozierest heut wie ein Buch und gar nicht mehr so schwäbisch – ist das dem Heimfahren zulieb?“
Franziska mußte ihm innerlich recht geben. Unbewußt wurde ihre Sprache steifer und gemessener, wenn sie mit Leutrum zu tun hatte, weich und ohne Zwang fühlte sie sich nie bei ihm. Aufwachen und keine Angst haben, dachte sie sehnsüchtig, und sich nicht grausen vor dem, was am Abend war und wieder sein würde!
Ein paar Tage später kam er angetrunken heim – er sah häßlich aus, wenn er, verschwollen vom Wein, mit glitzernden kleinen Augen, in einer meckernden Angeregtheit hereintrat. Franziska kannte ihn so. Aber sie hatte in den Monaten, die sie mit ihm zusammenlebte, gelernt, ihm zu begegnen: mit freundlicher Aufgeräumtheit, damit er nicht spürte, wie sie sich zusammennahm. Ruhig, mit einer Handbewegung, lud sie ihn zu sich ans Tischchen, das ihr die Zofe gerade gedeckt hatte. Sie schenkte ihm Tee in ihre Tasse, noch ehe eine zweite gebracht wurde, lächelte und reichte ihm Konfekt. Dann erzählte sie beiläufig, der Medikus Raiser sei eben dagewesen, nur einer privaten Visite halber, ohne Anlaß. Und er habe sie gefragt, warum sie so durchscheinend blaß aussehe, und sie habe ihm gesagt, es sei leider nicht das, was sie gern als Grund gesehen hätte; er habe darauf gemeint, so möchte sie doch die Landluft suchen, ein paar Wochen, das helfe oft auch dazu.
Leutrum nickte verlegen und riet jetzt selber, aufs Land zu reisen. Sie werde glücklicher, robuster, lebhafter zurückkehren.
Schon zwei Tage später fuhr Franziska nach Adelmannsfelden. „Ich hab’ geschwindelt“, beichtete sie abends Louise, „denn es wär mir bang und angst, wenn ich Kinder haben sollt vom Leutrum; aber darauf hat er mich endlich reisen lassen.“
„Morgen kommt Besuch, oder eigentlich nur einer, der sich vorstellt“, berichtete die Schwester später, „ein junger Mann, der sich beworben hat, den Kleinen Unterricht zu geben. Der Dorfschullehrer ist ein Schafskopf, und den Weber hat ja der Vater verjagt – leider!“
Anderntags rückte in einem rumpeligen Postwagen ein Mann an, der sich erst von der Station zum Schloß durchgefragt hatte, ein rundlicher, rotbackiger Mensch, nicht allzu ordentlich angezogen, mit kleinen feurigen Augen und einer hohen Stirn. Er kam aus Geislingen, wo er Schullehrer war, und hieß Friedrich Christian Daniel Schubart. Franziska führte ihn zum Vater, und solange er auf den Freiherrn wartete, unterhielt sie ihn munter; seit sie wieder zu Hause war, schwatzte sie gern. Er stellte sich vor, mit einem ungewandten Bückling, bei dem ihm das Blut in die Stirn schoß. Der dunkelblaue Schoßrock stand hinten weit ab, die Gestalt wirkte im Aufrichten voll und gedrungen; das ließ ihn älter erscheinen als er war, achtundzwanzig Jahre …
Die flinken klugen Augen intensiv auf die junge Frau gerichtet, seufzte er: „Solche Mode und solche Haare und Hände gibt es freilich nicht zu Geislingen, und daß es sie zu Adelmannsfelden im Ellwängischen gäbe, hätt ich niemals gedacht!“ Franziska lachte ihn an. „Nein, bei meiner Ehr!“ schwärmte Schubart weiter, „da wird man zum Dichter, so man’s nicht eh schon ist! Der Lippen Purpur, ihre Wangen / Dran tausend Amoretten hangen …“
Sie lachte lauter. „Herr Schulmeister, das wär’ aber ein bißle schwer – da hätt’ ich demnächst die reinsten Hängebacken von Ihren tausend Amoretten!“ rief sie.
„Es kommt mir von selber, das Reimen“, entschuldigte er sich, „es fließt wie geschmiert, so das Fäßlein angestochen wird!“
„Ich hab’s aber nicht angestochen!“ Sie konnte vor Vergnügen kaum sprechen. „Und wenn der Herr Vater Sie so reden hört, Herr Schubart, stellt er Sie bestimmt nicht ein für die Juliane und die Eberhardine, das kann ich Voraussagen!“
Der junge Dichter setzte eben zu einer neuen Beteuerung an, als der Freiherr hereintrat. Eilig, sorgenvoll und kritisch beschaute er den Aspiranten, der hastig aufgesprungen war.
„Er kommt aus Geislingen und ist gebürtig aus Aalen?“ fragte Bernerdin streng.
„In Aalen aufgewachsen, aber geboren zu Sontheim.“
„So, so, evangelisch?“
Sein Vater sei Diakon zu Aalen, erwiderte Schubart.
„Gut.“
Und er sei jetzt in Geislingen Lehrer, aber wenig befriedigt – ein geringes Entgelt, obwohl er nicht anspruchsvoll sei, und in der Schule schmutzige Buben, ungebärdige und …
„Schon recht“, unterbrach der Freiherr, „das kennen wir alles. Fragt sich aber, was Er weiß!“
„Ich bin Theologe, wiewohl kein fertiger Pfarr’“, kam die Antwort kleinlauter, „und beherrsche die griechische und lateinische Sprache, Französisch hab ich mir eingetan, Orgel spiel’ ich und das Clavizimbel, auch Harfe und Gitarre und Flöte.“
„Da ist Er ja mehr ein Musikus denn ein Lehrer?“ „Sprache und Stil üben ist meine Freude – bin im Briefwechsel mit dem Wieland aus Biberach und dem Haug und Böckh …“
Dem Baron sagten die Namen nichts. „Kann er überhaupt mit kleinen Mädchen umgehen? Die meinen sind zwölf und acht, Mann!“
„Ich hab’ selber ein Julchen“, erklärte der Besucher scheu und leuchtete auf dabei, „ein herzig’s Ding! Lernt grad laufen! Und ein Söhnchen hab’ ich auch, Ludwig.“
„So, so“, machte Bernerdin und schaute sich den möglichen Lehrer seiner Töchter genau an. „Und wie kommt Er vom Schuldienst frei?“
„Das ist keine Sorge, Herr Baron, das ist wie der Aufflug eines Vögleins aus der Misere, aus dem engen, dreckigen Nest unterm Stalldach – das will ich schon schaffen!“
Er müsse aber doch noch Zeugnisse haben, sagte der Freiherr, über Gebaren und Lebenswandel und sittliche Führung, und seine religiöse Stellung sei wichtig, da er ja anscheinend die Theologia nie ganz zu Ende geführt habe – wieder streifte ein herrischer Blick den Bittsteller –, „und, Er sieht mir aus, als sei Er dem Glase nicht abhold gesonnen!“
Schubart wurde rot; er ärgerte sich. „Ich bin ein Dichter, halten zu Gnaden, hab’ bekannte Poema drucken lassen und bin auch Organist und Chorleiter; mein Schwieger ist der Oberzoller von Geislingen, ein geachteter Mann …“
„Hab’s gehört“, brummte Bernerdin. „Mit denen Poeten hab ich nicht die besten Erfahrungen gemacht!“
Franziska mischte sich erschrocken ein. Es wäre doch gut und hilfreich für die Mädchen, wenn sie einen so vielseitigen und vielbekannten Mann zum Lehrer bekämen, meinte sie drängend.
Der Vater nickte; er wolle die Mutter noch fragen. Schließlich kam ein freundlicheres Gespräch zustande, bei dem nur die Lohnfrage noch nicht ganz geklärt war. Immerhin verlangte Schubart auch eine Wohnung für seine Familie. Und leben müsse er halt, leben! sagte er ganz schwäbisch und dehnte die Arme. Und so wolle er also wieder heimreisen und warten, bis ihm der Freiherr Bescheid gebe; er werde indessen mit seinem Rektor reden.
Im Hinausgehen fiel ihm ein Clavichord auf, das in der Zimmerecke stand; es wurde nie gebraucht, war ein altes Familienstück, das Frau von Bernerdin eingebracht hatte und das reichlich heiser zirpte. Aber Schubart stürzte sich darauf in einem jähen Impuls. „Gestatten Sie mir, ein kleines Weilchen zu spielen, Euer Gnaden?“ fragte er flüchtig und saß schon auf einem eilig herbeigezogenen Stühlchen vor dem Instrument.
Bernerdin unterdrückte sein Befremden und, da die Mutter und Franziska nickten, hob Schubart den Deckel auf; seine Schülerinnen hatte er noch nicht einmal gesehen. Während er die Tasten probierend anschlug und den geöffneten Kasten untersuchte, um zu stimmen, traten die Töchter schüchtern ein, Juliane und Eberhardine, beide blond, mit großen Augen, schmal und noch zarter als Franziska und Louise; auch die zeigte sich hinter ihnen.
Und als endlich – man holte bereitwillig Zangen und Hebel – das alte Klavier ein wenig klarer klang, spielte Schubart, hingerissen von den Tonfolgen und Akkorden, die ihm wie eine Quelle unwillkürlich unter den Fingern sprangen, Händelphantasien und eigene Improvisationen, und er hörte erst auf, als Bernerdin sich hörbar räusperte. Dann knicksten die beiden Kinder.
Schubart sah sie kaum an, er grüßte eilig, schob heftig den Stuhl weg und ging so befangen fort, als habe er zuviel von sich preisgegeben.
Später, als Franziska längst wieder in Pforzheim war, fragte sie einmal im Brief nach dem neuen Hauslehrer. Es sei nichts draus geworden, beschied sie die Mutter knapp, der Schwieger Oberzoller aus Geislingen habe sich eingemischt, dem Vater Unerfreuliches über den Eidam mitgeteilt, sich auch geweigert, des Jungen Schulden zu zahlen, die er seiner losen Führung danke, und so habe auch der Dichter resigniert, bitter ungern, wie es in seinem Abschiedsgruß geheißen habe, und sei weiterhin Schulmeister zu Geislingen geblieben, bis sich ihm Besseres zeige.
Am Hof in Ludwigsburg wurde Leutrum nach seiner jungen Frau gefragt. Verdrossen gab er Bescheid, sie sei eben vom Land, und er bemühe sich, sie heranzubilden.
Daraufhin trafen ihn spöttische Blicke; man werde ja sehen, hieß es: entweder sei sie ausnehmend schön oder so häßlich, daß er sie keinem anderen als dem eigenen Auge aussetzen möge. Natürlich hatte man längst durch Bedienstete das Nötige gehört. Leutrum – besorgt um seine Stellung bei Serenissimus – bequemte sich zum Nachgeben, Er schenkte Franziska zum zwanzigsten Geburtstag ein Brillantarmband und bemerkte beiläufig, sie könne es ja bei Hofe zeigen. So ließ sich nicht länger vermeiden, daß die Frau Baronin von Leutrum aus ihrer Verborgenheit hervortrat. Man lud sie, nach Leutrums entsprechenden Andeutungen, „dringlicher als seither“ zu einer Soiree bei Hofe ein.
Zu Ehren des englischen Gesandten war im Januar 1769 ein Galadiner angesetzt worden. Die Leutrums wohnten schon seit ein paar Tagen in ihrem Ludwigsburger Stadthaus. Man hatte eine französische Zofe angestellt, Lisette Touchon, ein schmales dunkelhaariges Wesen, das Franziska mit biegsamer Ergebenheit bediente. Flasch war – stiller als sonst – angetreten und hatte auf ihrem Kopf ein Gebäude aus blonden, duftig gepuderten Locken aufgetürmt, blaue Bänder hineingewirkt und eine Rose aus einer blitzenden Agraffe hervorwachsen lassen. Er war zufrieden mit der Kaskade aus Natur und Künstelei, die ihm gelungen war, und beriet Franziska schüchtern über Wangenpuder und Lippenrot – es dürfe kräftiger sein als das der Männer – und über den charmantesten Punkt für das schwarze Schönheitspflaster. Die Touchon steckte und nestelte an dem gerafften Mieder, strich bewundernd über das Unterkleid aus Silberspitze und den faltigen Überrock aus schwerem Satin; dann führte sie die Hasenpfote puderstäubend über Franziskas Arme. Aus dem Spiegel sah sich die Geschmückte an wie ein buntes Pastell. Sie wußte, daß sie nicht eigentlich eine Schönheit war: Nase und Lippen waren „un peu trop“, wie Leutrum einmal taktlos bemerkt hatte, der Mund zu groß, die Nase eine Idee zu lang, ihre Flügel zu voll. Aber große, schimmernde Augen überstrahlten das alles und machten es unwichtig.
Franziska wandte sich vom Spiegel ab. Sie kannte sich selber noch nicht, mit zwanzig Jahren. Sie lebte nicht ihr eigenes Leben, hineingeworfen in ein völlig fremdes Dasein wie in widriglaue Luft. Immer noch, immer wieder sträubte sie sich dagegen, verwies sich ihren Abscheu, versuchte sich zu fügen. Sie sah sich wieder an. Wenn sie mit einem lieben, wohlgeratenen Mann zum Ball gehen dürfte! Sie hätte zwar keinen von Leutrums Freunden neben sich haben mögen, keine der höfisch gedrillten Kreaturen, die er gelegentlich zu einer Partie Tarock heimbrachte …
Sie drehte sich halb um. „Fertig, Lisette?“
Die Zofe hatte noch dies und das zu verbessern, wischte rasch über die weißseidenen Schuhspitzen, den rüschenbesetzten Rocksaum, dann verneigte sie sich und trat zurück.
„Oh, comme vous êtes belle, Madame!“
Franziska lächelte gutmütig. Sie schaute noch einmal in den Spiegel. Hinter ihr trat Leutrum herein; sie grüßte ihn mit einem steifen Nicken. Er trug das Haar hochtoupiert und schneeweiß gepudert, das gelbe Gesicht war noch fahler als sonst über seinem Frack von leuchtend violetter Seide. Er hatte Schmuck angelegt, Ringe, Busennadeln, zwei kostbare Sterne am Rock. Ironisch lächelnd verbeugte er sich, so weit es sein Buckel noch erlaubte, und bot seiner Frau den Arm.
Der Saal im Ludwigsburger Schloß war groß und hell. Kerzenbündel versprühten ihr Licht wie kleine Sonnen. Alles flammte vor Franziskas Augen. Sie unterschied nichts einzelnes mehr: Warmer Schwall, Duft und Menschendunst, Geplapper und Geklapper, Farben, Farben … schwingendes, luftiges Blau – schwang die Farbe oder das Kleid? Drehten sich die Tanzenden oder der Raum? Rot und Rosa, Safran und dunkles Gold, Lockentournüren, grelles Geblitz’ von Brillanten und immer wieder die wehenden Wolken, eine gelbe, eine grünliche, eine, die silbern zitterte … sie tanzten jetzt in Reihen gegeneinander.
Dann erst wurde Franziska die Musik bewußt; sie klang wie ein Geschlinge von tönenden Bändern, federndes Geigenzirpen huschte darüber, und der leise, exakte Rhythmus der Begleitung pochte wie Insektensummen am Fenster.
Franziska wurde erst ganz wach, als Leutrum sie hart am Ellenbogen faßte. Sein scharfes Flüstern verstand sie nicht. Er schob sie gegen eine Art Podium hin, wo goldene Sessel schimmerten. Zwischen den Stühlen da oben war Unruhe, Diener gingen hin und her. Sie zwang sich zur Sammlung – Leutrums erregtes Zucken und Nicken sollte sie auf irgend etwas aufmerksam machen, aber sie sah nur verschwommen, was vor ihr war: Aus einer Tiefe von rotem Samt, vor einer dunkel gewölbten Folie, wandte sich ihr ein großes rosiges Gesicht zu, die glatte Fläche wurde kaum präziser vor ihrem Blick, als sie den Kopf vorsichtig hob.
Wenn der Herzog sich jetzt an Louises Bittgang erinnerte? Was dann?
Das alles verging in Sekundenschnelle, während Leutrum sie ärgerlich zum Hofknicks niederzog. Sie dachte nur daran, sich richtig zu benehmen, die Hände am zurückgerafften Kleid. Beim Aufrichten erkannte sie aus den Augenwinkeln Leutrums zufriedene Miene, und beruhigter ging sie in bescheidener Haltung mit ihm vorwärts. Ein Kämmerer beugte sich über den dunkelroten Sessel, hauchte dem Thronenden ins Ohr, der gedankenlos nickte; er straffte sich und zerrte das verschobene Ordensband über die glitzernde Weste, dann kniff er die Lider zusammen. „Ihre Frau, Leutrum, ist eine Bernerdin?“ fragte er mit überraschend jugendlicher Stimme.
Franziska wagte ein schnelles Aufschauen.
„Wie lange sind Sie verheiratet, Madame?“ erkundigte sich der Herzog beiläufig und wandte sich schon zur Seite, während Leutrum eine beflissene Antwort zustande brachte. Franziska kam gar nicht zu Wort. Dann traten die beiden zurück in die wartende Reihe.
Leutrum wurde kurz danach die Würde eines herzoglichen Kammerherrn verliehen.