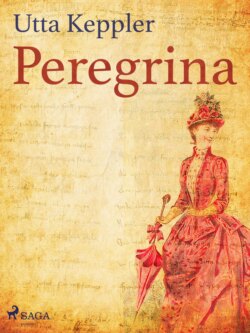Читать книгу Peregrina - Utta Keppler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеSpinnwebschaukel
Als er sie wieder traf, fragte er, ob sie mit ihm durch die Dämmerung laufen wolle, ganz kurz und schnell, und gleich wieder umkehren. Es zog ihn zu ihr, und es graute ihm vor dem Zusammensein, er wollte sich sichern gegen irgendeine Lockung, die seine Grenzen überschreiten konnte.
Sie kam dann, langsam trat sie aus der grauen Dunkelheit hinter den Büschen. Das Wort »gelassen« fiel ihm ein … Gelassen stieg die Nacht … War sie die Nacht? Gelassen … sie war so sicher, als täte sie etwas längst Eingeübtes, ganz Vertrautes, als wäre er ihr anheimgegeben, um genommen, gebettet, ganz überflutet und eingebunden zu werden.
Später sah er sie beruhigter, er fühlte ihr »Gelassensein« wie eine gnadenvolle Macht, eine mütterliche Umwallung, viel stärker als er selbst, ein Schoß, ein Todesfluß; und danach kamen die kleinen goldzuckenden Wellen und Quellen, süßes Spiel, Sprudeln und Springen, aber das blieb an der Oberfläche, Schaum und Spiegelung. In der Tiefe, wo Zug und Strömung wirkten, war das Dunkle, die Nacht, das Anheimgegebensein, das unentrinnbare Auflösen und Mitströmen …
Maria Meyer hatte schwarze umrandete Augen unter hochgeschwungenen Brauen, sie sang mit einer tiefen Altstimme, sie bewegte sich langsam wie eine Königin aus dem fremden Land, und sie verschloß sich unversehens, wenn sie sich wild und wirr und verwirrend verloren hatte, als wäre ein tobender Flußwirbel auf einmal in einer Untiefe verlandet.
Anfangs sprachen sie nicht viel; dann verlangte der junge Student von ihr zu wissen, wer sie sei und was sie erlebt habe, woher sie diese hohe Gestalt habe und »die unergründlichen Augen« und solches mehr, wie Verliebte sich durchdringen und durchleuchten wollen und doch nicht ganz klar sehen möchten.
Schließlich erzählte sie einiges Unzusammenhängendes, sie gebrauchte lateinische Wendungen und griechische Worte, Mörike hörte ihr erstaunt zu und fragte wieder; sie habe bei gelehrten Leuten ausgeholfen, sagte sie beiläufig, und endlich auch: sie habe den Studenten Sand gekannt, den Theologen, der ein verworrener Kauz und ein verkrampfter und unfreier Kerl gewesen sei.
»Der gleiche, der ein Mörder wurde? Der den Staatsrat Kotzebue erstach?«
»Gerade der.« Den habe sie gekannt, vorher, eh’ er das getan habe, lang vorher.
»Und was hat man ihm denn angemerkt? War er jähzornig, war er verschlagen oder was?«
Nichts sei er gewesen als ein frommes Lamm, ein stilles, sagte Maria zögernd. Übrigens habe er im Herbst 1814 in Tübingen gewohnt, bei einem Kaufmann Spellenberg. Sie wußte vielerlei: von der »sprudelnden strudelnden« Freiheitsbewegung, wie sie die Gärung unter den Studenten nannte, der Empörung gegen Unterdrücker und Fremde, die noch aus der Zeit des großen Korsen herkam, der »die Völker gefressen hatte«.
Sie hatte vom Lützowschen Corps gehört, von tollkühnen Anschlägen, vom Tod des jungen Schill, des Freicorpsführers, der gegen die Franzosen angetreten war. Maria hatte ein sensibles Gespür, eine »dünne Haut«, die alle Vibrationen zittern ließen, für Regungen, die in der Luft lagen; sie wußte schnell, daß der Junge da neben ihr, der, den Kopf auf den Armen, rücklings im Gras lag, solchem Aufwind geöffnet war: der Abneigung gegen den eingefahrenen Trott, den raffinierten, routinierten Gang des geschickten Verhandlers, Agenten, Enthüllers, der für ihn mit dem häßlichen Namen Kotzebue auch gleich ein unschönes Bild weckte; denn Klänge schwangen für ihn in Farben, Wesen wurden zu Konturen wie ein Ornament, die Überwältigung durchs Gefühl überrannte und bannte ihn, bis er sich, selber beschwörend, durch die Magie, des Wortes aus der Umschlingung zog …
Als er die dunkle Zauberin fragte, wie sie heiße, schien ihm der Name banal; er fragte wieder und wollt’s nicht glauben, er suchte nach einem Wesentlichen und Umfassenden, das sie festhielte und ganz umgriffe, aber sie entglitt ihm; sie war jede Stunde anders, fremd und tief vertraut, da sie ein Element schien, ein Hauch aus dem Baum, unter dem sie lagen, ein anschwellender Fluß und das verblassende Abendrot, Windwehen und Ästewiegen und eine schwere Wolke über dem Berg.
Sie sprachen nicht viel von Politik, obwohl sie von der manches erkannt hatte, selbständiger als er, dem das alles noch neu war, denn er kam aus der gesicherten, gepanzerten, ummauerten Burg des Elternhauses und wollte im Grunde nicht einmal gern da heraus.
Sie nannte ihn einmal eine Schnecke im Gehäus, ein anderes Mal eine Muschel, und ahnte nicht, wie das Bild traf.
Er sagte: »Die Muschelschale meinst du, aber innen ist alles weich, Maria, und wenn ein Sandkorn da hineinbohrt und – drängt, das tut weh.«
Sie fragte lachend – ein tief ansetzendes, gesanghaftes Lachen aus der Kehle –, ob sie so hart sei, so ein Sandkorn, und er sagte erschrocken, wenn sie es wäre, die Muschel könne das umkleiden und einhüllen, was sie verletze, und ganz in sich einnehmen, daß es ein Eigenes werden müsse.
»Einbetten …«, sagte sie und drückte sich an ihn. Mörike strich behutsam und ängstlich über das knisternde Haar, das er in der Dunkelheit Funken sprühen sah, und sagte plötzlich aufgestört:
»Einnehmen, einhüllen – aber da wachsen ja Perlen in der Muschel?«
Maria Meyer verstand nicht gleich und schon gar nicht, daß er bei einem solchen Gedanken erschrak. Sie sagte laut: »Perlen sind doch schön, ich hätte gern so eine Kette …«
Der Herr von Münch habe ihr eine versprochen gehabt, sagte sie dann, aber den habe sie jetzt aus den Augen verloren. Der hätte auch den Hofrat Fries und den Professor Oken gekannt und mit dem geheimen Studentenorden zu tun gehabt, und sie wisse auch davon, daß man dem Professor Fichte einmal die Fenster eingeworfen habe, weshalb der ein paar Monate seine Vorlesungen eingestellt.
Das alles war ein verworrenes Geflüster, untergehend in jäh aufwachenden Zärtlichkeiten, und der junge Mann hatte den Verdacht, daß das Mädchen nur flüchtig und wie huschende Bilder solche Namen und Kenntnisse aufgefaßt habe; aber er nahm sich doch vor – beinah’ mit schlechtem Gewissen –, mehr darüber zu erfahren. Für jetzt, im nächtigen Augenblick, unter den streifenden Zweigen der Fichte, im tiefverhängten Dunkeln, undurchsichtiger noch, da ihm Marias Haar das Gesicht deckte, war er nicht zum Nachdenken gestimmt. Denn solche Verszeilen, wie sie ihm da durch den Kopf gingen, aufzuckende Funken, keine logische Kette – die hießen vielleicht „Purpurschwärze webt … mir vor dem Auge dicht“.
Maria ließ sich das vorsagen, manchmal vorsingen – sie summte mit und wiegte sich darin …
Einmal ging so ein Träumen und Weggenommensein für sie ins Halbbewußte über, und sie lag mit geschlossenen Augen und zuckte wie in Trance. Mörike wurde sie dann unheimlich, befremdlich, er versuchte sie zu wekken, zu necken und mit ein bißchen schwäbischer Derbheit aus dem Pathetisch-Visionären herauszukommen und sie mitzunehmen an ein festes gefestigtes Ufer.
Er spürte wohl, daß sie halb in einem Zwang gefesselt sei und halb das Überschwengliche wollte: Taumel, Maßlosigkeit, Exaltation …
Ihm half da ein lächelnder Geist, ein heiterer Ariel, und – die Angst vor dem gleichen Abgrund.
Sie sagte unvermittelt:
»Keine Angst, der Sand war ein Lamm.«
Sie redeten so fort und spielten schöpferisch mit Worten und lachten.
»Sand …«, sagte er, dabei müsse er wieder an das eckige Sandkorn denken, das, in die Muschel eingegraben, sie verletze und um das sich die Perle bilde. Aber diesen »Sand« solle sie doch jetzt nicht heraufrufen.
Er erzählte dann, als er in ihren Augen ein funkelndes Glimmen aufsteigen sah, ablenkend, von einem Gespräch mit Freunden: Sie hatten sich über die Herkünfte ihrer Namen Gedanken gemacht; Waiblinger hatte von den Ghibellinen, den Waiblingern, geredet, den Hölderlin, von dem sie ehrfürchtig gelesen hatten, sahen sie als den Holden, den Engelhaften, Lohbauer hieß sich einen Bauern am Wald und – Mörike fragte, was denn mit seinem Namen sei.
Das berichtete er ihr.
»Der paßt doch nicht ins Schwäbische«, sagte sie, wandte den Kopf weg und legte die Hand ins Gras, damit er das Zittern nicht spürte, wie es in ihr aufstieg.
Des Vaters Ahnen seien aus Brandenburg, aus dem Havelland gekommen, erzählte er, und die der Mutter vielleicht aus Bayern, da sie eine »Beyer« gewesen sei, eine Pfarrerstochter. Im Schwäbischen sei keine »ke« – Nachsilbe zu Haus, da müßte er schon »gelbs Rüble« geheißen haben, sein Ahnherr. Er freute sich, daß sie lachte, und spann die Sache aus:
»Möhrke, kleine Möhre, kleine gelbe Rübe.«
Immerhin habe er zwei Mohren im Wappen und vielleicht sei er auch ein halber – so eine Mixtur sei gar nicht übel –, in Frankreich gebe es einen jungen Romanschreiber, zwei Jahre älter als er, Alexandre Dumas, der ein halber Mulatte sei. Er sah sie fragend an. Sie lachte wieder, diesmal gepreßt und unterdrückt: »Ich bin ja auch so ein Halbes, weiß nicht, woher und wohin – und von meinem Vater nur den Namen und Dresden – Jakob Fried … ist dir das nicht recht geheuer?«
Er schwieg und nahm ihre Hand in seine, um sie in seine heitere Stille zu führen, die doch von dem ersten Bienengesumm tönte und über das Gras hin mit leis gurgelnden Akkorden das Gespräch des Wassers herantrug. »Vielleicht hieß er auch anders und war vom hohen Adel.«
Es ist Mai, ein kühler schwebender Tag, unruhig zittert die durchschienene Luft, ein ganz behutsamer Wind haucht über das Gras, Bläue ist in allen Farben; nicht im Grün, das ist zart gelblich, noch nicht sonnengefärbt und luftgegerbt, fast noch wie ein bleicher Wurzelkeim aus dem Dunkeln der Erde, aber Blau schwingt in der Luft, am ganz hellen Himmel, zwischen den Zirruswolken, im schnellen, schnellenden Bach, gespiegelt da, wo er stiller hinzieht; zerrissen, gestückelt, rund kreisend, wenn er Steinen und Laubhügelchen ausweicht, zwischen dem roten Astwerk am Ufer, zwischen Schatten, die noch leicht und licht sind.
Unter den Wurzeln, zwischen den vorjährigen bräunlichen Blättern, schimmert das Blau ins Lila im Geniste der Veilchen und weißlich-rosa mit Schatten aus Aquamarin in den glockigen, zackigen zitternden Anemonenblüten. Es riecht nach feuchter Frische, den Veilchengeruch glaubt man zu spüren, als wäre er überall. Summen, melodisches Schwingen zieht sich über die Wiese, am Waldsaum entlang, obwohl kein Vogel singt und noch kaum eine Biene in der Morgenkühle schwirrt; alles ist im Anfang, in der Ahnung …
„Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch! Von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja, du bist’s, dich hab ich vernommen!“
Später, gegen den Sommer zu, saßen sie wieder beisammen. Irgendeine verwünschte Unruhe bohrte in Mörikes Kopf und Herzen und ließ ihn nicht schweigend zusehen, wie das Mädchen neben ihm ihre Haare flocht, daß die glänzenden schwarzblauen Strähnen über den hellen Stoff der Ärmel glitten wie Schlangen.
Sie legte endlich den Kopf in die Arme und weinte, unbewußt und ohne Zusammenhang, und er saß verstört und wehrlos neben ihr und versuchte zu verstehen, was sie meinte, nicht nur die Worte, sondern den Grund ihres Leidens, das jetzt, in der Benommenheit, endlich einen Ausdruck fand.
Er hatte, als triebe ihn ein unfreundlicher Dämon, von Karl Ludwig Sand gesprochen.
Es war etwas Zwiespältiges und schwer Erträgliches, wenn die jungen Leute von dem Unglücklichen redeten: Er hatte gemordet, heimtückisch, wohlvorbereitet, zäh andringend und ohne jedes Mitleid, das »Böse vernichten« wollen, das Schmutzige hinauskehren.
Nur – den Ahnungslosen, Wehrlosen niederstoßen … das war ein Verbrechen.
Mörike wollte mehr hören, wenn er den Namen nannte, da er ja wußte, Maria habe ihn gekannt. Aber daß sie so zusammenbrach, so hilflos und in einer Art Trance hinsank, erschreckte ihn.
Es war dann ein verwirrender Traum, den sie ihm vorsprach oder vorsang, Wortsplitter und Seufzen und Gewimmer, und der Unerfahrene versuchte mit weichen Worten dagegen anzugehen …
Im Sommer 1819 war der Raum dumpfig vor Hitze, es roch nach Medizin, nach Schweiß. Der Gefängnisarzt war eben gegangen, seufzend, denn er hatte in seiner langen seltsamen Praxis noch kaum einen so grotesken Fall zu behandeln gehabt, eine so grausame Heilung zustande bringen sollen: Der junge Mensch, dem er bei aller Staatstreue seine Sympathie nicht ganz entziehen konnte, war ein verhinderter Selbstmörder, er hatte versucht zu sterben, es war mißlungen. Seine Tat, ein geplanter, heimtückischer Mord, war als Heldentat und Vaterlandsbefreiung mit den erhabensten Namen belegt und belobt worden, nicht nur von ihm selber, dem Attentäter. Er hatte sich nicht entzogen, war nicht geflohen und hatte sich willig gefangennehmen lassen, in vollem Bewußtsein seines unabwendbaren Todes durch das Beil. Und er blieb tapfer und gelassen, obwohl er die grausige Art der Hinrichtung durch das Schwert kannte, die ihm weder die Guillotine noch auch den Richtblock gönnte. Die vergitterten Fenster ließen nur ein gelbliches Licht ein, das alles veränderte, auch die Laken im Bett auf dem angeketteten Brett, die zerfurcht und zerwühlt waren, und das gedunsene Gesicht des Kranken, mit dem dicken Brustwickel oder was immer es war, den ihm der Doktor angelegt hatte, und das Wasser in der Schüssel auf dem Stuhl, in dem ein Lappen lag, und die Wand, an der die Fliegen krochen.
»Nicht ganz – nicht ganz so …« murmelte der junge Mann, der da lag. »Nicht, wie ich’s tun sollte – ich lebe ja noch!« Er focht mit den Armen und stach mit der freien Hand, als hielte sie den selber entworfenen Dolch; die andere steckte in der Schlinge, die am Brustverband hing. Er streifte und stieß die Decke vollends weg, daß sie auf die Fliesen rutschte.
»Da ist er – das Teufelsgesicht! Das sind die schwarzen Brauen, nah beieinander, die gelbe Fratze mit der Habichtsnase, das ewige Gelächel, ich habe alles zerfetzt! Und Blut, so viel Blut aus dem Schlafrock, ich hab es schon berechnet, daß er die Hände vor die tückischen kleinen Augen reißt – daß er die Brust freigibt, die ich treffen muß, die Lunge, die Seele, wenn er nur eine hat …«
Draußen ging der Arzt auf und ab. Er verfluchte oft genug seinen Beruf; er sei ein mittelmäßiger Doktor, sagte man von ihm, daß er es nur bis zum Heiler der Verbrecher gebracht habe und zu mehr nicht, denn heilen dürfe er ja nur, was zum Siechtum verdammt sei, zum ungesundesten Hinvegetieren oder – wie dieser da, Sand – zum Tod. Einen hinhalten fürs Henkerbeil – dazu muß ein Arzt schon ganz abgestumpft sein, wenn er nur ein bißchen noch ein Mensch gewesen ist beim Antritt solchen Berufs.
Freilich, der da drinnen ist auch eine gänzlich kranke Seele, sagte er sich, indes er im Schatten saß und wartete, bis der Schließer ihm eine andere Zelle aufmachte, in der ein alter Säufer saß, der seine Frau erwürgt hatte … Der da, Sand, war ein Auswuchs und Austrieb der verdrängten und unterdrückten Kräfte der Zeit, ein ausgewuchertes Geschwür falschen Christentums auch, das sich da Luft machte, Märtyrer und Opfer fehlgeleiteter Vaterlandsliebe – und ein Arzt, so er noch ein wenig Arzt ist, sollte für das Kranke auch da Verständnis und Geduld aufbringen, Gelassenheit und Eingehen und Mitleid …
Er dachte darüber nach, was den jungen Menschen so voll Haß und Todesmut gepumpt haben könnte, er sah das vor sich wie eine gewaltsame Einflößung in eine wehrlose Seele – und lachte gleich wieder über seinen grotesken Vergleich. Kotzebue – schon der Name reizte die Jungen zum Hohn … Der Mann war zwielichtig – wie oft hatte er das gehört. Er war russischer Staatsbürger und hatte Besitzungen in Rußland, er war vom russischen Geschäftsträger beauftragt, über Strebungen, Strömungen, geistige Bewegungen in Deutschland – diesem durch die Napoleonkriege vollends undurchsichtig aufgewühlten, uneinsichtig brodelnden Gebilde – nach Petersburg zu berichten unter dem Gesichtspunkt, aufkeimende Richtungen, literarische und propagandistische, zu beobachten und auf ihre politische Wirkung hin zu untersuchen. Er war sogar vorgesehen als literarischer Kommissär für auswärtige Angelegenheiten, er hatte selbst vorgeschlagen, als Gesandter in Dresden in diesem Sinn zu wirken – »wer die Ereignisse voraussehen will, muß die bestimmenden Ideen kennen!« Unter den »bestimmenden Ideen« sah Kotzebue auch die neu aufgekommene Turnkunst, Jahns vaterländische Schöpfung, die ihm, dem Arzt, recht erfreulich und förderlich zu sein schien.
Man wußte, wie bissig Kotzebue den »Turnvater« und die »heilige Turnkunst« verspottet hatte, man zitierte seine »Geschichte des Deutschen Reiches«: „Nun, in Gottes Namen, so turnt und kitzelt euch in dem Gedanken, daß ihr etwas Großes vollbringt. Man läßt ja so manchen Toren seines Weges schlendern, wenn es einem beliebt, sich bei den Beinen aufzuhängen.“
Man wußte von Morddrohungen gegen den Spötter, dessen Schärfe der Gegenstand nicht rechtfertigte, man verbrannte seine Schriften, man warf ihm die Fenster ein. Ein Zettel lag vor seiner Tür: »… vielleicht wirst du selbst und nicht nur deine elende Schrift verbrannt …«, man nannte ihn einen »wiedergeborenen Teufel«.
Der Doktor wartete immer noch, er sinnierte. Man sollte dem armen Kerl da drinnen eigentlich ein Pulver eingeben, daß er sanft und für immer einschliefe, ehe sie ihn auf dem Stuhl sitzend enthaupteten … warum nur waren die Jungen so absolut?
Da kam der Wärter – eilig, erschrocken, mit einem bösen Grinsen um den Mund: der Trinker drinnen, den er habe waschen und zurechtmachen wollen für seinen, des Arztes, Besuch, habe sich erhängt – aus – nichts mehr zu machen … Der Doktor fand den Gefangenen tot.
Er ordnete an, was nötig war und trat noch einmal bei Sand ein. Der saß auf der Pritsche und las in der Bibel. Er hörte kaum hin, was der andere sprach, begann endlich zu zitieren: „Christus, der ist mein Leben – Sterben ist mein Gewinn.“ Danach, doch getrieben von dem Wunsch, sich zu erklären, da ihm der Arzt fragend und bohrend seine Motive abzuhören suchte, sprach er von den Zitaten, die der Schriftsteller Luden in seinen Monatsrapporten, dem Burschenschaftsblatt, gebracht hatte – er redete fiebrisch aufgeregt, und manchmal sprudelte er fast unverständlich, und der Doktor – noch bedrückt vom Anblick des Selbstmörders – verstand nicht alles: daß Kotzebues Sekretär dies oder jenes in dem französischen Manuskript nicht habe lesen können und den Redakteur des »Volksfreund« deswegen gefragt habe; daß der sich die Notizen ausgebeten und heimlich Auszüge gemacht, daß der Sohn des Dichters Wieland daraus in seinem Blatt einiges Verfängliche abgedruckt habe … und Polemiken angehängt.
Der Herr von Kotzebue zerrieb sich an so viel Intrigen, so sagte man, und wirklich bat er den russischen Gesandten um Versetzung nach Reval, auch wenn er dort weniger als in Weimar verdiene; er wich aus, er hatte berechtigte Angst, er zog nach Mannheim. Alexander von Rußland genehmigte das Gesuch – aber das hatte eine gute Zeit gedauert, und inzwischen schrieb der Student der Theologie Karl Ludwig Sand in sein Tagebuch: „Das Vaterland schafft Freude und Tugend – unser Gottmensch, Christus, unser Herr, er ist das Bild der Menschlichkeit, die ewig schön und freudig sein muß …“ Und gleich daneben schrieb er: „Wenn ich sinne, so denke ich oft, es sollte doch einer sich den Mut nehmen, dem Kotzebue oder sonst einem solchen Landesverräter das Schwert ins Gekröse zu stoßen …“
Die drei oder vier Jahre, seit Sand tot sei, sagte man, habe sich sein Bild eher verklärt und vergrößert, und es gebe manche Studenten, auch solche, die inzwischen in Amt und Würden oder gar Pfarrherren seien, die noch ein blutgetränktes Taschentuch in einer Schatulle hätten, am Richtstuhl des Sand getränkt …
Das Bild wurde Mörike quälend deutlich: Nach der Tat, als der Sand wie ein Wahnsinniger aus der Wohnung gerast war, hinter sich den Verblutenden mit den schreienden Frauen und Kindern, als er, Sand, sich den zweiten Dolch, den er entworfen und bestellt, in seine eigene Lunge gestoßen hatte – er spürte es kaum, wie er nachher berichtete –, als er draußen vor dem Haus hinfiel, in die Knie brach, vornübergebeugt und blutend sagte: »Gott sei gedankt – ich hab’s vollbracht!« – hatten ihn die Leute aufgehoben und weggetragen. Das wußte Maria von denen, die ihn fanden.
Aber danach lag er wochenlang mit Schmerzen, fiebernd – und da hatte sie ihn besucht: Sie fand ihn halbschlafend und stöhnend, setzte sich aufs Bett, wußte selber kaum mehr, was sie tat, deckte ihn zu und drückte ihren Kopf an ihn – und so, wie in einer Totenhochzeit, blieb sie lang bei ihm, bis die Hausfrau hereinschlich und sie fortschickte.
Mörike wehrte sich dagegen, alles zu glauben, er kannte indessen ihre sonderbaren »Zwischenreiche«, ihre phantastischen Visionen. Aber auch wenn sie sich die Szene bloß ausgedacht hatte, war’s ihm peinlich, es war ihm schrecklich und erschreckend. Er versuchte, sie zu wecken, zurückzuholen in ein beruhigendes friedliches Geviert, in eine ummauerte sichere Heimstatt; er fing an zu erzählen und sprach ihr wie einem Kind zu.
Endlich ließ er sie los und stand auf; er sah, daß sie sich drehte, und merkte endlich, daß sie langsam zu sich kam. Erleichtert nahm er ihre Hand und fragte: »Ist’s vorbei? Das war doch nicht wirklich so?«
Und sie antwortete mit ganz anderer Stimme und lachte dabei:
»Ich hab’ geträumt, Eduard; hab’ ich denn geredet?« Sie war dann ruhig, sogar nüchtern, als sie von fern und im Abstand von den Feiern und dem Wartburgschwur der Burschenschaft sprach, von dem sie in früher Zeit durch Sand gehört habe.
Er nickte bloß, erleichtert, daß sich das Gespräch so ins Vernünftige gewendet, auch wenn er vieles von dem schon gewußt hatte, was sie erzählte.
»Zieht nicht ein Name das Urteil nach sich? Er bannt, umgrenzt, behütet aber auch, ein edler Name schützt, schreckt Böses ab; ein häßlicher macht schaudern, er ekelt einen an; aber das Namenlose ist das Nebulose, unheimlich.«
Maria Meyer brauchte einen Namen – sie war so gegenwärtig und so fern, sie war der Grund – wie eine Tonart im Lied – und lebte in allen Klängen, Farben, Bewegungen und Linien, im Birkengespinst, in den Zirruswolken, im quellenden Gras, zwischen den gegeneinanderwehenden Anemonen, und wo es dunkler wurde, erdig, modernd, verworren, zwischen den Steinplatten am Wald, wo irgendetwas mühselig vielfüßig scharrte und grub, ein Käfer, vielleicht etwas größeres, Maus und Maulwurf, Tiere aus dem unteren Bereich – da war sie auch …
Sie wanderte hier und dort, verschwand und erschien, scheinend, schillernd, und unter ihren Berührungen wurde vieles still und vieles lahm, gelähmt, starr … Mörike versuchte, sie in ein Bild zu fassen, das hatte ihm immer geholfen, das Festlegen, Bannen, Benennen, Umreißen, Einzäumen – das Wesen der Sprache war ja ein Heilbann, der das Unerklärliche ins Licht zwang und zum Stillstehen brachte.
Aber sie zog vorbei, weithin … Einmal sagte er sich vor: Ich habe den Namen gefunden: Peregrina: Die Wandernde, Pilgernde, Schweifende – Peregrina.
Als er ihr das Wort sagte, schwieg sie zuerst, faltete die Hände ineinander, Flechtwerk der schmalen Finger, und summte dann vor sich hin.
»Also heiß’ ich so?«
Sie fragte nach der Bedeutung des Wortes, das sie zuerst nur als Klang und Schwingung aufgenommen hatte, und er erklärte es ihr.
Später, in ihrer Kammer im Wirtshaus unter dem Dach, wo es jetzt heiß war und das Gescharre der Mäuse in den Balken ihr den Schlaf störte, dachte sie darüber nach: Wandernde, Ziehende, und immer unruhig. Warum strolch’ ich so umeinander, dachte sie – und Schaffhausen fiel ihr ein, das immer gegenwärtige, wo man vielleicht doch hätte zur Ruhe kommen können, aber sie merkte gleich, daß sie das nicht einmal wollte: Dahin kann man nicht mehr zurück, wo man verjagt und verspottet worden ist – und wollte es doch.
Sie kamen dann wieder auf ihren Namen zu sprechen, auf den zweiten, dichterischen, auf den »Übernamen«, wie sie es nannte, auf »Peregrina«.
Sie wußte durch die gescheiten Leute, mit denen sie zu tun gehabt, irgendetwas vom Wortstamm und »Abstamm« des Wortes und deutete es in ihrem Sinn: »Peregrina sagst du, und pereat meinst du – als wolltest du mich verderben …«
Entsetzt unterbrach er sie, und hastig versprach sie, nie mehr solche Dinge auch nur zu denken; er sei, sagte er, so rein ehrlich und so offen und so auf’s ewig Bleiben gestellt, wie er nur könnte. Ein reiner Kristall, ein blanker Spiegel sei in ihm, und er halte ihn unbefleckt … das müsse sie wissen und glauben, auch wenn das Mißtrauen von früher, aus einer nicht mehr bewußten alten Zeit, immer wieder in ihr aufsteige.
Die Dunkle, die Wissende, die Geheime, die immer irgendwo war und immer wieder irgendwohin schwand, sie mußte gehalten, gebannt, gebunden werden in einem unerhörten, umgreifenden Bann; und jede Zärtlichkeit, jede Umarmung, mußte sie wandeln und ihm anverwandeln, daß sie nicht mehr zauberisch entschwinden, elfenhaft entschweben konnte.
Er horchte mit dem feinsten Gehör und tastete mit feinhäutigem Gespür nach Anzeichen, und was ihm leise aus dem Freundeskreis und danach, auf sein Drängen, von ihr selber angedeutet wurde, das griff er auf, zuckend verletzt und doch bemüht, es einzuhüllen, ungeprüft wegzuschieben, um nur tiefer in den Traum zu tauchen.
Maria, die Peregrina, quälte ihn, ohne es zu wollen, und doch im Unbewußten ganz zielstrebig: Was in ihr zerstört und verbogen war, weil man das Bild ihrer Mutter verfärbt und verkrüppelt hatte, und was tägliche Demütigungen gebrochen, das hatte ihr Wesen für immer geprägt.
Vielleicht war ihre Anlage nur geschmeidig und einfühlsam, und wenn sie geborgen und vertrauend aufgewachsen wäre, hätte das zu schönem Mitempfinden werden können.
Die verzweifelte Leidenschaft, die wilde Liebe zu Lohbauer und die Erscheinung des armen, krankhaft starren Sand hatten sich als Schreckbilder in ihre Erinnerung eingegraben, der schillernd-eitle Münch, »bildungseitel« und an ihr ungeschickt bildend, der wilde genialische Waiblinger – und was sie von ihnen aufgriff als bereite Zuhörerin, hatte sie willig an- und eingenommen, und jedesmal dann doch erfahren, daß sie keinem ganz trauen konnte.
Nur dieser klare zarte Knabe, der Dichter, rein und im Innersten fromm – der würde halten und helfen, hätte sie nur noch Kraft genug, ihm zu vertrauen; er sah sie so, wie sie hätte sein wollen, und seit sie ihn kannte, hatte sie das Maß verstanden. Wenn er da war, trug er sie mit, was er ihr vorsprach, empfand sie als eigen, und wo er sich selbst abschirmte gegen kaum Gespürtes, das von ihr ausging, schützte er auch sie vor sich selber: „Einem Kristall gleicht meine Seele nun, den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen …“
Aber wie man ein Kind schont, so durfte sie ihm nicht alles erzählen; es hätte ihn zu schwer getroffen, er hätte auch nichts verstanden.