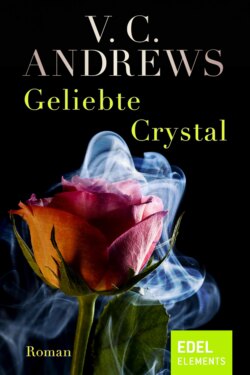Читать книгу Geliebte Crystal - V.C. Andrews - Страница 6
ОглавлениеProlog
Eines Abends vergaß Mr. Philips seine Schlüssel. Obwohl ich erst elf Jahre alt war, hatte ich wie üblich im Verwaltungsbüro geholfen und Bestellungen, Quittungen und Reparaturaufträge abgeheftet. Ich hatte Molly Stuarts Uhr in Mr. Philips’ Toilette liegen lassen, als ich sie abgemacht hatte, um mir die Hände zu waschen. Eine eigene Uhr besaß ich nicht, und sie lieh mir ihre hin und wieder. Als ihr auffiel, dass ich die Uhr nicht mehr am Handgelenk trug, fragte sie mich danach, und ich erinnerte mich daran. Das war nach dem Abendessen, als wir alle in unseren Zimmern waren und die Hausaufgaben erledigten. Ich sagte ihr, sie sollte sich keine Sorgen machen, ich wüsste, wo sie sei. Sie kochte vor Wut, bis sie im Gesicht puterrot angelaufen war. Sie war sich ganz sicher, dass die Uhr mittlerweile gestohlen worden war, weil die Tür zu Mr. Philips Büro nie abgeschlossen wurde. Daher verließ ich mein Zimmer und lief nach unten. Im Büro machte ich Licht und sah in der Toilette nach. Sie lag auf dem Waschbecken, wo ich sie vergessen hatte.
Ich wollte schon wieder gehen, als ich Mr. Philips Schlüsselbund auf dem Schreibtisch liegen sah. Ich wusste, dass das die Schlüssel zu den Geheimakten waren, den Akten mit Informationen über jeden einzelnen von uns. Ständig fragten andere Kinder mich, ob ich diese Akten bei meiner Arbeit im Büro je gesehen hätte. Das hatte ich nicht.
Mein Herzschlag setzte aus. Ich blickte zur Tür und dann zurück auf jene magischen Schlüssel. Für eine Waise war es nahezu unmöglich, vor dem achtzehnten Geburtstag etwas über die leiblichen Eltern zu erfahren. Alles, was man mir je gesagt hatte, war, dass meine Mutter zu krank gewesen sei, um mich zu behalten, und dass ich keinen Vater hätte.
Mein ganzes Leben lang hatte ich noch nichts Unehrliches getan, aber dies war meiner Meinung nach etwas anderes. Es war ja kein Diebstahl. Ich verschaffte mir nur etwas, das mir wirklich gehörte: Informationen über meine eigene Vergangenheit. Leise schloss ich die Eingangstür, nahm die Schlüssel vom Schreibtisch und suchte denjenigen heraus, mit dem ich den Schrank mit den Geheimakten öffnen konnte.
Seltsam, ich stand davor und hatte Angst, die Akte zu berühren, auf der mein Name stand. Hatte ich Angst, eine Regel zu brechen, oder fürchtete ich mich davor, etwas über mich selbst zu erfahren? Endlich brachte ich genug Mut auf, um die Akte herauszuziehen. Sie war dicker, als ich erwartet hatte. Ich machte das Licht aus, damit niemand auf mich aufmerksam würde, und setzte mich neben der Toilettentür auf den Boden. Ein schmaler Lichtstrahl fiel durch den Türspalt, gerade genug, um die Seiten lesen zu können. Die ersten enthielten Informationen, die mir bereits bekannt waren: meine Krankengeschichte, meine Zeugnisse. Aber unten befand sich ein Stapel Papiere, die die dunklen Türen zu meiner Vergangenheit aufstießen und Informationen enthüllten, die mich sowohl überraschten als auch ängstigten.
Nach dieser Akte hatte man bei meiner Mutter, Amanda Perry, bereits mit fünfzehn oder sechzehn eine manische Depression diagnostiziert. Mit siebzehn wurde sie nach wiederholten Selbstmordversuchen in eine Anstalt eingewiesen. Einmal hatte sie versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden, zweimal nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten.
Ich las weiter und erfuhr, dass meine Mutter in der psychiatrischen Anstalt von einem Krankenpfleger geschwängert worden war. Offensichtlich fand man nie heraus, um welchen Pfleger es sich handelte. Also war irgend so ein Schwein da draußen mein Vater – so es mir nicht gelang mir einzureden, dass meine Mutter und dieser Pfleger zwischen Medikamententherapien und Elektroschocks eine wundervolle, romantische Liebesaffäre erlebt hatten.
Als feststand, dass meine Mutter schwanger war, traf jemand die Entscheidung, keine Abtreibung vorzunehmen. Nach meiner Geburt wollten meine Großeltern mütterlicherseits nichts mit mir zu tun haben. Und da auch mein Erzeuger sich nicht zu erkennen gab, bekam ich sofort einen Amtsvormund. Aus meinen Papieren ging nicht hervor, wer mir den Namen Crystal gegeben hatte. Ich liebte die Vorstellung, dass dies das einzige Geschenk war, das meine bedauernswerte Mutter mir je gemacht hatte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer ich war, bis es mir gelang, heimlich diese Akten einzusehen.
Mein Blick fiel auf eine einfache Notiz über den Tod meiner Mutter im Alter von zweiundzwanzig Jahren. Ihr letzter Selbstmordversuch war erfolgreich gewesen. Ich würde sie nie kennen lernen, auch später nicht, wenn ich längst erwachsen war.
Ich erinnere mich daran, dass mir durch diese Enthüllungen die Hände zitterten und ich ein flaues Gefühl im Magen hatte. Würde ich die psychischen Probleme meiner Mutter erben? Würde ich die Niederträchtigkeit meines Vaters erben? Nachdem ich die Akte zurückgestellt, den Schrank abgeschlossen, die Schlüssel zurückgelegt und das Büro verlassen hatte, lief ich direkt ins Badezimmer, weil ich das Gefühl hatte, mich übergeben zu müssen.
Es gelang mir, mein Abendessen bei mir zu behalten, aber ich wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, um mich zu beruhigen. Als ich dann in den Spiegel sah, prüfte ich meine Gesichtszüge eingehend und suchte nach Anzeichen für Böses. Ich fühlte mich wie Dr. Jekyll auf der Spur von Mr. Hyde. Seit diesem Tag hatte ich Albträume. Darin erlebte ich, wie ich geisteskrank wurde und so schwer erkrankte, dass ich in eine Klinik eingewiesen und bis ans Ende meiner Tage unter Verschluss gehalten wurde.
Ich glaube, jeder Psychologe, der meine Herkunft kannte, hätte sich gefragt, ob ich irgendwelche Charakterzüge meiner Eltern geerbt hatte. Den Akten entnahm ich, dass meine Mutter ihre Probleme oft in der Schule auslebte und daher für alle Lehrer eine sehr schwierige Schülerin war. Ständig war sie in Schwierigkeiten. So war ich nie. Erst kürzlich habe ich gelesen, dass solch ein Verhalten ebenso wie ein Selbstmordversuch ein Hilfeschrei ist.
Die Welt erschien angesichts all dieser Hilferufe wie ein riesiger Ozean, in dem viele ertranken und aus dem die Lebensretter willkürlich den einen oder anderen herausfischten. Natürlich werden immer die Reichen gerettet oder zumindest wirft man ihnen eine Rettungsleine zu. Leute wie ich werden in Irrenanstalten, Pflegeheime, Waisenhäuser und Gefängnisse abgeschoben. Mit vielen anderen werden wir unter einen Teppich gekehrt. Ich fragte mich nur, wie andere darüber gehen konnten.
Natürlich erzählte ich niemandem, was ich erfahren hatte, aber ich begriff, warum nur so wenige potenzielle Eltern Interesse an mir zeigten. Wahrscheinlich wurden sie über meine Herkunft informiert und entschieden sich, solch ein Risiko nicht einzugehen.
Einmal, als ich noch in einem anderen Waisenhaus lebte, saß ich draußen und las Das Tagebuch der Anne Frank. (In meiner Lektüre war ich den Kindern meines Alters immer weit voraus.) Plötzlich spürte ich über mir einen Schatten und blickte auf. Ich sah einen Luftballon, der durch die Luft trieb, das Band baumelte wie ein Schwanz hinterher. Ein kleines Kind hatte wohl seinen Griff gelockert, und er war davongeflogen. Jetzt trieb er ziellos dahin, an niemanden gebunden, dazu verdammt, nie mehr zu seinem Besitzer zurückzukehren. Als er über einer Reihe von Baumkronen verschwand, dachte ich, so ergeht es uns allen. Wir sind Ballons, die jemand absichtlich oder unabsichtlich losgelassen hat, arme verlorene Seelen, die im Wind dahintreiben und auf eine Hand warten, die sie ergreift und zur Erde zurückbringt.
Drei weitere Jahre gingen ins Land, ohne dass ich adoptiert oder auch nur zu Pflegeeltern gegeben worden wäre. Immer noch half ich Mr. Philips in seinem Büro, und vor einem Jahr begann er, mich das kleine Fräulein Tüchtig zu nennen. Mir machte das nichts aus, selbst wenn er damit seine Mitarbeiter ärgerte. Ständig sagte er Sachen wie: »Warum können Sie nicht so verantwortungsbewusst oder so sorgfältig wie Crystal sein?« Selbst zu seiner Sekretärin Mrs. Mills sagte er so etwas hin und wieder.
Mrs. Mills sah immer aus, als ertränke sie in Durchschlägen. Ihre Finger waren blau oder schwarz von Farbbändern, Tintenkartuschen und Toner, die sie zu wechseln hatte. Morgens kam sie stets in makellosem Zustand zur Arbeit, jede Strähne ihres blaugrauen Haares lag an ihrem Platz, ihr Make-up war perfekt, die Kleidung sauber und faltenfrei, aber gegen Ende des Arbeitstages hing ihr der Pony über die Augen, ihre Bluse hatte gewöhnlich einen oder zwei Flecken, der Lippenstift war auf der Wange verschmiert. Ich weiß, dass sie nie Vorbehalte gegen mich hatte. Stets begrüßte sie mich freudig und wusste meine Arbeit zu schätzen – Arbeit, die sonst sie hätte erledigen müssen.
Für mein Alter wusste ich eine Menge über Psychologie. Ich begann mich dafür zu interessieren, nachdem ich von meiner Mutter gelesen hatte. Vielleicht werde ich eines Tages Ärztin, außerdem ist es sowieso gut, so viel wie möglich über Psychologie zu wissen. Besonders in Waisenhäusern ist das sehr nützlich.
Aber es ist nicht immer von Vorteil, klüger zu sein als andere Leute oder verantwortungsbewusster. Das gilt besonders für Waisenkinder. Je hilfloser man erscheint, desto größer sind die Chancen, adoptiert zu werden. Wenn du so aussiehst, als könntest du auf dich selbst aufpassen, wer will dich dann schon? Zumindest ist das eine meiner Erklärungen, warum ich so lange eine Gefangene dieses Systems war. Mögliche Adoptiveltern fühlen sich nicht gerne ihrem Adoptivkind unterlegen. Das habe ich selbst erlebt.
Da war zum Beispiel dieses Paar, das sich ausdrücklich nach mir erkundigt hatte. Sie wollten gerne ein älteres Kind haben. Die Frau, die übrigens Chastity hieß, lächelte dümmlich. Ihr Mann nannte sie Chas, und sie nannte ihn Arn als Kurzform von Arnold. Mich hätten sie wahrscheinlich Crys genannt. Offensichtlich fiel es ihnen schwer, ganze Worte auszusprechen. Bei Sätzen war es dasselbe Problem. Stets blieb das Satzende unausgesprochen, beispielsweise als Chas mich fragte: »Was willst du einmal werden, wenn du –«
»Wenn ich was?«, zwang ich sie zu sagen.
»Älter wirst. Deinen Abschluss machst –«
»Am College oder an der High School oder beim Militär oder an der höheren Handelsschule?«, zählte ich auf. Ich hatte eine spontane Abneigung gegen sie gefasst. Sie kicherte ständig, und er sah von Anfang an so aus, als wäre er lieber anderswo.
»Ja«, kicherte sie.
»Ich glaube, ich würde gerne Ärztin, aber vielleicht werde ich auch Schriftstellerin. Ich bin mir noch nicht völlig sicher. Was möchten Sie denn gerne werden?«, fragte ich sie, und sie klimperte völlig verwirrt mit den Wimpern.
»Was?«
»Wenn Sie –« Ich schaute Arn an, und er grinste.
Ihr Lächeln welkte wie eine Blume und löste sich schließlich völlig in Luft auf. Ihr Blick wurde bedrohlich und strahlte bald eine nervöse Energie aus. Ich konnte gar nicht zählen, wie oft sie voller Sehnsucht zur Tür schaute.
Als das Gespräch endlich beendet war, wirkten sie sehr erleichtert. Bis vor einer Woche fanden dann keine weiteren Gespräche mit mir statt. Aber ich freute mich wirklich, Thelma und Karl Morris kennen zu lernen. Offensichtlich ließen sie sich von meiner Herkunft nicht abschrecken, und sie ärgerten sich auch nicht über mein altkluges Benehmen. Hinterher erzählte mir Mr. Philips, dass ich genau ihren Vorstellungen entspräche: eine Jugendliche, die keine Probleme machen würde, die sie nicht zu sehr beanspruchen würde, die schon eine gewisse Unabhängigkeit besaß und gesund war.
Thelma schien davon überzeugt zu sein, dass jeglicher Schaden, den ich im Waisenhaus erlitten haben könnte, nach ein paar Wochen bei ihr und Karl wieder behoben sein würde. Ich liebte ihren blauäugigen Optimismus. Sie war eine kleine Frau Ende Zwanzig mit sehr krausem hellbraunem Haar und haselnussbraunen Augen, die so hell und unschuldig strahlten wie die einer Sechsjährigen.
Karl war nicht viel größer als sie, hatte schütteres dunkelbraunes Haar und matte braune Augen. Er wirkte viel älter, war aber erst Anfang dreißig. Sein sanftes, freundliches Lächeln wirkte auf seinem dicklichen Gesicht wie Beeren in geschlagener Sahne. Er war untersetzt und hatte kleine Hände mit Wurstfingern.
Er war Buchhalter, sie Hausfrau. Aber sie hatten vor langer Zeit beschlossen, dass dies auch ein Job sei, für den sie ein Gehalt bezog. In guten Jahren erhielt sie sogar eine Gehaltserhöhung. Sie hörten gar nicht auf, über sich selbst zu reden. Als wollten sie beim ersten Treffen ihr gesamtes Leben vor mir ausbreiten.
Am besten gefiel mir, dass sie absolut nichts Gekünsteltes, Verschlagenes, Bedrohliches an sich hatten. Was man sah, war echt. Das gefiel mir. Dabei fühlte ich mich wohl. Während des Gespräches hatte es manchmal mehr den Anschein, als sollte ich entscheiden, ob ich sie adoptieren sollte.
»Hier ist alles viel zu ernst«, meinte Thelma am Ende des Gespräches. Sie verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse und schürzte die Lippen missbilligend. »An so einem ernsten Ort kann sich doch ein junger Mensch nicht zu Hause fühlen. Ich höre hier niemanden lachen. Ich sehe keine lächelnden Gesichter.«
Dann wurde sie selbst plötzlich sehr ernst und beugte sich flüsternd zu mir herüber. »Du hast doch noch keinen Freund, oder? Ich fände es schrecklich, eine aufkeimende Romanze zu zerstören.«
»Wohl kaum«, entgegnete ich. »Die meisten Jungen hier sind schrecklich unreif.« Das gefiel ihr, offensichtlich war sie erleichtert.
»Gut«, meinte sie. »Dann ist es also abgemacht. Du kommst mit uns nach Hause, und wir reden nie wieder über etwas Unerfreuliches. Ich halte nichts von Traurigkeit. Wenn man an die schlechten Dinge im Leben überhaupt nicht denkt, verschwinden sie einfach. Du wirst schon sehen.«
Ich hätte wissen müssen, was das bedeutet. Aber ausnahmsweise wollte ich einmal nicht jeden analysieren und einfach die Gesellschaft eines anderen Menschen genießen, insbesondere, wenn dieser jemand meine Mutter werden wollte.