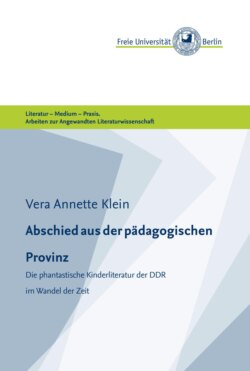Читать книгу Abschied aus der pädagogischen Provinz - Vera Annette Klein - Страница 10
2 Gattungsdefinition „Phantastik“: Gansels Grundmodelle phantastischer Kinder- und Jugendliteratur
ОглавлениеMeine Arbeit orientiert sich an den Thesen zur Phantastik, die der ostdeutsche Literaturwissenschaftler Carsten Gansel ab 1986 speziell für den Bereich der Kinder- und Jugendliteratur entwickelte; sie stellen nicht nur „die erste theoretische Gattungsbestimmung phantastischer [Kinder- und Jugendliteratur] in der DDR“6 dar, sondern auch einen der strukturiertesten und überzeugendsten Ansätze innerhalb der ausufernden Phantastik-Diskussion in der kinderliterarischen Forschung.7
Gansels Thesen basieren auf dem sogenannten „Zwei-Welten-Modell“8, also der bereits in der Einleitung angesprochenen Annahme, dass in phantastischen Texten stets zwei Handlungskreise existieren: Eine realistisch gezeichnete, vom Leser als empirisch-alltäglich bestimmbare Welt, im Folgenden „real-fiktive Primärwelt“ genannt, und eine Welt des für den Leser Irrational-Unerklärbaren, in der das Außergewöhnliche geschieht, die „phantastische Sekundärwelt“. In der phantastischen Literatur für Erwachsene entstehen aus dem Zusammenstoß der beiden Welten zumeist „Schrecken, Angst, Grauen [und] Schauder“; in der phantastischen Kinderliteratur dagegen wird die Konfrontation zweier Wirklichkeiten in erster Linie für „Komik, Spiel und satirische Pointierung“ genutzt.9
Gemäß Carsten Gansel können real-fiktive Primärwelt und phantastische Sekundärwelt auf drei verschiedene Arten zueinander in Beziehung treten. Die erste mögliche Variante, die von Gansel recht prosaisch „Grundmodell A“ genannt wird (die russische Anglistin Maria Nikolajeva schlägt die sprechendere Bezeichnung „implizite Welt“10 vor), stellt „die wohl bekannteste Variante des Phantastischen“11 dar. In nach diesem Muster gestalteten Kinderbüchern spielt die gesamte Handlung in der real-fiktiven Primärwelt; die phantastische Sekundärwelt wird nicht als solche beschrieben, beweist jedoch ihre Existenz durch das Auftreten von Figuren, Gegenständen oder Ereignissen, die es nach den Gesetzmäßigkeiten der Primärwelt eigentlich gar nicht geben dürfte. Berühmte Beispiele für derartige „Boten“ der Sekundärwelt sind etwa Pamela Travers‘ Mary Poppins, das eitle Kindermädchen, das mit seinen phantastischen Fähigkeiten den allzu eintönigen Alltag der Familie Banks durcheinanderwirbelt, oder der sprechende Stein, der in Benno Pludras Das Herz des Piraten zum ständigen Begleiter des Mädchens Jessica wird (vgl. Punkt 4.1.2). Auch der Besuch des Engels Ambrosius in der DDR-Gesellschaft der achtziger Jahre, den Christa Kožik in Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart beschreibt (vgl. Punkt 4.2 dieser Arbeit), ist ein Beispiel für das „Grundmodell A“.
Im zweiten der von Gansel beschriebenen Modelle (das von Gansel „Grundmodell B“ und von Nikolajeva „offene Welt“ genannt wird) spielt die Handlung sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärwelt, die hier – im Gegensatz zum ersten Grundmodell – ausführlich geschildert wird. Dabei gelangen die kindlichen Hauptfiguren durch bestimmte Schleusen aus der „realen“ Welt in die phantastische und – falls sie sich nicht, wie etwa der Titelheld von Astrid Lindgrens Mio, mein Mio, zum Bleiben entschließen – am Ende auch wieder zurück: So stürzt Lewis Carolls Alice durch ein Mauseloch direkt ins Wunderland, und Michael Endes Bastian findet sich in Die unendliche Geschichte nach der Lektüre eines Zauberbuchs unversehens im Wunderreich Phantásien wieder. Auch Wera Küchenmeisters Erzählung Die Stadt aus Spaß, in der die vorlaute Protagonistin Jette aus der DDR in eine phantastische Anderswelt versetzt wird (vgl. Punkt 3.3 meiner Arbeit), ist zu diesem zweiten Grundmodell zu zählen.
Im dritten möglichen Grundmodell („Grundmodell C“ nach Carsten Gansel, „geschlossene Welt“ nach Maria Nikolajeva) schließlich spielt die gesamte Handlung in einer phantastischen Sekundärwelt. Die Primärwelt kommt nicht ausdrücklich im Text vor, ist aber laut Bernhard Rank insofern präsent, als „angedeutet wird, dass Erzähler und Zuhörer/ Leser in ihr leben“; dem Leser werde „das Bewusstsein vermittelt, dass er aus seiner primären Welt, die außerhalb des Textes existiert, auf die sekundäre blickt“.12 Laut Rank kommt dieses Grundmodell nur in sehr wenigen Kinderbüchern vor; Gansel nennt als Beispiele J.R.R. Tolkiens Der kleine Hobbit und die Scheibenwelt-Romane von Terry Pratchett.13
Abschließend sei auf den entscheidenden Unterschied hingewiesen, der zwischen Phantastischem als literarischem Darstellungsmittel und Phantastik als literarischem Genre besteht. Nicht jedes Kinderbuch, in dem Hinweise auf die Existenz einer „phantastischen“ Sekundärwelt zu finden sind, ist auch automatisch zum Genre der Phantastik zu zählen; tatsächlich sollte, wie Gansel ausführt, von Phantastik erst dann gesprochen werden, wenn „das Phantastische zur ‚systemprägenden Dominante‘ […] wird, d. h. die phantastischen Elemente komplex angewendet werden und das Zusammenspiel der Darstellungselemente entscheidend bestimmen.“14 So tritt in Christa Kožiks Kinderbuch Moritz in der Litfaßsäule (vgl. Punkt 4.1.1 dieser Arbeit) zwar eine sprechende Katze als Nebenfigur auf, insgesamt aber überwiegen innerhalb der Erzählung die realistischen Elemente bei weitem, weshalb eine Zuordnung zum Genre der Phantastik nicht gerechtfertigt wäre. Ein Gegenbeispiel hierzu sind Paul Maars Sams-Romane, deren Geschichten ohne die phantastischen Fähigkeiten ihres Titelhelden völlig undenkbar wären.