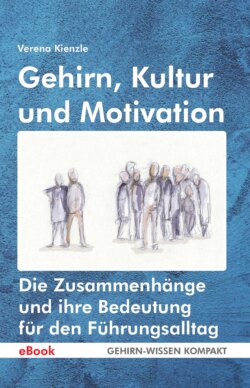Читать книгу Gehirn, Kultur und Motivation - Verena Kienzle - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.1 Das limbische System
Im limbischen System entstehen Affekte und Emotionen, Motive und Ziele, Einfühlungsvermögen, Moral und Ethik. (vgl. Roth/Strüber 2015: 64). Es besteht aus mehreren evolutionär gesehen alten Hirnbereichen, die in ringförmiger Anordnung um Basalganglien und Thalamus liegen und umfasst u.a. Hippocampus, Cingulum, Nucleus Accumbens, Amygdala, Hypothalamus, Ventrales Tegmentales Areal und zentrales Höhlengrau (vgl. Jäncke 2013: 50).
Das limbische System lässt sich in drei Ebenen unterteilen. Die unterste Funktionsebene, zu der Hypothalamus, Zentralkern der Amygdala, Ventrales Tegmentales Areal und zentrales Höhlengrau gehören, steuert die vegetativen Zentren unseres Hirnstamms und damit unsere vegetativen Körperfunktionen wie Hunger, Durst, Schlafbedürfnis und Schmerz. Diese Funktionen dienen unserem Überleben, müssen nicht erlernt werden und sind von uns willentlich kaum zu kontrollieren. Darüber hinaus steuert die unterste limbische Ebene unser elementares affektives Verhalten, z.B. Sexualität, Aggressivität, Verteidigungs- und Fluchtverhalten, Lust und Stressverhalten. Diese Hirnzentren sind schon früh im Gehirn vorhanden, Amygdala und Hypothalamus beispielsweise entwickeln sich bereits um die fünfte und sechste Schwangerschaftswoche. (vgl. Roth/Strüber 2015: 63ff; Roth 2016: 83).
Abb. 5: Das limbische System
Auch die mittlere limbische Ebene ist Teil unseres unbewussten Selbst. Auf ihr vollziehen sich emotionale Prägung und Konditionierung, entstehen Belohnungsmechanismen, Bewertung und Motivation, sie bildet die Ebene unserer Gefühle. Zu ihr gehört die basolaterale Amygdala, in der sich unsere emotionale Konditionierung vollzieht, sie ist wichtig für die Regulation von Emotionen, steuert Furcht-, Vermeidungs- und Stressverhalten und unser Angstempfinden. Ebenso das mesolimbische System, eine Struktur, zu der Nucleus accumbens, orbitofrontaler Kortex und ventromedialer Präfrontalkortex zählen. Besonders der Nucleus accumbens wird als wichtiges Gebiet für die Vermittlung von Belohnung verstanden, oft auch als Belohnungszentrum bezeichnet. Auch er entwickelt sich bereits früh in der sechsten und siebten Schwangerschaftswoche. (vgl. Jäncke 2013: 51; Roth 2016: 83f).
Die Basalganglien, sie umgeben den Thalamus und sind evolutionär alte Hirnstrukturen, zählen ebenfalls zum mesolimbischen System. Sie sind eingebunden in die Steuerung von Willkürbewegungen, aber auch in kognitive Kontrollprozesse wie Handlungs- und Verhaltensplanung bzw. -bewertung (vgl. Esch 2012: 88; Jäncke 2013: 49).
In ihnen bilden sich unsere Gewohnheiten. Die mittlere limbische Ebene ist der Ort emotionaler Konditionierung, hier werden Eindrücke, die wir als gut oder schlecht wahrnehmen, verbunden mit Objekten, Personen, Orten und Situationen. Unser zukünftiges Verhalten wird dadurch in der Form beeinflusst, dass wir angenehme Dinge zu wiederholen versuchen und die Wiederholung unangenehmer Dinge vermeiden. Es mag sein, dass wir das bewusst tun und Zu- oder Abneigung, Freude oder Furcht als solche empfinden und die Gründe dafür benennen können, oft fühlen wir uns aber zu etwas hingezogen oder von etwas abgestoßen und wissen nicht genau, weshalb.
Wenngleich die limbischen Zentren schon früh in der Schwangerschaft vorhanden sind, erfolgen Entwicklung und Ausreifung erst in den ersten Lebensjahren. Die dort erfahrenen Konditionierungen sind im späteren Leben nur durch lang andauernde Einwirkungen oder sehr starke emotionale Eindrücke veränderbar. Dies liegt auch daran, dass eine emotionale Konditionierung nicht erst stattfindet, nachdem wir über kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Lernen und Erinnern auf bewusster Ebene verfügen. Bereits vorgeburtlich lernen wir durch die Aktivität von Amygdala und mesolimbischem System, was für uns gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Hieran können wir uns später nicht bewusst erinnern, weil in der Zeit der Konditionierung zwar das limbische System schon aktiv war, jedoch weder unser Kortex als Sitz von Verstand und Vernunft noch der Hippocampus als Sitz unseres deklarativen Gedächtnisses bereits ausgebildet sind. Das Gefühl von richtig oder falsch, gut oder schlecht, bleibt jedoch wirksam und kann im späteren Leben unser Befinden und unser Handeln entscheidend beeinflussen.
Der vorgeburtliche Lernprozess auf den unteren limbischen Ebenen erfolgt durch die Verbindung von Mutter und Embryo über die Blutbahn. Jeder emotionale Zustand der Mutter löst in ihrem Gehirn die Ausschüttung von Botenstoffen und Substanzen aus, die über die Blutbahn das Ungeborene erreichen und dort auf dessen Entwicklung, und damit auch auf die kindliche Hirnentwicklung, einwirken und diese nachhaltig beeinflussen.
Gegenstand intensiver Forschung sind hier vor allem traumatisches Erleben der Mutter oder aber Suchtverhalten oder anderes selbstschädigendes Verhalten der Mutter während der Schwangerschaft und die Auswirkungen auf den Embryo. Besonders untersucht sind die Folgen für das spätere Stressverhalten und die Stressresistenz des Kindes (vgl. Roth 2016: 30, ebd.: 188).
Cingulärer, ventromedialer und orbitofrontaler Kortex bilden die obere limbische Funktionsebene. Verhaltensüberwachung, Impulskontrolle und Fehlerkorrektur, also wesentliche Bereiche unseres Sozialverhaltens, werden hier gesteuert. Hier entwickelt sich die Empathie und auch die Fähigkeit zur Kooperation. Wir erfahren, dass unser Verhalten Konsequenzen hat, für uns und unsere Umwelt, wir akzeptieren gesellschaftliche Regeln und moralische Standards, eben unsere Kultur.
Darüber hinaus findet in der oberen limbischen Ebene die emotionale Kontextkonditionierung statt. Wir erinnern uns beispielsweise nicht nur an das peinliche Gefühl des Rüffels, den uns jemand verpasst hat, sondern auch an die Menschen, die dabei waren, an den Ort, wo es passierte, an das Wetter an diesem Tag und an vieles mehr. In der oberen limbischen Ebene beginnt unser bewusstes Lernen in der späteren Kindheit und Jugend.