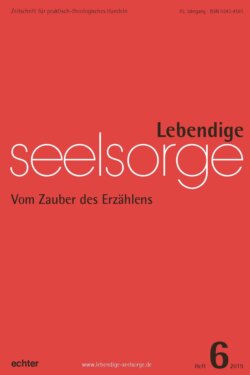Читать книгу Lebendige Seelsorge 6/2019 - Verlag Echter - Страница 5
ОглавлениеInkarnative Erzählungen
Gesellschaftlich dominante Narrative begründen einen sozialen Bereich der Sichtbarkeit, Sagbarkeit und Lebbarkeit. Prekäre Lebenserfahrungen werden von ihnen mitunter ins Außen abgeschoben und unsagbar gemacht. Doch manchmal ereignet es sich, dass das verworfene Andere Raum und Gestalt gewinnt – in inkarnativen Erzählungen. Christian Kern
SCHAUDER BEIM ERZÄHLEN
„Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreib ‚Metoo‘ als Antwort auf diesen Tweet“. Diese Worte postete Alyssa Milano am 15. Oktober 2017 auf Twitter. Im Kontext des kurz zuvor bekannt gewordenen Weinstein-Skandals, wollte Milano Frauen ermutigen, Erfahrungen sexualisierter Gewalt publik zu machen und auf deren weite Verbreitung hinzuweisen. Der Tweet ging viral. Innerhalb von 25 Stunden griffen ca. 500.000 Menschen das Stichwort auf, in den folgenden Monaten formierten sich weltweit verschiedene Varianten von Metoo-Bewegungen. Nicht nur wurde der hashtag geteilt, es wurden auch öffentlich von konkreten Erfahrungen sexualisierter Gewalt, Bedrohung oder Ausbeutung erzählt. Frauen wie Männer aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen, besonders Kollegen Milanos aus Film oder Showbusiness, gaben dem Thema weitreichende Präsenz.
In einer verwandten Weise kam es in Deutschland ab dem Jahr 2010 zu einer Welle von Erzählungen. Ein Brief aus dem Canisius-Kolleg initiierte bekanntlich die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und -strukturen an der dortigen Schule sowie an vielen weiteren Einrichtungen und Orten der katholischen Kirche. Auch in diesem Zusammenhang wurde erzählt.
Missbrauchsüberlebende berichteten öffentlich von Gewalterfahrungen, Strukturen des Verschweigens und repressiven Widerständen in der Aufarbeitung, von Menschen die Ohren abwendeten, aber auch solchen, die unterstützten und zuhörten.
Fachtagungen beleuchteten die Themenkomplexe aus pastoralpsychologischer, praktisch und systematisch-theologischer Sicht und ließen Betroffene zur Sprache kommen, die von eigenen Erfahrungen berichteten, Aufarbeitungsmaßnahmen kritisch kommentierten und Veränderungen forderten.
Die Erzählungen der Metoo-Bewegungen und der Missbrauchs-Aufarbeitung in Deutschland und weltweit sind eigener Art und haben eine besondere Kraft. Sie sind keine Geschichten, die erzählt werden, um Hörer*innen und ihre Herzen zu erfreuen, keine Gedichte, die von bekannten Autoren bei Lesungen aufgeführt werden und Applaus erzielen, keine Bildungsromane, die intellektuell sättigen. Sie sind auch keine großen Erzählungen, die soziale oder kulturelle Zusammenhänge fassen, organisieren und Menschen in eine gemeinsame Richtung bewegen. Es gibt bei ihnen keinen „Zauber des Erzählens“ in dem Sinne, dass Staunen, Freude oder Begeisterung geweckt werden. Sie sind Erzählungen, die erschüttern, empören, auch verstören können. Angesichts der Perversion von Tätern und der Perfidität von Vertuschern tritt an die Stelle eines Zaubers der Schauder der Erzählung.
Christian Kern
geb. 1981, Dr. theol., Postdoc Fellow an der Theologischen Fakultät der Universität Leuven, Belgien; aktuelles Forschungsprojekt unter dem Titel „Critical embodiments – A performative theology of provocative political performances“.
Dieses Schaudern aber hat eine eigene Kraft. Es kann nicht nur in Empörung übergehen, sondern kann, wenn ihm von Hörer*innen nicht ausgewichen wird, einen kritischen Prozess initiieren. Erzählungen dieser Art lenken die Aufmerksamkeit auf bisher verborgene Taten, auf Bedingungen, welche diese ermöglichten, auf Strukturen, die ihr Sichtbarwerden und Sagbarwerden verhinderten. Sie fordern damit implizit oder explizit eine Veränderung innerhalb dieser Bedingungen, damit Unrecht und Gewalt gebüßt, Leben geschützt und Erfahrungen sichtbar gemacht werden können. Sie initiieren Aufdeckung und Aufklärung und beanspruchen eine Präsenz für Erfahrungen, die bisher außen vor geblieben waren.
Diese Kraft, die im Mut von Betroffenen wurzelt, desillusioniert. Indem sie die Schattenseiten der Strukturen aufdeckt, nehmen sie ihnen ihre Unschuld und Selbstverständlichkeit. Im Gegenlicht der Erzählungen werden Strukturen entzaubert, inklusive der Narrative, die sie umgaben und stabilisierten: Hollywood ist keine Traumfabrik, in Hinterzimmern lauern Alpträume. Katholische Kirche(n) sind nicht einfach ‚Kirche für die Menschen‘, sondern in unmenschliche Seilschaften und Praktiken verstrickt, die Verbrechen ermöglich(t)en und Täter schütz(t)en.
PERFORMATIVITÄT VON ERZÄHLUNGEN
Diese kritische Kraft von Erzählungen lässt sich mit einem Begriff der Sprechakttheorie rekonstruieren und näher bestimmen: Performativität. Dieser Begriff geht zurück auf den englischen Sprachphilosophen John L. Austin, der ihn Mitte der 1960er Jahren einführt. Von dort wird er in vielfältigen Weisen in politischen und kritischen Theorien aufgegriffen, bei Stanley Cavell etwa, bei Jacques Derrida, Michel de Certeau oder Judith Butler (vgl. Austin; in systematischer Theologie hat die Rezeption von Performativer Theorie kürzlich begonnen, etwa in Gregor Hoffs Konzipierung von Fundamentaltheologie als performative Theorie, in Peter Zeilingers Konzept einer Gemeinschaftohne-Souveränität, in Martin Kirchners Netzwerk „Eine performative politische Theologie für Europa“, in meinem aktuellen Forschungsprojekt zu „provocative political performances“ an der KU Leuven).
Eine der Perspektiven, die Austin einführt, ist, dass Sprechakte nicht nur einen Gehalt haben, sondern auch stets eine Handlungsdimension. Sagen und Tun gehen Hand in Hand, und zwar nicht bloß in dem Sinne, dass Sagen zu Konsequenzen im Handeln führt, sondern dass im Sprechakt selbst etwas getan wird. Zu sagen „Ich verspreche dir…“ bedeutet, im Sagen selbst das Versprechen zu geben, d. h. es zu tun, und in der Folge auf bestimmte Verpflichtungen festgelegt zu sein.
Das Gleiche gilt für Erzählungen. Sie haben nicht nur einen Gehalt, sondern tun etwas, indem sie erzählt werden: Sie sind Handlungen in sozialen Kontexten. Erzählungen können, erstens, Strukturen identifizieren, stabilisieren, plausibilisieren. Sie reproduzieren darin beispielsweise Erinnerungen und verlängern sie in ihre Zukunft hinein. Sie orientieren Hörer*innen auf etwas Gemeinsames hin, z. B. indem sie bestärken, lotsen, motivieren, trösten und das Bild einer anvisierten Zukunft eröffnen. Diese Erzählungen sind informativ und konsolidierend. Große Erzählungen im Sinne von J.-F. Lyotard haben diese performative Bestärkungsqualität. Strukturell betrachtet arbeiten sie an der Stabilisierung von Orten und Funktionen innerhalb eines diskursiven Zusammenhangs.
Erzählungen können, zweitens, aber auch anders handeln, eben in der Weise der geschilderten Erzählungen aus Metoo-Bewegung und Missbrauchs-Debatte. Sie bestätigen dann keine Strukturen, sondern intervenieren kritisch und kreativ in diese: Sie benennen Facetten, Erfahrungen, Gegebenheiten, die bisher ungesagt und unerkannt waren. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf Bedingungen und Strukturen, die wie selbstverständlich dasjenige regulierten, was sichtbar, sagbar, lebbar werden durfte – wer wie wo erscheinen konnte und (an-) erkennbar war. Sie decken die Ausschlussmechanismen dieser Strukturen auf und die Weisen, wie Lebensfacetten und -gestalten gerade nicht erscheinen konnten.
Sie fordern darin implizit eine Veränderung innerhalb der entsprechenden Strukturen und – das ist der entscheidende Punkt – nehmen hier und jetzt bereits diese andere Ordnung der Sichtbarkeit, Sagbarkeit und körperlichen Präsenz in Anspruch: Sie realisieren sie performativ im Moment des Sprechens, Zeigens, der körperlichen Präsenz. „Du hast mir das Recht abgesprochen, zu erzählen, jetzt aber tue ich es! Ich widerspreche dir hiermit und realisiere einen bisher verworfenen, abgeschlagenen Teil von Leben in einem andersartigen Raum!“.
Strukturell betrachtet handelt es sich um einen dreiheitlichen Vorgang aus Ort, Praxis und Raum. Die Praxis des Erzählens bezieht sich auf spezifische Orte (Hollywood, katholische Kirche). Diese Orte sind nicht nur konkret geographisch lokalisierbar, sondern sind durch sozial und kulturell etablierte und geteilte Inhalte und Zusammenhänge identifiziert, mit Sinn und Bedeutung gefüllt. Spezifische Personen gelten ggfs. als repräsentativ für diese Orte (Regisseure bei Oscarverleihungen, Bischöfe bei Jahresversammlungen). In diesen diskursiven und repräsentativen Strukturen sind Sinn und Bedeutung gewissermaßen festgezurrt und beanspruchen eine selbstverständliche Geltung. In ihnen ist festgelegt, was an diesen Orten und über diese Orte gesagt, getan und gelebt werden kann – und anerkennbar ist.
Genau in diese Struktur intervenieren die Erzählungen kritisch und kreativ. Indem sie Ausgeschlossenes, Verworfenes, Verstummtes zu artikulieren beginnen, widersetzen sie sich den Ausschlussmechanismen der Strukturen und bestreiten ihre Selbstverständlichkeit. Sie spielen bisher verborgene oder unsichtbare Inhalte, Formen, Facetten ein und verschieben Sinn und Bedeutung der Orte. Die Praxis der Erzählungen öffnet dadurch einen Raum, in dem etwas Anderes zu greifen beginnt, das die Orte kritisch verändert und ihre Geltungsmacht bestreitet – wenn nicht sogar gänzlich aufhebt.
Diese kritische Infragestellung hat eine kreative Seite: Im Akt des Erzählens selbst werden veränderte Bedingungen der Sagbarkeit, Sichtbarkeit und Lebbarkeit in Anspruch genommen, die bisher ausgeschlossen, de-realisiert, nicht-anerkennbar waren. Sie treten hier und jetzt performativ in Erscheinung und implizieren die Forderung, auch zukünftig lebbar zu sein.
Diese kritische Kraft der Erzählung ist ein Merkmal aller wirklichen performances: Ihnen ist eine „essential contestedness“ (Marvin Carlson) zu eigen, d. h. eine Strittigkeit, die selbstverständliche Eindeutigkeiten infrage stellt und für andere Lebens-/Verkörperungsbedingungen eintritt. Ich möchte diese charakteristische Dynamik von Erzählungen/performances als „Inkarnativität“ bezeichnen. Erzählungen wie die eingangs geschilderten sind „inkarnativ“, weil sie eine Alterität einspielen, die selbst nicht ausgelotet werden kann, aber in dieser Bezugnahme bzw. Eröffnung eine Veränderung in herrschenden Lebens-/Sichtbarkeits-/Verkörperungsbedingungen fordern und zugleich im Akt des Erzählens diese andere Lebbarkeit performativ realisieren.
EVANGELIUM ALS INKARNATIVE ERZÄHLUNG
Das Evangelium Jesu ist eine inkarnative Erzählung in diesem Sinn. Ein Beispiel dafür sind die Geburtserzählungen des NT. Dort wird nicht nur über Inkarnation/Menschwerdung erzählt. Vielmehr haben die Erzählungen in performativer Hinsicht – in dem, was sie tun – eine inkarnative Qualität.
Für heutige Leser*innen und Hörer*innen mag diese Dimension verdeckt oder fern sein, vielleicht weil die Geburtserzählungen zu sehr in Weihnachtsharmonie und Friedensutopie der stillen Nacht eingepackt sind. Aber für Menschen in den Kontexten, in denen sie zuerst erzählt wurden, müssen sie diese kritische und kreative Kraft entfaltet haben. Denn sie widersprechen herrschenden politischen Theologien vehement: Der Gott in Menschengestalt ist dem Befehl des göttlichen Kaisers – seinem Dogma – entgegengesetzt. Nicht in der Herrschaftsfigur des sol invictus auf dem römischen Thron, sondern in Menschengestalt abseits der imperialen Wege zeigt sich das Antlitz Gottes. Indem so die Herrschaftstheologie des Imperiums durch die Geburtserzählung infrage gestellt wird, wird ebenso die Selbstverständlichkeit bestritten, mit der Menschen ihre Körper dem Imperium unterwerfen sollten.
Diese Ent-Unterwerfung spielt sich nicht nur in einer fernen Zukunft ab, sondern wird jetzt und hier im Akt des Erzählens selbst realisiert. Bedingungen des Erscheinens, der Sichtbarkeit, Sagbarkeit und Lebbarkeit, werden in Anspruch genommen, die bisher verworfen waren, jetzt aber in Form der Erzählung Gestalt gewinnen. Es handelt sich dabei nicht um eine große, epochale Erzählung, sondern um eine kleine, kritische Intervention, die doch zu großen Infragestellungen und Aufbrüchen führt.
Erzählungen sind „inkarnativ“, weil sie eine Alterität einspielen, die selbst nicht ausgelotet werden kann, aber in dieser Eröffnung eine Veränderung fordern und diese andere Lebbarkeit performativ realisieren.
In diesem Sinne sind die Evangelien verstörende, irritierende, empörende Beanspruchungen eines anderen Glaubens und anderer Lebensverhältnisse innerhalb von herrschenden Strukturen. Sie verlagern ihre anderen Perspektiven nicht irgendwohin (Utopien), sondern realisieren sie, indem sie erzählerisch-kritisch in die religionspolitischen Kontexte der jeweiligen Gegenwart intervenieren und erzählend-kreativ andere Verkörperungsbedingungen praktizieren und einfordern.
Auch die Ostererzählungen haben diese inkarnative Qualität. Ostern ist keine story von makellosem Erfolg oder glänzender Souveränität, sondern verstört. Eben davon wird auf inhaltlicher Ebene erzählt. Die Frauen am Grab treffen unvorhergesehen auf die Leerstelle: Jesus ist weg. Was sie dort zu sehen und zu hören bekommen, verstört sie zutiefst und schlägt sie in die Flucht. „Denn sie fürchteten sich“. Ebenso irritiert sind auch die Jünger, als ihnen davon erzählt wird: helle Aufregung; und die empörte Unterstellung, die Frauen seien von Sinnen. Später am leeren Grab werden auch sie irritiert davongehen. Dort läuft ein Schauder über den Rücken.
Nicht nur auf inhaltlicher Ebene wird von Verstörendem, Irritierendem, Empörung erzählt. Analog zu den Geburtserzählungen wirken die Osternarrative in ihrem religionspolitischen Kontext ebenfalls so. Wie kann es denn sein, dass Gott gerade mit einem Menschen identifiziert ist, der als von Gott verworfen/verflucht galt und aus der Sphäre des ehrbaren Lebens ausgesondert war? Wer vom auferstandenen Gekreuzigten erzählt(e), stellt nicht nur herrschende Souveränitätstheologien infrage, sondern beansprucht darin Lebens- und Verkörperungsweisen, die sich dem Zugriff herrschender Mächte entziehen und zugleich deren Exklusionsmechanismen kritisch spiegeln.
Auch heutige Kontextstrukturen können in diesem Sinne aufgebrochen werden. In der Figur des Auferstandenen begegnet uns kein froher, über alles Leiden erhabener, makellos schöner Strahlemann. Erst recht nicht begegnet uns dort einer, der sich als Gründungsfigur einer imperialen Weltkirche heranziehen ließe. Ganz im Gegenteil. Wir bekommen es dort mit einem geschlagenen, geschundenen, geschändeten Menschen zu tun. Er hat die große Dissoziation hinter sich und war in einen Bereich des Todes geraten, wo kein Leben mehr geblieben war, außer einem erstickten Schrei. Es ist unfassbar, dass dieser geschändete und getötete Mensch nun wieder unter den Lebenden sein soll! Und dass Gott gerade mit ihm/ihr identifiziert ist! Jenseits von verklärendem Osterfrohlocken schauen wir hier einer verstörenden Gestalt ins Gesicht, von der sich mancher vielleicht abwenden will.
Diese Erscheinungsgestalt rückt die Ostererzählungen in die Nähe von Geistererzählungen (vgl. Hoff) statt in die Nähe von Heldenepen. Vor allem aber verbindet sie Ostern mit Missbrauchserzählungen. Ostern kann einem, so wie diese, einen Schauder über den Rücken jagen. Aber gerade dieser Schauder des Erzählens führt auch zu jener kritischen und kreativen Kraft, die inkarnativen Erzählungen eigen ist: Im auferweckten Gekreuzigten spiegeln sich diejenigen Mächte und Gewalten, die bestimmte Leben und Erfahrungen unsichtbar, unsagbar, unerkennbar machten. Ihre „Nekropolitik“ (Achille Mbembe) wird aufgedeckt. Darin wird zugleich eine Veränderung der Herrschaftsbedingungen gefordert und in der Erzählung der Erscheinungen des de-realisierten Lebens performativ, hier und jetzt, in Anspruch genommen.
KRITISCH GEGENÜBER GROSSEN ERZÄHLUNGEN
Das Evangelium Jesu bildet vor diesem Hintergrund keine großen Erzählungen und taugt nicht zu deren Begründung. Es ist vielmehr eine partikulare Aktivität, die Große Erzählungen entzaubert. Es raubt ihnen ihre Unschuld, deckt kritisch ihre insgeheimen Machtgehalte und Ausschlussmechanismen auf und realisiert im Erzählen das Andere, bisher Verworfene. Diese kritische und kreative Kraft ergibt sich aus der Grundaktivität des Evangeliums. Es nimmt Bezug auf ‚Gott‘, wendet sich an ‚Gott‘ und spricht darüber. Weil dieser Gott allerdings jedes Reden, Sprechen, Handeln übersteigt, setzt sich das Evangelium einer Ungreifbarkeit und Unsagbarkeit aus, die das Fassungsvermögen jeder Erzählung sprengt und relativiert. Bezugnahmen auf Gott stellen eine kritische Leerstelle und einen Impulsgeber dar, durch die herrschende soziale Erzählungen kritisch befragt werden, in welchen Weisen sie Facetten menschlichen Lebens verwerfen, unsichtbar und unsagbar machen. Innerhalb von bestehenden Orten, die in umgreifenden Narrativen integriert und organisiert sind, nimmt das Evangelium Jesu Bezug auf das Andere, Ausgeschlossene und Verworfene menschlichen Lebens, und begegnet von dort her – von außen – den Inhalten und Strukturen der dominanten Erzählungen.
Es entfaltet darin eine politische Kritik, die den Widerspruch zu herrschenden Ordnungen der Sichtbarkeit, Sagbarkeit und Verkörperung von menschlichen Leben und Erfahrungen mit einschließt. Es plädiert und realisiert dabei ebenso kreativ, im Sprechakt der Erzählung selbst, eine andere Weise des Lebens und entsprechender Verkörperungsbedingungen und fordert ein, dass diese in Zukunft gesellschaftlich lebbar gemacht werden. Diese Perspektive ist notwendigerweise partikular, weil sie an den jeweiligen partikularen Rahmen gebunden ist, in dem sie auftaucht, und weil jeder Totalisierungs- bzw. Universalisierungsversuch von der Unfassbarkeit der Leerstelle Gottes unterlaufen wird.
Das Evangelium Jesu ist eine partikulare Aktivität, die Große Erzählungen entzaubert.
Kurz gesagt: Das Evangelium ist keine Große Erzählung. Es ist ein kleiner Tweet, der Unsagbarkeiten und Unfassbarkeiten einspielt. Seine Kraft entfaltet sich im Raum, der Bedingungen von Sichtbarkeit, Sagbarkeit und Verkörperung verändert, so dass verworfenes Leben zutage treten, Gestalt gewinnen, ins Leben kommen kann.
LITERATUR
Austin, John L., Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Stuttgart 2017.
Hoff, Gregor, Religionsgespenster. Versuch über den Religiösen Schock, Paderborn 2017.