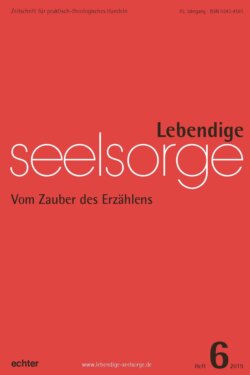Читать книгу Lebendige Seelsorge 6/2019 - Verlag Echter - Страница 6
ОглавлениеPathos anstelle differenzierter Begriffsklärung? Eine (auch Selbst-) Kritik
Die Replik von Regina Polak auf Christian Kern
Für eine Kirche und eine Theologie, die – wie im deutschsprachigen Raum vermutet werden darf – aufgrund einer langen Geschichte gesellschaftlicher und religiöser Hegemonie vergessen hat, dass „die Evangelien verstörende, irritierende, empörende Beanspruchungen eines anderen Glaubens und anderer Lebensverhältnisse innerhalb herrschender Strukturen“ (S. 391, letzte Hervorhebung RP) sind, ist die Erinnerung Christian Kerns an diese religionspolitische Dimension ihrer normativen Gründungstexte eine heilsame Erschütterung.
Auch die mithilfe der Sprechakttheorie analysierte Charakteristik von Erzählungen wie der „#MeToo“-Bewegung oder der Missbrauchs-Aufklärung als performative Erzählungen, die die Hörer*innen so gar nicht verzaubern, sondern die „Schattenseiten“ (S. 389) gesellschaftlicher und kirchlicher Strukturen entlarven, ist nicht nur wissenschaftlich und sprachlich brillant, sondern wirkt befreiend, weil deren kritische und kreative Kraft freigesetzt wird, die zu veränderndem Handeln motiviert. Insofern eignet Christian Kerns Text selbst ein zutiefst „inkarnativer“ Charakter: Er spielt in die Diskurse der Pastoral eine Alterität ein, die auch diese zu Veränderungen stimuliert.
Durch seinen Sprech- und Argumentationsstil demonstriert Kern zugleich, wie theologische Rede aussehen kann, die sich des Charakters ihrer biblischen Erzählungen besinnt. Sein Text gibt trotz – oder wegen – seiner irritierenden Qualität Hoffnung (das Evangelium als „kleinen Tweet“ (S. 393) zu beschreiben, ist ja nicht eben alltäglich). Nicht nur, weil er zeigt, dass und wie die scheinbare Schwäche des Evangeliums Leben freisetzen kann, sondern weil allein an der Existenz eines solchen Textes sichtbar wird, zu welch ungeheurem kritisch-kreativem Potential die aktuelle Kirchenkrise die Theologie befreien kann.
Ich möchte jedoch auch einige Rückfragen, Anmerkungen und einen (Selbst-)Zweifel zum Ausdruck bringen.
1) Das Erzählen konkreter traumatischer Lebenserfahrungen, wie z. B. im Rahmen von „#MeToo“, ist weder automatisch kritisch in dem Sinn, dass sachgemäße Analysen dadurch möglich werden, noch führen die dadurch ausgelösten Veränderungen von selbst zu kreativen Verbesserungen. Das weiß jede/r Psychotherapeut*in, der/die mit zwar konkreten, aber nicht selten stereotypen und ebenso verschleiernden „kleinen Erzählungen“ konfrontiert ist, die – wie „Große Erzählungen“ – ebenfalls stabilisieren können. Heilung wird nämlich erst möglich, wenn durch neue Perspektiven, Interpretationen und Framings die Einbettung in größere Sinnzusammenhänge ermöglicht wird und diese Geschichten nicht ausschließlich subjektiv, sondern auch sachlich der Ereigniswahrheit näherkommen. Die negativ stabilisierende Kraft biographischer Leiderzählungen lässt sich auch beobachten, wenn NS-Täter ihr subjektives Leid in den Kriegsjahren erzählen und damit die Auseinandersetzung mit ihrer Schuld abwehren. Auch wenn dieses Leid existenziell „wahr“ ist, bleiben solche Erzählungen ohne Einbettung in den größeren Horizont historischer Zusammenhänge sowie Reflexionen individueller und politischer Ethik hochgradig problematisch. Nicht zuletzt ist eine anerkennende und selbstkritische Rezeption der Erzählungen erlebter sexueller Gewalt alles andere als selbstverständlich und erst in unserem Jahrhundert dadurch möglich geworden, dass „Große Erzählungen“ wie die Befreiung der Frauen oder die Menschenrechte in weiten Teilen der Bevölkerung und vor allem bei gesellschaftlichen Eliten gewürdigt werden.
Vor nicht allzu langer Zeit noch sind solche Erzählungen und vor allem die Erzählerinnen schlichtweg empört und mittels Täter-Opfer-Umkehr-Narrativen zum Schweigen gebracht worden. Die performative Dimension solcher Narrative setzt also bestimmte soziokulturelle, politische, ethische Bedingungen voraus, die noch genauer zu klären wären: Unter welchen Bedingungen kann deren kritisch-kreatives Potential freigesetzt werden? Mir scheint, dass „Große Erzählungen“ im Hintergrund dabei eine wichtige Rolle spielen.
2) Der Begriff der „Großen Erzählungen“ ist deshalb für seine theologische (Nicht-) Verwendbarkeit noch dringend differenzierungsbedürftig (auch auf meiner Seite). Lyotards Verständnis, wie es Kern beschreibt, scheint mir zu unspezifisch, um ihn gänzlich aus der Theologie zu verdammen. Denn zur (negativen) „Stabilisierung von Orten und Funktionen innerhalb eines diskursiven Zusammenhangs“ (S. 390) können eben auch „kleine“, sogar inkarnative Erzählungen beitragen. Umgekehrt können auch „Große Erzählungen“ bestimmter Qualität kritisch sein: Man denke nur an das Exodus-Motiv, das als „Große Erzählung“ von einem Gott, der durch die Geschichte hindurch aus religiösen und politischen Unterdrückungsverhältnissen rettet, marginalisierte Gruppen bis heute zu Widerstand und Hoffnung ermutigt. Wäre der Exodus nur für diese eine konkrete Situation als Erzählung relevant (und vielleicht sogar nicht einmal in unserem modernen historischen Sinne „wahr“), nehmen wir westliche Theolog*innen, die wir ein schlechtes Gewissen ob seines politischen Missbrauchs haben, den Marginalisierten mit unserem generellen Vorbehalt gegenüber „Großen Erzählungen“ nicht eine wichtige Quelle der Hoffnung? Denn erst eine geschichtstheologische Abstraktion gibt diesem Motiv Kraft. Freilich wären auch für solche Abstraktionen Qualitätskriterien zu entwickeln. „Große Erzählungen“ sind in diesem Sinne geschichtliche Glaubenserfahrungen, die zwar konkreten Ereignissen abgerungen werden, aber doch einen universalen Anspruch in sich bergen. Der entscheidende Unterschied zwischen „guten“ und „schlechten“ „Großen Erzählungen“ kann also nicht im Abstraktionsgrad, im Kritik- oder Kreativitätspotential liegen noch auch in der (de)stabilisierenden Wirkung als solcher, weil es eben davon abhängt, wer oder was in welcher Situation und zu welchem Zweck (de)stabilisiert werden soll.
3) Damit bin ich bei einem Zweifel, der mich angesichts des massiven Vorbehaltes gegen das Stabilisieren und das Pathos der irritierenden Alterität beschleicht – wissend um das Pathos, das sich auch mit (m)einem Verständnis der „Großen Erzählung“ verbinden kann und meiner Liebe zu ebendiesem theologischen Habitus. Begegnet mir dieser Stil, den ich sonst selbst gerne pflege, als Gegenüber, sticht mir plötzlich dessen Einseitigkeit ins Auge. Mit einem Mal bin ich es, die in einem Text Trost, Hoffnung und Stabilisierung als zentrale Dimensionen biblischer Verkündigung vermisst und sich fragen muss, ob die Sehnsucht danach ein Zeichen von mangelnder Intellektualität ist.
Vermutlich sind auch in dieser Hinsicht Differenzierungen erforderlich, die ich hier nicht leisten kann: An wen richtet sich der Text Kerns? Wer kann/darf unter welchen hermeneutischen Bedingungen biblische Texte tröstlich, selbstbestätigend und ermutigend deuten? Wer muss sie selbstkritisch lesen? Für die Verfasser biblischer Texte, die als Vertriebene in Exil und Diaspora lebten, war die Erinnerung an einen Gott, der die Mächtigen und Reichen vom Thron stürzt, tröstlich – für wohlhabende Professor*innen in Westeuropa wie mich wohl eher nicht. An wen richtet sich Christian Kerns Text? Mit wessen Ohren hört er die Tradition?
4) Tatsächlich problematisch aber wird die einseitige Betonung der destabilisierenden Fragmentarität inkarnativer Erzählungen in der Darstellung Jesus von Nazareth als des „ganz Anderen“. Ja, das war und ist er auch. Und die Evangelien reichen tatsächlich nicht für eine „Große Erzählung“. Aber sie sind weder das Ganze des Neuen Testaments, das auch gemeindestabilisierende Texte kennt, noch ist „das“ Evangelium Jesu (was meint Kern damit?) ohne die Einbettung in die „Großen Erzählungen“ (v. a. des Alten Testaments), die sich wie rote Fäden in den heterogenen Texten der Bibel erkennen lassen, auch nur annährend zu verstehen. Die Entbettung, die Kern hier vollzieht, könnte nämlich den Anschein Jesu als einer radikal neuen Singularität erwecken, die mit dem Jude-Sein Jesu und dessen Aufgreifen, In-Erinnerung-Rufen und Reinterpretieren alttestamentlicher Narrative nichts zu tun hat.
Das radikale Insistieren auf der Alterität des Evangeliums Jesu bekommt so ungewollt eine Schlagseite, die den aktuellen Stand der Exegese unterbietet. Denn der „kleine Tweet“ des Evangeliums bekommt seine Kraft in der Spannung zwischen konkreter situativer Einbettung und der „Großen Erzählungen“ biblischer Glaubenserfahrungen, die ihn speisen.