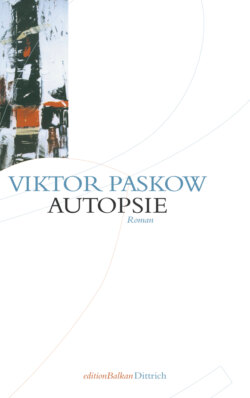Читать книгу Autopsie - Viktor Paskow - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAufwachen um fünf.
Schon seit Wochen wache ich um fünf auf.
Das bedeutet, ich habe ungefähr vier Stunden den unruhigen Schlaf eines Tresorknackers geschlafen.
Ich stehe auf, stoße gegen den Stuhl, dann gegen den Schreibtisch.
Zu meinen Füßen kullert mit leisem Klirren eine fast leere Flasche herum. Ich sage »fast«, weil in ihr eine bräunliche Flüssigkeit schwappt, ungefähr eineinhalb Schlucke. Kurz darauf ist die Flasche ganz leer, und ich habe Rochen im Bauch.
Ich gehe in Unterhosen hinaus auf den Balkon.
Draußen ist es finster, warm und klebrig. Von der Baustelle des »Philip Johnson House« dringt Lärm herüber. Kleine Gestalten, türkische, griechische und bulgarische Gastarbeiter in gelben Overalls, mit Schutzmasken vor dem Gesicht, laufen hin und her, übergossen von orangem Licht, wie unter dem Deckel eines riesigen Aquariums irgendwo auf dem Mars.
Sie arbeiten Tag und Nacht.
Sie arbeiten samstags und sonntags. Sie wühlen in einem riesigen Loch herum, das von eisernen Konstruktionen durchzogen ist, und unter ihren Händen leuchten die Flammen von Schweißgeräten auf: weiß, bläulich und grün.
Mister Johnson ist ein amerikanischer Architekt, ein Bastard von zweiundneunzig Jahren.
Zwischen die Zähne seines grinsenden Porträts gegenüber hat jemand mit roter Sprühfarbe einen fetten Penis gemalt: ein Gruß der Arbeiterklasse.
Der Alte, oder genauer seine Mannschaft, hat beschlossen, seinen idiotischen Wolkenkratzer direkt vor meiner Nase in die Höhe zu ziehen, hier, wo sich früher ebenes Feld erstreckte und ich eine Aussicht bis zum Checkpoint Charlie hatte.
Ich gehe zurück ins Bett.
Vergebliche Versuche, erneut einzuschlafen.
Am Ende halte ich es nicht mehr aus. Ich stehe auf. Ich gehe in die Küche. Ich mache mir Tee. Ich toaste ein paar Scheiben Brot. Ich bestreiche sie mit Diätmargarine, die das Cholesterin senkt (ha, ha!). Ich schneide eine spanische Tomate auf, belege die Brotscheiben mit französischem Hartkäse und dänischer Wurst, koche ein deutsches Ei weich. Ein kurzes, qualvolles Frühstück, das mit zwei Löffeln Natron und zwei Aspirin von Bayer endet.
Ich nehme einen nassen Lappen und wische damit peinlich genau das Linoleum der ganzen Küche.
Mit einem anderen befreie ich den Tisch, Schränke und Fenster von Krümeln und Staub. Ich spüle die beiden Teller und die Tasse, eine Gabel, ein Löffelchen und ein Messer und lege sie an ihren Platz.
Inzwischen ist es sechs Uhr.
Das Husten und Zittern beginnt. Herzklopfen.
Ich gehe ins Bad, zünde mir eine Zigarette an und putze mir die Zähne. Die Tiere in meinem Magen lassen sich nicht mehr bändigen. Das Frühstück landet in der Toilette. Ich stütze mich einige Zeit mit der Hand an der Wand ab. Mein Herz rast. Arrhythmie. Ich knie mich hin und versuche, es in eins meiner Hosenbeine auszukotzen. Aber es will sich nicht durch die Speiseröhre zwängen und in das Hosenbein hinein.
Ich drücke die Zigarette aus. Schweiß rinnt über meine Schläfen.
Mir ist schlecht.
Mir ist furchtbar schlecht. Mir ist schwindlig. Ich vibriere. Ich zünde mir eine neue Zigarette an. Ich bekomme keine Luft. Wenn ich will, dass die Krise vorbeigeht, muss ich ins Wohnzimmer gehen und einen Schluck aus der Flasche nehmen. Nein, das werde ich nicht tun, das werde ich nicht tun. Ich werde es nicht tun! Natürlich werde ich es tun. Mein Herz macht einen Satz. Es bleibt stehen. Ich drücke die Zigarette aus. Ich werde es nicht tun. Mein Gott! Ich kann nicht atmen.
So ... jetzt ist es gut ... Jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe den Fusel von letztem Jahr ausgetrunken, den man mir in Sozopol geschenkt hatte. Eine Widerwärtigkeit mit Feigengeschmack.
Nimm den Rasierer und schau dich nicht an!
Rasier dich vorsichtig, stütz die rechte Hand mit der linken ab, damit du dich nicht abschlachtest!
Dieses Gesicht ist nicht meines. Es ist ausgetauscht worden. Höchstwahrscheinlich hat man es in einem dieser geheimnisvoll anmutenden Antiquitätenläden ausgegraben, im Halbdunkel, unter dem schweren Geruch von verrottendem Papier und bedeutungslosen Gegenständen. Meine Mutter würde dieses Gesicht nicht wiedererkennen. Ebenso wenig mein Vater. Aber sie sind nicht mehr am Leben, und es gibt keinen Grund, warum sie mich wiedererkennen sollten.
Ich steige in die Wanne: Strafduschen. Heiß-kalt, kalt-heiß. Heiß, bis man schier wahnsinnig wird. Kalt, bis man schreit. Ich bringe das Bad mit Reinigungsmitteln auf Hochglanz und ordne Rasierzeug, Cremes, Eau de Cologne und Zahnbürsten unter dem Spiegel an.
Ich habe keine Zigaretten. Ich habe schon wieder keine Zigaretten! Zum wievielten Male wohl habe ich morgens keine Zigaretten?
Ich gehe in die Unterführung der U-Bahn, kaufe zwei Schachteln Marlboro, es ist ungefähr acht Uhr morgens.
Ich mache einen Abstecher ins Theater. Der Portier sieht von seiner Zeitung auf und nickt mir träge zu. Er ist meine morgendlichen Besuche gewohnt. Wir kennen einander schon seit zwanzig Jahren. Eigentlich dürfte er mich nicht reinlassen, weil dieses Theater seit einem halben Jahr nicht mehr existiert. Das Gebäude ja, aber das Orchester, der Chor, das Ballett, die Sänger und die Technik wurden von der Berliner Stadtverwaltung aufgelöst, es sind keine Mittel für den Luxusartikel Kultur mehr übrig. Sie zahlten uns eine Abfindung und jagten uns zum Teufel.
Morgens schleifen mich meine Beine wie von selbst hierher, obwohl es mühsam ist und schmerzlich. (Oder vielleicht gerade deshalb.)
Ich gehe in den Orchestergraben. Es ist dunkel, aber ich kenne meinen Platz: das erste Pult der Klarinetten. Ich kann es mit verbundenen Augen finden. Es riecht nach staubiger Bühne, nach Kostümen und Vorhang. An diesem Pult nahm ich als ganz junger Musiker zum ersten Mal Platz, vor zwanzig Jahren. Wie durch ein Wunder hatten mich die Zerberusse der bulgarischen »Konzertdirektion« ziehen lassen. Und das ohne jegliche Beziehungen, nur aufgrund der Empfehlung der Deutschen Kommission. Früher geschahen ab und zu auch Wunder. Ich habe über zwanzigtausend Konzerte, Tourneen und Vorstellungen hinter mich gebracht. Die ganze Zeit über war ich nur zwei- oder dreimal krank. Ich kam sogar mit einem gebrochenen Bein zur Arbeit. Ganze drei Monate lang. Wir alle lebten in diesem Theater wie ein Staat im Staat. Von der morgendlichen Probe bis spät in die Nacht, die im Club bei Elsa endete. Wir interessierten uns nicht für Veränderungen und Politik. Wir befanden uns außerhalb des Wirbelsturms. Wir waren Außerirdische. Jetzt gehören wir zum traurigen Heer der fünf Millionen vierhunderttausend Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt gibt es keine Elsa mehr, keine verrückten Dirigenten, der Herr möge sie bestrafen, keine Jamsessions, kein Koks, keinen Christoph, nichts.
Auch keine Ina. Schon zwei Monate und fünf Tage.
Ich kehre zurück in die leere, riesige Wohnung.
Kaffee, Zigarette.
Ein Appell zum Erbrechen. Erneut das Klo: Galle.
Ich würge noch ein wenig, mein Puls überschreitet die Hundertzwanzig. Ich gehe hinaus auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Woher frische Luft? Ich starre auf den Schriftzug am benachbarten Gebäude an: AENGEVELT IMMOBILIEN.
Nachts blinkt diese Aufschrift unrhythmisch und rötlich, und das mittlere »I« von IMMOBILIEN leuchtet nicht. Auf dem Dach des Gebäudes flattert eine ausgebleichte, rote Flagge. Ich habe in all den Jahren nicht herausgefunden, was sie bedeuten soll.
Nonstop Gedanken an Ina, zwei Monate und fünf Tage Gedanken an Ina, ein und dasselbe, immer wieder ein und dasselbe, das wird mir den Rest geben.
Was sie wohl jetzt im Augenblick in Sofia macht?
Geht sie arbeiten?
Wo arbeitet sie?
Mit wem schläft sie?
Warum hat sie mich verlassen?
Warum hat sie mich die ganze Zeit über belogen? Warum habe ich all diese Monate mit der größten Irren von Sofia zusammengelebt? Warum ich? Womit habe ich das verdient?
Warum ich?
... Vor zwei Jahren, nach einer mörderischen Tour mit Freunden durch alle Pianobars der Hauptstadt, landeten wir im Jazzclub in der Rakovski-Straße. Damals war die Welt noch in Ordnung. Ich hatte Urlaub. Von einem Griechen in Kreuzberg hatte ich einen klapprigen Audi aus dritter Hand gekauft, mit dem ich nach Sofia zuckelte. Zusammengepfercht wie Würmer in der Dose eines Anglers fuhren wir kreuz und quer durch die nächtlichen Straßen.
Im Club spielte Harry die Buchtel.
Wir hatten einander seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen, seit damals, als er sich mit Krummbein und Kolo Leberfleck nach Dänemark absetzte. Die drei hatten ein halbes Jahr in einer Kneipe in Kopenhagen zugebracht, und als der Vertrag auslief und die Zeit gekommen war, nach Bulgarien zurückzukehren, hatte Harry eine schmutzige Nummer abgezogen. Danach kamen Krummbein und Kolo lange Zeit auf keinen grünen Zweig mehr und spielten nur am Schwarzen Meer, aber sie verziehen es ihm bald. So ist das bei Musikern.
Jetzt war die Buchtel aus seinem Zuckerbäcker-Kopenhagen für einige Wochen zurückgekommen und spielte in diesem kleinen Club zu seinem eigenen Vergnügen und zum Vergnügen seiner Freunde. Alle waren da: Papst Stefan und Vanjo die Harmonika, Edi, Christian, Svetljo Vox, Svetla und Toni sowie ein Haufen unverschämter Jungspunde, deren Visagen ich nicht kannte.
Die Buchtel vollbrachte wahre Wunder an der Hammondorgel und entlockte ihr unglaubliche Effekte. In diesen gut zehn Jahren hatte er sich weiterentwickelt und steckte voller Energie wie eine gespannte Feder. Mit einem Wort: ein Klassemusiker.
Jemand drückte mir ein Saxophon in die Hand. Ich glaube, es war Papst Stefan. Ich denke, es war sein eigenes.
Ich stellte mich neben Harry auf, er drehte sich zu mir, grinste und reckte für einen Augenblick den Daumen in die Höhe.
Er hatte mindestens zwanzig Kilo zugenommen und einen Kropf wie ein Pelikan, aber seine Augen waren immer noch so rund und listig wie früher, und seine Finger lang, dünn und schnell.
Ich wusste, dass er eine Variation über »Honky Tonk« spielen würde, à la Coltrane. Damals im Konservatorium machten wir uns einen Spaß daraus, dieses Stück stundenlang zu spielen, voller Stolpersteine und Harmonien, die sich ineinander verstricken wie Spinnen im Liebesclinch.
»Ist alles eine Frage der Ekstase, Kurde!«, schrie Harry zwischen zwei wahnsinnigen Modulationen. Der Spruch stammte ebenfalls aus der Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Ich musste antworten, dass die Ekstase in der Phrase selbst liegt und alles andere eine Metastase ist.
Solche Sprüche klopften wir im Paläolithikum, als uns alles ein Kinderspiel zu sein schien, als der Jazz direkt ins Blut ging wie das Gift einer Klapperschlange und uns in sein schwarzes Loch saugte, und wir waren glücklich wie diese Affen, wie hießen sie doch gleich, die mit den roten Hintern.
Am Anfang spielten wir uns die Themen leicht und locker zu, wie zwei Tennisprofis beim Aufwärmen. Allmählich biss sich die Buchtel fest und begann, mich die Tonleitern und Harmonien rauf und runter zu scheuchen; ich meinerseits bemühte mich, schon einen Takt im Voraus zu erraten, in welche Hölle der Improvisation er mich im nächsten Augenblick zwingen würde, und ich erriet es; ich scheuchte ihn auch, ich blies ins Rohr und zerlegte die Melodie chromatisch in ihre Bestandteile, wir fanden zusammen und trennten uns wieder, wir machten musikalische Scherze und stellten uns Fallen, die all die alten Fratzen, die bis unter die Hutkrempe voll waren und wie die Ölsardinen in den Séparées hockten, verstanden und schätzten, während die Jungspunde verdutzt aus der Wäsche schauten, weil sie ihre eigenen Tricks und Späße hatten. Er machte einen auf Jimmy Smith, hatte die einfachen Akkorde hinter sich gelassen und spielte schnelle und atemlose Bebop lines, verstärkt durch einen glasklaren und schneidigen Sound, wie ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr von einem lebenden Organisten gehört hatte. Zum Finale schlug Harry abrupt einen Septakkord mit erhöhter Quint an und überließ mir die Kadenz, die ich beinahe drei Minuten lang auskostete, wobei ich modulierte und mich um jeweils einen Halbton immer höher hinaufschwang, und als ich die Modulationen ausgeschöpft hatte, riss ich die Melodie mit einem Abschiedskiekser in der vierten Oktave, der einem durch Mark und Bein geht wie ein Überschalldüsenjäger durch eine Wolke, in der Mitte auseinander wie ein Blatt Papier.
»Heil Hitler, Kurde! Du spielst wie Goebbels. Du hast mir ganz schön zugesetzt«, schnaufte Harry, während er sich Hals und Stirn mit einem Handtuch abwischte.
»Deine Linke weiß immer noch nicht, was deine Rechte tut«, antwortete ich im selben Stil. »Genug von dieser Litanei. Lies Andersen. Der hat ein Wahnsinnslehrbuch für Akkordeon geschrieben.«
In diesem Augenblick, während die Buchtel und ich uralte Nettigkeiten austauschten, sah ich sie. Sie saß mit Svetljo Vox an der Bar und nahm einen Schluck von ihrem Getränk.
Svetljo flüsterte ihr etwas ins Ohr. Was ein Musiker einem langbeinigen, überirdischen Wesen mit feuerrotem wallendem Haar bis zur Taille, Lippen wie bei einer Posaunistin und grünen Augen wie zwei Fleischerbeilen zuzuflüstern hat, ist natürlich klar. Ich würde nicht sagen, dass mich der indianische Blitz traf, aber die Fleischerbeile spalteten mein Gehirn wie einen Kürbis.
... Sie fehlt mir schrecklich. Ich bin unglaublich einsam. Ich habe Angst vor dem Tod. Wenn ich durch die Straßen gehe, halte ich mich dicht bei den Gebäuden; wenn ich einen plötzlichen Infarkt bekomme, soll mein Körper langsam an der Wand zu Boden gleiten und nicht wie ein Sack umfallen, damit ich mir nicht die Visage verbeule.
Depressionen, Stress, Alkohol und drei Schachteln Zigaretten am Tag. Zu nichts habe ich Lust. Ich habe kein Ziel, keinen Willen, mein Leben hat keinen Sinn. Mir graut vor der Zukunft, vor dem Alter, vor der Perspektivlosigkeit. Die Gleichungen sind unerbittlich und niederschmetternd. Diese Welt und dieses Leben sind ein Traum unter Narkose. Ich bin ein Zombie.
An jenem Abend saßen Ina und ich an der Bar, bis der Morgen dämmerte. Svetljo trat mir großmütig seinen Platz ab und verschwand irgendwo in der Menge. Auf dem Podium wechselten sich die Musiker ab. Nur die Buchtel war nicht von der Bühne zu bekommen, so als wollte er aus seiner Seele die ganze Musik hinausspielen, die sich dort in den langen, ekstasefreien Jahren in der luxuriösen Puderdose Dänemark angesammelt hatte. Irgendwann stiegen auch die Jungspunde zu ihm hinauf, und sie spielten wunderbar.
Worüber wir sprachen, während wir den nachgemachten schottischen Whisky soffen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Über das wiedervereinigte Deutschland, was mich nur peripher interessierte, über das Leben am Theater, das ich nicht gegen drei wiedervereinigte Deutschlands eintauschen würde, über die absolut verrückte Situation in Bulgarien, die die Proleten und Demagogen »Demokratie« nannten, über ihre Arbeit bei irgendeiner Zeitung, wo sie Anzeigenverkäuferin war, und darüber, wie schwierig es war, die Mafiosi bei den Banken dazu zu bringen, ein paar Leva in Werbung zu investieren ...
Aber wenn ich sie mir so ansah, wie sie mit diesem kurzen Rock auf dem Barhocker saß, der eher einem Lendenschurz der Papuas glich, wie zwischen ihren langen Schenkeln das Dreieck ihres Slips schwarze Funken sprühte, wie ihr das dichte, rote Haar in gleichmäßigen Wellen ins Gesicht fiel und über ihrem asiatisch anmutenden, mandelförmigen sattgrünen Auge mit stecknadelkopfgroßer Pupille zu liegen kam, wie sie es sich mit einer kalkulierten, eleganten Geste ihrer schmalen Hand wegstrich ... und diese winzigen, erotischen Sommersprossen rund um die provokative Stupsnase, unbekümmert verstreut über ihre Haut, die so weiß war wie der Bauch einer Forelle ... zum Teufel, es konnte wohl kaum so schwer sein, der Bankenmafia für ihr Schmierblättchen einen Haufen Kohle aus der Tasche zu leiern.
Alle kannten Ina. Und alle kamen der Reihe nach an die Bar: Küsschen links, Küsschen rechts, Nasereiben, »Wie geht’s, Baby?« – und obwohl die meisten der alten Kollegen auch mich freundlich ausfragten, wie es mir denn so gehe im verfluchten Deutschland, fühlte ich, dass sie der eigentliche Anziehungspunkt war.
Das war vielleicht seltsam, aber es bereitete mir Vergnügen. Ina war zu allen gleich nett. Ihre Stimme – tief, samtig und mit silbrigen Intonationen im oberen Register – erinnerte an den Klang eines Englischhorns, das eine langsame und gedehnte Melodie spielt. Diese Stimme umschlang meinen Körper und fiel weich und in zärtlichen Falten auf ihn wie Tüll, wie Sternbilder aus farbigen Bläschen, die im Mondlicht funkeln.
Gegen vier Uhr morgens gelang es uns, uns (wie ich damals dachte) unbemerkt davonzumachen. Jetzt bin ich geneigt zu glauben, dass uns alle bemerkt hatten, aber weil das Teil des Programms war, hielt es niemand für notwendig, den Lauf der Dinge zu ändern.
»Wohin?«, fragte ich energisch, als wir im Audi saßen.
»Exarch-Josif-Straße, gleich neben der Kirche«, antwortete sie ebenso energisch.
Das gefiel mir irgendwie. Es machte mich sentimental. Ich war in der Iskăr-Straße geboren, nur eine Querstraße von der Exarch-Josif-Straße entfernt, und hatte meine ganze Kindheit in diesem alten, staubigen Viertel verbracht. Ina war offensichtlich neu zugezogen, denn es wäre nicht möglich gewesen, dass ich nichts von ihr wusste. Jedes Haus und fast jeder Bewohner waren mir aus der Vergangenheit bekannt. Ich war ein Oldtimer.
Es zeigte sich, dass sie im Haus von Mitko dem Schönen wohnte, nur dass seine Wohnung im ersten Stock war und ihre im vierten. Ina kannte Mitko nicht, wie nicht anders zu erwarten. Wir absolvierten seinerzeit zusammen das Gymnasium in der Stara-Planina-Straße, danach wurde Mitko Filmvorführer im Kino und verschwand nach Kanada, wo sich seine Spur verlor.
Die Hälfte ihrer Einzimmerwohnung wurde von einem riesigen Bett eingenommen. Die Bettdecke war zurückgeschlagen, die weißen Laken leuchteten matt im Halbdunkel. Ansonsten ein Bücherregal, Telefon, in der Ecke ein Tisch mit drei Stühlen, Küchenbox, Bad.
»Willst du duschen?« Ihre Frage klang ganz natürlich, so als fragte sie mich, ob ich einen Kaffee und die Morgenzeitung wollte.
Ebenso natürlich zog ich T-Shirt und Jeans aus, streifte die Unterhose ab und machte mich auf den Weg zur Dusche. Neben dem Spiegel stand ein Glas, aus dem noch verpackte Zahnbürsten ragten. Lange putzte ich mir die Zähne und spülte den Mund aus. Der gefälschte Whisky brodelte in meinem Magen. Ich fragte mich, ob ich ihn nicht davon befreien sollte, aber das Geräusch wäre im Zimmer zu hören gewesen.
Ich entschied mich für Strafduschen und stand lange unter dem grausamen Strahl. Ich gab mir Mühe, nicht zu denken. Die Kadenz drang erneut in meinen Kopf ein. Ich stellte die Dusche genau bei jenem durchdringenden letzten Ton in der vierten Oktave ab. Ich fühlte mich richtig gut.
Als ich das Zimmer betrat, räkelte sie sich in der Mitte des riesigen Bettes, ihr flammengleiches Haar lag über die Kissen verstreut, und die Decke war zu Boden geglitten. Sie hatte etwas wie einen weißen Arztkittel an, der bis ganz unten aufgeknöpft war. Sie verschränkte die Hände hinter ihrem Schwanenhals und spreizte die Beine. Ihre lockigen, rötlichen Härchen schimmerten durch den Netzslip, und ihre großen, birnenförmigen Brüste mit den rosa Warzen quollen zu drei Vierteln aus dem dünnen Band des schwarzen BHs hervor. Ihre vollen Lippen öffneten sich, und sie ließ ihre Zungenspitze über sie gleiten.
»Komm«, raunte sie. »Langsam.«
Ganz langsam beugte ich mich voll erigiert über sie. Ich hatte das Gefühl, als legte ich mich auf eine chinesische Vase. Genau in dem Augenblick, als sich unsere Körper berührten, drehte sie sich zur Seite und legte sich auf den Bauch. Ich fiel neben sie aufs Bett. Mein Herz schlug wie verrückt.
Sie beugte sich über mich, steckte die Daumen in das Band ihres BHs und zog es hinunter. Ihre Brüste, die nach Honigmelone dufteten, schaukelten vor meinem Gesicht, und ihre harten Brustwarzen berührten meine Lippen. Ich hob die Hände, um sie zu umfassen, aber sie flüsterte:
»Du wirst nichts tun. Du wirst dich nicht rühren. Du wirst mich nicht berühren. Wiederhole!«
»Ich werde nichts tun ...«
Ina legte sich auf mich und ließ ihre Zunge über meine Wimpern, meine Nase, meine Lippen und meinen Hals gleiten. Ihr Körper rutschte immer weiter nach unten. Er war feucht und klebrig. Sie begann, an meinen Brustwarzen zu saugen – zuerst an der linken, dann an der rechten, sie nahm sie zwischen die Zähne und biss leicht hinein. Ein Krampf ging durch meinen ganzen Körper. Ihre Zunge kreiste um die Vertiefung des Nabels, glitt hinein und wieder hinaus, und mein Penis, der inzwischen zu unglaublichen Ausmaßen angeschwollen war, rieb sich an ihren schaukelnden Brüsten und benetzte sie mit seinem klebrigen Sekret. Sie nahm die Eichel zärtlich mit ihrer Unterlippe auf, umfasste meinen Penis mit der Hand und leckte ihn ab. Danach umschloss sie ihn ganz mit den Lippen und begann, rhythmisch den Kopf zu drehen, wobei sie ihren Griff abwechselnd verstärkte und lockerte. Ich stöhnte auf und erzitterte.
»Du wirst dich nicht rühren«, flüsterte sie für einen Augenblick und begann dann wieder, an ihm zu saugen. Diesmal nahm sie ihn bis zur Wurzel auf, und ich war verblüfft darüber, dass er ganz in ihren Mund passte und wie tief er in ihrem Hals eingedrungen war. Gleichzeitig schob sie mit zwei Fingern ihren Slip zur Seite und begann, ihre Klitoris zu massieren, sich die Finger einzuführen und sie wieder herauszuziehen mit jenem zärtlichen, schmatzenden Geräusch, das die Sinne vibrieren lässt und das Bewusstsein verfinstert. Sie legte sie auf meine Lippen, und ich leckte sie ab; sie hatten einen seltsamen, leicht süßlichen Geschmack von gekochten Kastanien. Sie saugte meinen Penis aus, gab ihn dann frei und begann, ihn mit der Hand zu massieren, indem sie zudrückte und den Griff wieder lockerte. Danach beugte sie sich herab und küsste mich, wobei sie mir ihre Zunge tief in den Hals steckte.
»Du wirst nur zusehen«, flüsterte sie wieder, »und wirst nichts tun ... Wiederhole!«
»Ich werde nichts tun ...«
Ihr Flüstern machte mich schwindlig, und ich fühlte mich seltsam leicht und willenlos. Mein einziger Wunsch war es, endlich in sie einzudringen und mich in sie zu ergießen, mich zu ergießen bis ganz hinunter zur Wurzel meines Familienstammbaums ...
Sie streckte sich, öffnete das Schränkchen neben dem Bett und holte einen dicken, schwarzen Vibrator hervor. Sie leckte ihn ab. Erneut begann sie, mit ihren feuchten Fingerspitzen meine pulsierende Eichel zu liebkosen. Sie drückte sie leicht zusammen, und an ihrer Spitze erschien ein dicker, perlmuttfarbener Tropfen. Sie nahm ihn mit dem Finger auf und verschmierte ihn auf der Spitze des schwarzen Gliedes. Dann hockte sie sich über mich, wobei sie mit ihren Schenkeln meine Brust umfing, zog ihren Slip wieder zur Seite, und mit geschlossenen Augen begann sie, die Eichel des Vibrators zwischen ihre rosa Schamlippen zu schieben, wobei sie ihn immer wieder vor und zurück bewegte. Das Instrument summte leise, und sie stöhnte auf. Die Eichel glitt hinein. Ganz langsam versank der ganze riesige, vibrierende künstliche Penis in ihr, und mit den Fingern ihrer linken Hand begann sie, ihre Brustwarze zu kneten.
»Willst du ihn mir reinstecken ... jetzt?« – Ihre Stimme klang um eine ganze Oktave höher.
»Ja ...«
»Wohin? ...«
»Wohin du möchtest ... Überallhin ...«
»Sag es ...«
»In den Mund ... von vorn ... von hinten ... zwischen die Brüste ...«
Sie zog den Vibrator heraus, und aus ihrem geweiteten Loch floss klebriger Saft die Innenseiten ihrer Schenkel hinunter. Sie packte meinen Penis, führte ihn in Richtung Öffnung und steckte ihn geschickt hinein. Danach setzte sie sich auf ihn, doch ich hielt es nicht mehr aus und warf sie auf den Rücken, ihre Beine kamen auf meinen Schultern zu liegen, und ich versank ganz in ihr, ganz bis zu den Eiern.
In dem Moment, in dem sie unter Stöhnen und Schluchzen spürte, dass ich mich entleeren würde, zog sie sich schnell zurück, fasste ihn mit beiden Händen und nahm ihn erneut bis zur Wurzel in den Mund.
In diesem Augenblick entleerte ich mich bis auf den letzten Tropfen, ich ergoss mich wie ein Fass, es war wie eine Flut, mein Sperma ließ ihren Mund überlaufen und floss in Rinnsalen und Bächen über Wangen, Hals und Brüste.
Sie verschmierte es mit den Händen auf ihrem Gesicht und ihrem ganzen Körper, sammelte Tropfen mit der Hand auf und verschmierte sie auf ihrer Klitoris, und ich ergoss mich, ergoss mich, ergoss mich, bis ich jenen finalen, zerreißenden Ton der Kadenz hörte, hinter dem es keine Töne mehr gibt, keine Musik, kein Licht und keine Gefühle.