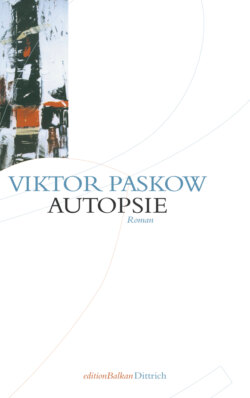Читать книгу Autopsie - Viktor Paskow - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGegen Abend halte ich die stille Hysterie nicht aus, die mich zerfrisst wie einen Nagel, den man in Coca-Cola legt. Ich gehe zu Fuß zum Alexanderplatz. Dort steige ich in die Straßenbahn Richtung Weißensee, mit der ich ungefähr fünfzehn Haltestellen lang durch die Gegend schaukle. Ich steige an der Bizetstraße aus und mache mich auf den Weg zu Christophs Höhle.
Ich betrete den öden Berliner Hinterhof, den vier Gebäude mit grauen Wänden begrenzen, an denen verzagt verfaulter rötlicher Efeu hängt. Es riecht nach Moder. Der Efeu ruft in meinem kranken Bewusstsein natürlich sofort Assoziationen zu ihrem Haar hervor.
Ich steige zu Fuß die durchgescheuerten Holzstufen in die fünfte Etage hinauf, weil es in diesem von Gott, den Eigentümern und dem Ministerium für Wohnungsbau vergessenen, baufälligen Haus keinen Aufzug gibt.
Ich bleibe vor Christophs Tür stehen, an der ein riesiges, freches, anarchistisches Plakat hängt: FINE AND THE FIVE.
Auf ihm ist die nackte Ballerina Fine in Handschellen und Ketten abgebildet wie Laokoon, der mit den Schlangen kämpft. Die fünf hingegen sind Christophs ehemaliges Quintett, mit dem er vor einiger Zeit ganz Europa bereiste, um es gegen einen Haufen Geld mit rechtsradikaler Choreographie und avantgardistischem Jazz zu schockieren.
(Remember the good times!)
Ich schnaufe einige Zeit lang und bemühe mich, mit dem Zwerchfell zu atmen, wobei ich mich mit der rechten Hand an Fines knabenhaftem Körper abstütze. Drinnen dröhnt mit dem Krachen eines Kippladers Christophs altmodisches Grammophon, er hat es bis zum letzten Strichlein der Skala aufgedreht.
Herbie Hancock.
Es besteht keine Gefahr, dass die Nachbarn die Polizei rufen, weil alle Wohnungen im Gebäude leerstehen, mit Ausnahme des ersten Stocks, wo ein versoffener und unartikulierter konstruktivistischer Künstler wohnt, der die Polizei, die Gesellschaft, den Staat und die ganze Erdkugel bis ins Mark hasst.
Einen Augenblick lang verspüre ich den Drang, noch morgen in diese stinkende Zitadelle der Ausgestoßenen einzuziehen und mich leise in einer Ecke zu häuten, Schicht für Schicht, Haut für Haut, bis von mir nur noch ein trockenes und ausgedörrtes Herzstück übrigbleibt, das irgendein Barmherziger eines Tages mit Schaufel und Besen wegfegen möge.
Dann erinnere ich mich wieder an den nicht vorhandenen Aufzug und verwerfe den Einfall.
Ich trommle mit den Fäusten gegen die Tür. Ich trete eine Zeit lang dagegen.
Am Ende macht mir Christoph schwungvoll auf. Sein langes, blondes Haar liegt unordentlich auf Schultern und Stirn verstreut. Seine blauen, glasigen Augen glänzen darunter wie Meißner Porzellan. Altmodische Hosenträger, die sich über seinen dicken, nackten Bauch spannen, der an eine sächsische Bierkuh erinnert, hindern diesen daran, zu platzen und sich auf den schmutzigen Boden zu ergießen.
»Hilfe«, artikuliert er monoton. »Die Bulgaren kommen.«
Ich schiebe ihn beiseite und betrete die Wohnung durch den langen Korridor, der mit Haufen von Noten, alten Schallplatten, staubigen Plakaten und abgewetzten Schuhen aus den Dreißigern vollgestellt ist.
Christoph schlurft mir hinterher und murmelt etwas in Richtung der unzivilisierten Kakerlaken aus Südeuropa, die das Deutsche Reich überschwemmt haben und die fleißigen arischen Musiker um ihr Brot bringen, die nie Wort halten und nicht wissen, wie man die elementarsten Errungenschaften des Fortschritts nutzt, zu denen übrigens auch das Telefon gehöre.
Ich betrete das Wohnzimmer mit dem krachenden Grammophon und setze mich auf den Holzstuhl neben dem Bücherregal. Eigentlich sind es grobe Regalbretter, die sich auf mittelalterliche Nägel stützen, auf denen pedantisch ungefähr zweitausend Bücher angeordnet sind, die chronologisch die geistige Entwicklung Christophs nachzeichnen: Ganz unten Fenimore Cooper und Karl May. Darüber Krimis und Thriller von Conan Doyle bis Forsyth. Noch weiter oben deutsche Literatur aus der Epoche der Romantik. Hauptsächlich Lyrik und viel Goethe. Es folgen Fichte, Kant, Hegel. Schopenhauer. Nietzsche. Heidegger, Jaspers, die Frankfurter Schule, die Manns, Hesse, der ganze Böll, der ganze Grass, alle möglichen, Beckett, Genet, Sartre, Miller, Bukowski, ein Haufen abgedrehter Amerikaner, und auf den letzten zwei Regalbrettern – Christophs Tagebücher, die er seit zehn Jahren führt.
Von dem Tag an, an dem Sieglinde seine Seele zur Explosion brachte und sich mit seinem besten Freund Kim aus dem Staub machte.
Christoph holt unter dem Tisch eine halbleere Flasche »Jim Beam« hervor, knallt sie vor mich hin und geht in die Küche, um noch größere Unordnung zu stiften, während er Ordnung macht.
... Die Spannung lässt allmählich nach. Mein Körper wird leicht, und ich fühle mich geborgen in diesem finsteren und chaotischen Zimmer, in dem sich nichts verändert hat, seit Christoph vor Jahren nach der Geschichte mit Sieglinde eingezogen ist.
Die Wände sind immer noch so schmutzig und abgeblättert, mit großen, gelben Flecken von der Feuchtigkeit an der Decke. Das Sofa – ein vorsintflutliches, aus Plüsch bestehendes und ausgeweidetes Ungeheuer – lehnt nach Altherrenmanier an der gegenüberliegenden Wand. Davor kauern ein altmodisches Tischchen mit Löwenfüßen und zwei Sessel vom Trödel, deren Federn sich einen Weg durch die abgewetzten Sitzflächen gebahnt haben. Der Teppich, von irgendeinem Dachboden geklaut, ist bis auf die Kettfäden ausgedünnt, seine Farbe kann man nicht mehr identifizieren. Der rötliche Rumpf von Christophs Kontrabass lehnt in der Ecke und ist der einzig wertvolle Gegenstand in diesem nach Blut, Schweiß und Tränen riechenden Zimmer. Davor der Notenständer mit Etüden und Übungen. Das Grammophon, die Stereoanlage, ein Haufen Schallplatten und ein Telefon. Ein kleiner Balkon hinter meinem Rücken, durch dessen Geländer eine traurige Berliner Birke ihre Zweige steckt. Ein Dutzend leerer Bierflaschen wälzt sich im jahrzehntealten Staub neben dem Sofa.
Die Höhle meines genialen Freundes Christoph.
... Es gab Jahre, in denen sein Gesicht permanent auf den Titelseiten der renommiertesten europäischen und amerikanischen Jazzmagazine prangte. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Male er die Charts von »Down Beat« anführte. Während seiner endlosen Tourneen rund um den Erdball bekam ich ihn monatelang nicht zu Gesicht. Er spielte mit den größten Musikern der Welt: Albert Mangelsdorff, John Coltrane, Charlie Mariano, Charles Mingus, Miles Davis ...
Vor vielen, vielen Jahren, während einer Session – ich denke, es war in Amsterdam – trafen wir uns auf der Bühne und fanden sofort aneinander Gefallen. Ich war begeistert von seiner Art, wie er dem erschütterten Instrument mit seinen groben, kurzen Metzgerfingern rasende Akkorde und berauschende Passagen entriss, den Kopf in den Nacken geworfen, mit langen Haaren, aus denen der Schweiß in Strömen floss, geschlossenen Augen und exaltiertem Gesichtsausdruck. Ich hatte bis dahin noch nie einen Bassisten mit so einem satanischen harmonischen Denken gesehen und gehört. Christoph schlängelte sich zwischen den Harmonien hindurch und fand den richtigen Ausgang mit der Schnelligkeit und Genauigkeit einer blinden Natter, die sich zwischen dichtem Dornengestrüpp auf ihrer wahnsinnigen Flucht vor ihren Verfolgern pfeilschnell fortbewegt. Seine Finger sausten über das ganze dicke und riesige Griffbrett wie paranoide Tausendfüßler, und um mit seinem Tempo und seinen Einfällen mithalten zu können, musste ich das Atemvolumen einer Schiffssirene und auch deren Schalldruck haben.
Nach dem Gig landeten wir in der Bar irgendeines Hotels, die wir mit Wodka abgefüllt und den Nasen voller Koks in Begleitung zweier Huren verließen. Unterwegs kamen uns, Gott sei Dank, die Huren abhanden. Wir verliefen uns, hingen bis zum Morgen auf einer Brücke über eine der Grachten herum und spuckten ins trübe Wasser.
»Bulgare!«, lallte Christoph mit geschwollener Zunge. »Wir müssen ein Duo aufziehen. Hingehen und deutsche Weihnachtslieder auf dem Friedhof der sibirischen Schamanen spielen. Wo ist der Friedhof der sibirischen Schamanen?«
»Geradeaus und dann rechts«, erwiderte ich. »Hinter dem räudigen Haus mit den pickligen Säulen da drüben.«
Hinter dem räudigen Haus jedoch war kein Friedhof sibirischer Schamanen. Da war eine weitere Brücke und eine weitere Gracht.
»Die Schamanen sind verklungen«, konstatierte Christoph. »Sie sind verhallt. Sibirien existiert nicht. Fuck it!«
»Sibirien ist kein geographischer Begriff«, stimmte ich zu, während ich schwankend neben ihm stand. »Sibirien ist ein Geisteszustand.«
»Ganz genau! Sein Geist bibbert vor Kälte. Wir müssen ein Iglu für ihn finden. Ein Iglu mit heißen sibirischen Frauen, sibirischem Bourbon und sibirischem Cool Jazz. Der Jazz in Sibirien ist doch kalt?«
»Kälter als der Hintern eines Cherubs. Werden wir wieder miteinander spielen?«
Christoph blieb stehen, legte seine Hände auf meine Schultern, starrte mir mit seinem scharfen, blauen Blick in die Augen und erklärte feierlich:
»Das ganze Leben werden wir miteinander spielen, Bulgare. Bis wir für immer ausgespielt haben. Wie die sibirischen Schamanen.«
Christoph hielt sein Versprechen.
Nach jener weit zurückliegenden Amsterdamer Nacht spielten wir noch unzählige Male miteinander. In Jazzkellern, Pianobars, Clubs, bei Matineen und auf großen Bühnen – immer, wenn ich keine Vorstellung und Proben im Theater und er ein Engagement für mich hatte. Wir passten ideal zueinander. Sehr schnell gewöhnte ich mich an sein musikalisches Denken oder eher an das Vorhandensein eines phantastischen musikalischen Instinkts und die Absenz jeglichen Denkens.
Das waren glückliche Zeiten ... Es regnete Engagements vom Himmel, und alle Musiker waren Brüder. Es gab Tourneen durch Europa, die Staaten und Japan. Die Berliner Mauer war soeben gefallen, und in Prenzlauer Berg, dem Künstlerviertel Ostberlins, brodelte in allen Kneipen und an allen Ecken und Enden ein stürmisches Nachtleben. Die Invasion von Künstlern aus dem Westen und aus Amerika hatte noch nicht begonnen. Gelder wurden aufgetrieben. Der Jazz triumphierte in allen Sektoren der riesigen Stadt.
Dann tauchte Sieglinde wie ein Rassepferd aus der persischen Mythologie auf.
Sieglinde war großgewachsen, mit langem, glattem, kastanienbraunem Haar bis zur Taille, grauen baltischen Augen, slawischen Wangenknochen und Alabasterhaut. Ihre Nase war klassisch gerade, die Lippen voll, sinnlich und fein gezeichnet, das Kinn lief sanft spitz zu wie das einer Fee in einer Märchen-illustration. Von ihrem runden Hintern, der straff war wie die Membran einer kleinen Trommel, ergossen sich die beiden schlanken Ströme ihrer herrlichen Schenkel, die so verführerisch waren, dass auch ihre weiten, schmutzigweißen Malerhosen, die sie übergestreift hatte, es nicht verbergen konnten. Sie hatte eine schmale Taille wie eine Gottesanbeterin und großzügige Brüste, die so rund waren wie Lampions aus dem 19. Jahrhundert und frei unter ihrem ausgeleierten Matrosenhemd baumelten, offenbar wurden sie nicht von einem BH gehalten und hatten auch nie einen gesehen.
Sieglinde war verrückt wie eine ganze Herde wild gewordener Ziegen. Absolut irre. An jenem Abend saß sie zusammen mit einer dünnen Statuette im »Einäugigen« am Nebentisch, blond und lockig wie ein Albinoafrikaner, mit bis zum Bauchnabel aufgeknöpftem, kariertem Männerhemd, aus dem freimütig zwei kleine, wie Weihnachtskugeln runde Brüste hervorschauten.
Die beiden ließen sich mit Bier und Doppelkorn volllaufen, steckten sich die Zungen in die Ohren, Nasenlöcher und Münder und begrapschten sich, dass die Wände wackelten. Sie waren vollkommen betrunken.
Der »Einäugige« war bis unter die Decke gerammelt voll mit echten und selbsternannten Musikern, Künstlern, Literaten, Regisseuren und ehemaligen Spitzeln, die aus Gewohnheit herkamen oder einfach, weil sie sonst nirgends hinkonnten. Unter den beiden kahlen, grünlichen Lampen, die von der Decke hingen, breitete sich ein Schleier von dichtem Zigarettenrauch aus. Jeder bemühte sich, seinen Nachbarn zu überschreien. Aus der Anlage dröhnte primitive Diskomusik. Niemand schenkte Sieglinde und der Statuette Beachtung. So ein Anblick war in diesem Teil von Berlin nichts Besonderes. Das Publikum war viel zu egozentrisch und mit sich selbst und seiner eigenen Verrücktheit beschäftigt. Nur die dicke Kellnerin mit dem Sumoringerbizeps kam von Zeit zu Zeit, um die leeren Gläser abzuräumen, knallte angewidert die neuen Halben auf den Tisch und zog sich würdevoll zurück. Die beiden machten hinter ihrem Rücken unanständige Gesten, streckten ihr die Zunge raus und kicherten wie Hexen.
Christoph und ich saßen am Nebentisch, gafften die Hündinnen an, und uns triefte der Speichel aus dem Mund:
»Hey, seid ihr schwul?«, rief uns die Kleine zu.
»Ich bin schwul. Aber er hier nicht«, antwortete Christoph schnell.
»Warum nicht?«, empörte ich mich. »Tief in mir drinnen bin ich schwul!«
»Nein, bist du nicht! Du bist Bulgare und viel zu primitiv.«
»Ihr glotzt uns schon die ganze Nacht an und habt einen Ständer«, meldete sich Sieglinde. Ihre Stimme war tief und leicht heiser. »Das ist doch keine Peepshow? Und wer zahlt am Ende die Rechnung?«
»Er hier wird sie bezahlen, weil er pervers ist. Ich bin nur eine gewöhnliche Schwuchtel«, erklärte Christoph.
»Gut, ich werde bezahlen. Können wir uns zu euch setzen?«
»Wenn du eine Runde Champagner ausgibst!«
Champagner ist ein hinterhältiges Getränk. Nach dem zweiten Glas sitzt du plötzlich vor der dritten Flasche. In deinem Gehirn zerplatzen die Bläschen. Deine Phantasie arbeitet wie ein Staubsauger. Sie saugt den ganzen Müll aus der Umgebung auf, und du hast das Gefühl, dass du Orchideen isst.
Am nächsten Morgen fanden wir vier uns nackt und bibbernd auf Christophs Matratze in seiner Katastrophenwohnung in der Borodinstraße wieder. Nur eine Querstraße von seiner jetzigen Höhle entfernt. In diesem Viertel tragen alle Straßen Namen von Komponisten.
Im Zimmer lag nur diese riesige Matratze ausgebreitet. Ein Tisch, ein Stuhl und der Kontrabass mit dem Notenständer standen in der Ecke.
Von hier ging ein kleiner Korridor aus, der in einer Zwei-mal-zwei-Meter-Küche endete. Es folgte ein Miniaturklosett mit kaputter und verrosteter Schüssel, an dessen Tür Christoph mit einem Reißnagel sein Lieblingsbild gepinnt hatte: ein kahles und grinsendes Männlein mit einem riesigen erigierten Glied, auf dem es mit dem Bogen eines Kontrabasses spielt. Am unteren Ende der Matratze stand eine Kiste Champagner mit zwei vollen und zehn leeren Flaschen.
Mein Kopf schmerzte brutal. Ich hatte keinerlei Erinnerungen. Ich streckte mich, öffnete die eine Flasche und nahm einen kräftigen Schluck. In unseren Kreisen nennt man so was »Sektfrühstück«. Allmählich wurde ich klar. Die Dinge kamen an ihren Platz. Ich betrachtete die beiden Mädchen, die sich wie Kinder aneinanderklammerten. Ich überlegte.
Diese nackte Maja mit den Schenkeln und den Brüsten war Sieglinde. Die Bildhauerin. Die Gelockte neben ihr mit dem knabenhaften Körper war Fine. Eine Ballerina.
Der schnarchende dicke Barockengel neben ihnen war Christoph.
Mein Freund und ein Genie.
Fine und Sieglinde waren Mann und Frau. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, wer der Mann war und wer die Frau. Welche Rolle spielten Christoph und ich in diesem Durcheinander? Hatten wir sie gevögelt? Hatten sie sich gevögelt? Nicht, dass Christoph und ich ... oh, nein! Nein! Nein! Nein!
... Ich hatte Fine wohl eine Festanstellung im Theater versprochen, wenn ... ach, zum Teufel mit Fine!
Ich schlüpfte schnell in Jeans, Pullover und Espadrilles und schlich mich möglichst schnell die baufälligen Stufen aus dem vierten Stock hinunter zur Eingangstür.
Drei Tage später fiel die morgendliche Probe aus, und ich machte mich auf den Weg zu Christoph, um zu sehen, ob sich nicht irgendein gemeinsamer Gig abzeichnete. Der Vorfall hatte keine Spuren in meinem Bewusstsein hinterlassen. Oder zumindest maß ich ihm keine Bedeutung zu.
Ich stieg die vier Stockwerke hinauf und schob die Tür auf, die Christoph nie abschloss. Wie sollte er sie auch abschließen, wenn das Schloss fehlte?
Im kleinen Korridor war niemand. Aus dem Zimmer war ein Singsang zu hören. Ich schaute hinein und sah Sieglinde, die nackt auf der Matratze lag, die Arme unter dem schwanengleichen Hals verschränkt, und ein Kinderlied vor sich hin trällerte.
»Wo ist Christoph?«
»Unten im Bad.«
Das Bad war im Keller installiert, und Christoph ging regelmäßig nackt hinunter, nur mit einem Handtuch bekleidet. Daran war nichts Schlechtes. Das Haus wurde nur von Künstlern bewohnt, die nicht weniger verrückt waren als er.
»Was machst du hier?«
»Ich erfülle meine Pflichten als Frau. Ich habe mich mit Christoph verlobt. Ich liebe ihn.«
»Und Fine? Ihr seid doch Mann und Frau?«
»Fine toleriert unsere Beziehung. Sie respektiert meine Persönlichkeit. Ich liebe auch sie.«
»Du kannst nicht Fines Mann und Christophs Frau sein!«, ich wurde ärgerlich. »Das ist Bigamie!«
»Wo liegt das Problem? Übrigens, du siehst mich lüstern an.«
Ich geriet durcheinander. Natürlich sah ich sie lüstern an. Welcher Mann würde die nackte Maja nicht lüstern ansehen?
»Wenn du Liebe machen willst, dann zieh dich aus und leg dich zu mir.«
»Ich dachte, du liebst Christoph?«
»Du kommst aus Südeuropa und bist primitiv. Wenn du ein Freund von Christoph bist, warum soll ich dir dann nicht einen Gefallen tun? Wo liegt das Problem?«
Christoph kam nackt herein, er schnaubte und verspritzte Wassertropfen.
»Sie schlägt mir vor, mich auszuziehen und mich zu ihr zu legen. Ein Freundschaftsdienst. Was sagst du dazu?«
»Ja, und? Oder gefällt dir meine Verlobte etwa nicht?«, er wurde wütend. »Ist dieser Körper etwa nicht vollkommen?«
»Mein Geist und meine Seele sind noch vollkommener«, erklärte Sieglinde.
»Sie stehen über allem Irdischen. Jetzt sprechen wir von der Verpackung. Also, was ist? Ist sie schön oder nicht?«
»Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das schöne zu nennen, dies konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt fertigbringen!«, suchte ich bei Schopenhauer Hilfe.
»Oh mein Gott, der ist ja wirklich schwul!«, kreischte Sieglinde und spreizte die Beine weit. »Was stimmt nicht mit meinen Hüften?« Sie schüttelte ihre Schultern, und ihre Brüste begannen zu tanzen wie die Konkubinen vom Brocken in der Walpurgisnacht. »Was stimmt nicht mit meinen Schultern?«
»Sieglinde hat recht, Bulgare.« Christoph sah mich aus nächster Nähe mit seinem Porzellanblick an. »In Paris warst du keine Schwuchtel. In Bern mit dieser Schwarzen noch viel weniger. Jetzt bist du plötzlich schwul. Warum? Entweder du legst dich zu uns oder du verschwindest!«
Er warf sich zu Sieglinde auf die Matratze, und die beiden begannen, Liebe zu machen.
... So startete diese wilde, mörderische und verzehrende Geschichte zwischen Christoph und Sieglinde, die ganze fünf Jahre weiterging und ihm die Neurasthenie einbrachte, die Depressionen, die ihn überfielen wie ein Jagdverband, der offenes Gelände bombardiert, die zerfleischende Demütigung und die Devalvation seines enormen Talents.
Christoph fiel aus den Charts. Aus einem der größten europäischen Jazzmusiker wurde ein Konzertveranstalter und zweitklassiger Interpret. Sieglinde war immer mit dabei, wenn Christoph auf Tournee war, und machte ihm schreckliche Szenen für jeden Blick und jedes Autogramm, das er einer Frau gab. Er seinerseits litt wie ein Hund und prügelte sie für jeden kleinen Gefallen, den sie seinen Freunden tat, halb tot.
Von ihrer früheren Aufgeschlossenheit keine Spur mehr. Sie liebten sich, sie hassten sich und waren aufeinander eifersüchtig wie die Störche. Sie verwandelten Hotelzimmer in Schlachtfelder.
Im »Hôtel des Bergues« in Genf hatten sie die Renaissancemöbel zerschlagen, die ein ganzes Vermögen kosteten.
Sie schlugen sich in Palma de Mallorca.
In Thailand.
Im »George V« in Paris.
Sieglinde war so sehr Bildhauerin wie der Wurm ein Drache ist.
Sie porträtierte jahrelang den armen Kopf Christophs in Ton, und dieser Kopf wurde immer widerlicher, immer absurder und unsinniger, bis er sich am Ende in eine Handvoll Dreck verwandelte, den jemand durch die Finger gepresst hatte, er ähnelte einem Kuhfladen, ausgeschissen von einem müden Rindvieh nach Sonnenuntergang im dörflichen Stall.
Dann betrat Kim die Bühne.
Kim war Astrophysiker und Alkoholiker, er hatte den Intellekt des Dalai Lama, die Kenntnisse eines ägyptischen Opferpriesters, die Emotionen einer Makrele und beherrschte sieben oder acht Sprachen, darunter auch Japanisch und Chinesisch.
Kim war in Neuseeland geboren, hatte deutsche Eltern und wuchs in Australien auf. Er hatte in den geheimsten Abteilungen der NASA gearbeitet und Projekte zur Zerstörung von Kometen entwickelt. Und jetzt war er bei uns – den unvollkommenen Clowns vom Prenzlauer Berg – einsam, dünn wie ein Spulwurm, Photosynthese betreibend und an Lungenkrebs im Endstadium leidend.
Christoph verehrte Kim und widmete ihm Kompositionen.
Kim wiederum bewies auf mathematischem Wege, dass Christophs Musik keinen Pfifferling wert war und nicht die geringste Projektion im Universum, der Zeit, dem Raum oder dem Punkt hatte, in dem sie sich krümmen und den Primitivlinge »Zukunft« nennen. Kim unterdrückte ihn gnadenlos.
Auf einmal beschloss Sieglinde, dass sie in Kim verliebt und er der Mann ihres Lebens sei.
Sie schnürte ihr Bündel mit Arbeitskleidung und zog mit all ihrem Ton, ihren Stativen, Spachteln und Gummihandschuhen in das stinkende Loch des dahinscheidenden Kim, nur zwei Querstraßen von der Borodinstraße entfernt.
An diesem Tag wurde Christoph wahnsinnig. Er zog in die Höhle in der Bizetstraße, vernagelte das Fenster mit einer Sperrholzplatte und verbrachte beinahe zwei Wochen in besinnungsloser Trunkenheit, manchmal knabberte er trockene Spaghetti direkt aus der Verpackung. Er wälzte sich über den sich auflösenden Teppich, biss in die Tischbeine, schlug seine Stirn – bumm! bumm! bumm! – gegen die morschen Bretter und heulte vor Schmerz und Befremden.
Christoph verbrachte Monate in Trance, entsetzt und schaudernd, ohne die Möglichkeit oder den Wunsch, den Kontrabass anzurühren.
Dann begann er, Tagebücher zu schreiben, in die er alles an Gift, Gehässigkeit, Ängsten, gedemütigter Liebe und Katastrophenformeln über Leben und Tod hineinlegte.
Das erste Mal verließ er seine Höhle, um den todkranken Kim auf dessen Wunsch hin zu besuchen. Der konnte das Haus nicht mehr verlassen, nicht mehr selbst essen und auch nicht mehr ohne Sauerstoffflasche atmen.
Worüber sie damals sprachen, weiß ich nicht. Christoph war vom Anblick des Sterbenden erschüttert, und ich hörte von ihm kein Wort des Hasses. Kim sei zu einem Gnom zusammengeschrumpft, er wiege keine vierzig Kilo mehr und sei unvorstellbar grau. Er lindere seine unmenschlichen Schmerzen mit Morphintabletten, doch sie würden seinem Körper den Sauerstoff entziehen und ihm das Atmen noch mehr erschweren.
Christoph besuchte Kim dreimal wöchentlich, und aufgrund einer unausgesprochenen Abmachung war Sieglinde bei diesen Treffen nie anwesend.
Einige Wochen später erlosch Kim in schrecklicher Agonie in Christophs Armen.
Als die Sanitäter den Leichnam hinaustrugen, warfen sich Sieglinde und er auf das Totenbett und vögelten einander wild und rasend. Bis zur Bewusstlosigkeit.
Sieglinde verschwand. Nach etwas mehr als einem Jahr hörte man, dass sie in die Psychiatrie gegangen sei, wo übrigens auch ihr Platz war.
So wurde der blauäugige Übermensch Christoph geboren, der mir jetzt gegenübersitzt und sich mit Bier volllaufen lässt.
Er kennt Ina gut, sogar besser, als mir lieb ist. Er versucht, mit mir die Situation zu analysieren, liest mir Auszüge aus seinen Tagebüchern vor, will mir helfen. Er spricht auch einige bemerkenswerte Gedanken aus, wie zum Beispiel den, dass ich in meiner Eigenschaft als Bulgare und Südeuropäer die Neigung habe zu übertreiben, was den Unterschied zwischen Leben und Tod angeht.
Aber Christoph kann mir nicht helfen. Mein Leiden ist nicht wie seines vor zehn Jahren. Christoph litt damals wie eine Buche, wie eine Eiche, wie ein Affenbrotbaum. Mein Leiden ist pervers, zerstörerisch, erniedrigend. Aber – frage ich mich jetzt – leidet eine Kaulquappe wirklich weniger als eine Buche?
Später gehen wir am Ufer des Weißen Sees spazieren, trinken Bier in irgendeiner Kneipe, essen in einer anderen Spaghetti zu Abend. Ich bin todmüde. Zu Christophs Missfallen komme ich nicht mit zu ihm, sondern nehme mir ein Taxi und fahre nach Hause. Ich falle im Bett in Ohnmacht und schlafe einige Stunden wie ein Toter.
Am Morgen erwache ich gegen fünf mit dem Aasfressergedanken: Ina. Ich bleibe bis gegen neun liegen. Ich frage mich, warum ich am Leben bin, wie ich den heutigen Samstag überstehen soll. Das Wochenende ist immer tödlicher als die Werktage.
Ich gehe einkaufen.
Pedantisch bereite ich mir Koteletts mit Erbsen und Salat zu. Pedantisch spüle ich das Geschirr, sammle die Krümel auf, pedantisch putze und poliere ich jede Ecke der verfluchten Wohnung. Ich schalte die Nachrichten ein. Heldenhafte Erfolge der amerikanischen Luftwaffe im Irak. Zwei-, dreihundert von intelligenten Bomben zerrissene, zerfetzte, zermalmte und verbrannte Kinder, Frauen, Alte und Zivilisten.
George Bush junior gibt auf dem Rasen vor dem Weißen Haus eine Erklärung ab.
Tony Blair gibt seine Erklärung in der Downing Street ab.
Ich schalte aufs Satellitenprogramm um. Der bulgarische Außenminister erklärt, dass die Regierung Amerika in seinem gerechten Kampf gegen den Terrorismus unterstützt und dass die bulgarische Armee nach Kerbala aufbricht, um allen Terroristen den Arsch aufzureißen.
Die ganze Zeit über geht mir Ina nicht aus dem Kopf.
Ich gehe ins Erotikmuseum von Beate Uhse. Ich kaufe mir das »Happy Weekend«, ein Magazin für Sexkontakte. Leidenschaftliche. Aber diese Texte und Bilder erinnern mich an sie. Nach einer Stunde haben sich alle Möglichkeiten für Sexkontakte von selbst erübrigt.
Zumindest ist das Wetter schön, draußen sind es fünfundzwanzig Grad. Ich beschließe spazierenzugehen. Aber wohin soll ich gehen? Wieder ins Theater?
Ich rufe in Sofia an und spreche mit der Frau von Svetljo Vox, vermeide aber, das Thema Ina anzusprechen. Sie äußert sich optimistisch zur Lage in Bulgarien. Sie überschüttet mich mit schmeichelhaften Worten über die Regierung von Simeon Sakskoburggotski, so als würde ich ihn sofort nach dem Gespräch anrufen, um ihm mitzuteilen, was Svetljos Frau über ihn denkt.
Stopp!
Aha!
Ina geht es dort also gut, sie erinnert sich überhaupt nicht daran, dass irgendwo in Mitteleuropa ein Idiot vor sich hinvegetiert, dessen Leben sie zerstört hat?
Ich erfahre außerdem, dass Benny der Flötist eine eigene Fernsehsendung bekommt. »Ach, diese Fratzen.«
Aha!
Also wird Ina sich ihren ehemaligen Stecher anschauen und in seiner ganzen künstlichen, aufgeblasenen, ausgedachten, provinziellen Herrlichkeit baden!
Und wo bleibe ich in diesem Tumult und weltlichen Leben? Ein Pünktchen in einer anderen Galaxie, mit bloßem Auge unsichtbar? Ein sich selbst verzehrendes und alkoholisierendes degenerierendes Nichts, für das sich niemand mehr interessiert?
Dort, in Sofia, ist der große Ball.
Dort ist das Leben, dort sind die Kneipen und die Kneipengeschichten, dort sind die Musik, der Rhythmus und der Sex, die Ina so sehr liebt und die die Grundlage ihres ganzen Lebens bilden.
Offensichtlich werde ich verrückt.
Ich weiß, wie sie in allen schwarzen und roten Hüftgürteln mit Strumpfhaltern, in Netzstrümpfen und Reizwäsche aussieht. Ich weiß, wie sie mit dem Finger über ihre Vagina streicht, kenne all ihre professionellen Bewegungen, ihr Stöhnen, ihr Hauchen, ihre Stripshows – ihr ganzes Hurenregister.
Wieso bin ich nach ihren ersten Geständnissen über Gruppensex zu dritt und zu viert, nach ihren lesbischen Geschichten nicht einfach Hals über Kopf geflüchtet, wieso habe ich nicht gesehen, dass ich es mit einem verkrüppelten, seelenlosen und verwüsteten menschlichen Monster zu tun habe, das mich erbarmungslos ausgebeutet hat?
Und warum leide ich jetzt so sehr, wo die Dinge klar und offensichtlich sind und keiner Korrekturen und Präzisierungen mehr bedürfen?
Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich mir sage, dass ich alles stehen- und liegenlassen und arbeiten muss. Zur Musik zurückkehren. Spielen, bis das Instrument birst. Nur darin liegt die Rettung. Nur durch die Musik kann ich sie verletzen, ihr beweisen, auf welch niedrigem Niveau sie sich bewegt, was für ein Nichts sie ist.
Aber ich kann nicht.
Ich habe keine Kraft, keine Lust, kein Bedürfnis und höchstwahrscheinlich auch keine Möglichkeit.
Wie werde ich von jetzt an leben? Ich gehe schließlich auf die fünfzig zu. Was kann mir noch Neues passieren?
Herr, wie wirst du auf all diese Fragen antworten?
... Durch das offene Fenster in der Exarch-Josif-Straße fliegen haarige Pappelsamen herein, und mit langsamen, rotierenden Bewegungen landen sie auf Tisch und Boden.
Es ist neun Uhr morgens, und draußen sind es schon fast dreißig Grad. Ich bin soeben aus einem zweistündigem Schlaf erwacht. Ich fühle mich aufgemischt wie ein Fruchtshake im Mixer, mein Kopf ist öde wie ein Steinbruch im Mondschein. Trotzdem könnte ich Bäume ausreißen und Konzertflügel schleppen.
Ich wende den Kopf und beobachte sie durch halbgeschlossene Lider, wie sie neben mir schläft, eine Hand unter dem Kopf, zwischen deren Fingern die dichten, kupferroten Bäche ihrer Haare fließen.
Ina ist so schön in ihrer schwarzen Reizwäsche. Ich beobachte die sinnlichen Schauer, die durch die ovalen Muskeln ihrer langen, anmutigen Arme gehen, ihre runden, festen Hinterbacken, als gehörten sie zu einer Statue aus Meeresgischt, ihre langen, weißen Beine in den schwarzen Netzstrümpfen und die zärtliche Biegung ihrer violinengleichen Hüfte, eingespannt in einen Hüftgürtel mit Strumpfbändern.
Ein staubiger Sonnenstrahl landet auf ihren halbgeöffneten Lippen, und sie leckt ihn langsam mit der rosa Spitze ihrer Zunge ab. Ich bin auf diesen Strahl eifersüchtig. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich spüre, wie die Erregung erneut wächst.
Ich denke mir, dass ich nach diesen hundertzwanzig Stunden, die wir gemeinsam im Bett in dieser kleinen, gemütlichen Wohnung verbracht haben, fast genauso wenig über sie weiß wie vorher.
Das, was sie mir bruchstückhaft und widerwillig erzählt hat, ist, dass sie vor zweiunddreißig Jahren am Donauufer in der aristokratischen Stadt Ruse geboren wurde. Ihr Vater war ein Kollege – Klarinettist in der örtlichen Philharmonie. Im Unterschied zu mir, der nur das Altsaxophon beherrscht, konnte er all seine Varianten spielen – Tenor, Sopran und Bariton. Er war erst vierzig, als ihm die Parodontose, der Alptraum eines jeden Bläsers, die Vorderzähne kaputtmachte. Er eröffnete eine Reparaturwerkstatt für Holz- und Blechblasinstrumente. Kundschaft hatte er im Überfluss, nur die Musik fehlte ihm schrecklich. Er konnte nicht mehr spielen und noch weniger aus seiner Tochter eine Musikerin von Format machen. Klarinette und besonders Saxophon sind keine Instrumente für Frauen. Sie hatten es mit Klavier probiert, später mit Gitarre, aber Ina verspürte keinerlei Bindung zu diesen Instrumenten.
Dafür vererbte er ihr seine ganze Liebe zum Handwerk und alles, was er über die verschiedenen Stile in der Klassik und im Jazz wusste. Soweit ich es beurteilen konnte, wusste er eine Menge.
Am Ende, ohne je eine Musikschule oder das Konservatorium besucht zu haben, wurde Ina zu einem Vollblutmusiker, der nicht musiziert.
Sie würde einen kompetenten Kritiker abgeben, wenn sie nicht der Meinung wäre (und hier bin ich ganz ihrer Meinung!), dass Kritiker wie unfruchtbare Frauen sind, die zwar wissen, wie man Kinder zur Welt bringt, selbst aber keine gebären können. Über ihre Mutter erfuhr ich nur, dass sie Englischlehrerin war und die Familie und die kleine Ina verließ, als ihr Vater seine Arbeit in der Philharmonie verlor. Sie lebte mit einem Professor in Sofia, und Ina hatte sie fast fünfundzwanzig Jahre lang nicht gesehen.
Mein Flug nach Berlin ging am folgenden Tag, Samstag, um halb sieben abends. Den Audi wollte ich bei Stefan unterstellen, der eine Garage außerhalb der Stadt hatte. Mein Gepäck – ein mittelgroßer Koffer – war noch nicht gepackt, aber ich hatte keine Lust, daran zu denken.
Ich drehte den Kopf und sah erneut aus dem Fenster.
Ina.
Diese Frau zog mich an und saugte mich ein wie ein Schwarzes Loch, aber im Gegensatz zu den Schwarzen Löchern war ihr Inneres strahlend und berauschend. Am folgenden Tag würde ich nach Berlin aufbrechen, doch bis zu jenem Augenblick kein Wort, wann wir uns wiedersehen würden, wie und wo wir uns wiedersehen würden und ob diese seltsame Geschichte überhaupt weitergehen oder nur eine spätsommerliche Episode bleiben würde.
Ina streckte sich und gähnte geräuschvoll.
»Ich habe Hunger«, murmelte sie. »Haben wir was zu essen? Gibt es Kaffee?«
Ich stand auf und öffnete den Kühlschrank. Es war nur ein trockenes Stück Käse übriggeblieben, ein Ei und eine halbe Tomate. Innerhalb von fünf Tagen und Nächten hatten wir all ihre Vorräte vernichtet. Schau an, Kaffee war noch da. Fast ein halbes Paket »Jacobs«.
»Du wirst mich irgendwohin ausführen und füttern müssen, mein Gebieter«, schnurrte Ina. »Die Leute kümmern sich um ihre Haustiere!«
Ich schlug den Kühlschrank zu und warf mich auf sie. Sie kicherte und wälzte sich vom einen Ende des Bettes zum anderen. Ich hielt sie unter mir fest und begann, ihr Kinn, ihren Hals und ihre nackten, warmen Brüste zu küssen. Sie lachte, aus ihrem Hals sprudelten muntere, kristallene Arpeggios wie von einem Xylophon.
Das Telefon auf dem Schränkchen klingelte.
Wir schenkten ihm keine Aufmerksamkeit.
Es klingelte weiter. Wieder und wieder. Am Ende schob sie mich beiseite, hob den Hörer ab und setzte sich aufs Bett.
»Ja? Hallo. Was? ... Wie? ... Mein Gott ... Ja, natürlich ... hier ist er ...«
»Für dich«, flüsterte sie. »Svetljo ...« Ihre Augen waren dunkler geworden, fast violett, und die Pupillen konnte man überhaupt nicht mehr sehen.
Ich weiß nicht, warum, aber während ich die Hand nach dem Hörer ausstreckte, wurde mein Mund trocken, meine Zunge schwoll an und wurde rau wie ein Maisstrunk.
»Hallo«, seine Stimme war heiser. »Es tut mir leid, dass ich so früh ... gestern haben wir dich überall gesucht, aber du warst nicht zu finden. Dann fiel uns ein, dass du bei Ina sein könntest und ...«
»Was ist passiert?«, unterbrach ich ihn. »Gibt es ein Problem?«
»Nein. Eigentlich ... ja. Harry die Buchtel ist gestorben.«
»Was?!«, schrie ich und klammerte mich an den Hörer. »Was redest du da? Wer?«
»Harry. Die Buchtel. Gestern um die Mittagszeit. Auf der Vitinja-Chaussee. Ein Unfall mit dem Jaguar. Noch an Ort und Stelle.«
»Ist das sicher? Mein Gott ... Irrtum ausgeschlossen?«
»Ganz sicher. Benny und ich mussten ihn identifizieren. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Anblick ...« Seine Stimme begann zu zittern. »Die Beerdigung ist morgen Nachmittag«, fuhr er fort, als er sich wieder im Griff hatte. »Heute Abend versammeln sich die Kollegen in der Piano Bar. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ich werde ein Saxophon für dich auftreiben.« Er legte auf.
... Gegen zehn Uhr abends versammelten wir uns, alle alten Kollegen, ihre Frauen, Freundinnen und der engste Freundeskreis in der Piano Bar in der Rakovski-Straße.
Der Leberfleck hatte ein Foto von Harry gefunden, sie hatten es vergrößert und in einen Rahmen mit Trauerflor im linken unteren Eck gesteckt. Jetzt sah uns Harry vom Klavierschemel aus an, von wo aus er uns nur fünf Abende zuvor mit solch lebensfrohen Stücken und brillanten Passagen begeistert hatte.
Auf dem Bild war er ungefähr dreißig, grinsend, mit runden, schelmischen Augen und ohne den Kehlsack eines Pelikans. So wie ich mich immer an ihn erinnern würde.
Das Unglück war um ein Uhr mittags passiert.
(Genau zu dieser Zeit aßen Ina und ich zwischen den Laken Spaghetti Bolognese zu Mittag, wir verteilten sie mit Fingern auf unseren nackten Bäuchen und saugten sie von dort auf, wobei wir zwischendurch lange Schlucke aus der Flasche Merlot nahmen.)
Harry raste mit hundertsechzig Sachen in seinem geliebten Jaguar über die Vitinja-Chaussee in Sofia.
Der Jaguar war sein ganzer Stolz. Modell einundsiebzig, acht Zylinder, grau wie eine Katze, mit eleganten Ledersitzen und einem Armaturenbrett aus Mahagoni. Die Buchtel musste jahrelang zwanzig Stunden täglich in den Bars von Dänemark auf das Klavier einschlagen, um ihn sich leisten zu können.
Er war sternhagelvoll. In der Gerichtsmedizin stellten sie fest, dass er dreieinhalb Promille im Blut hatte. In der ersten Kurve nach dem Tunnel kam ihm ein LKW entgegen. In der Aussage des Fahrers steht, dass er mit den erlaubten fünfzig Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen war. Die Polizei stellte dasselbe fest. Anfangs sah er, wie Harry mit enormer Geschwindigkeit im Zickzack auf ihn zufuhr, und als der unglückliche Mensch auf die Bremse des LKWs trat und anzuhalten versuchte, hielt Harry mit seinem herrlichen Oldtimer genau auf die riesige Maschine zu und bohrte sich frontal in sie hinein. »Als wäre es Absicht gewesen«, wiederholte der Fahrer, der noch mit zwei gebrochenen Rippen und Gehirnerschütterung im Krankenhaus »Pirogov« lag.
Als wäre es Absicht gewesen.
Was wussten wir denn schon über die Buchtel während dieser langen Wanderjahre, in denen er in Dänemark und ganz Europa von Stadt zu Stadt und von Bar zu Bar gezogen war?
Manchmal schickte er seinen Freunden Postkarten, immer mit demselben Motiv – dem Königsschloss in Kopenhagen – und immer mit demselben Text: »Mir geht es gut. Hier ist es super, aber es wird sehr früh dunkel. Ich habe ein neues Engagement, die Kohle stimmt auch. Wann kommst du mich besuchen?«
Ich schickte meinen Freunden ebenfalls solche Karten mit solchen Texten. Ich lud sie ebenfalls zu mir ein. Und trotzdem besuchte ich die Buchtel nicht in Kopenhagen, weil auch bei meinem Engagement die Kohle stimmte. Das verfluchte Geld, das auszugeben du in Deutschland und Dänemark keine Zeit hast, weil morgens die fünfstündige Probe beginnt, du am Nachmittag Soundcheck hast, von fünf bis sieben arrangierst und neue Stücke repetierst, bis zehn bei der Vorstellung bist und von elf bis fünf am Morgen wegen der verdammten Kohle in einer Bar spielst. Denn wenn du es nicht tust, sind hundert gierige schwarze, gelbe und weiße Musikerfratzen bereit, dich zu verdrängen, sich auf deinen Stuhl im Orchester zu setzen, dich von deinem Platz auf dem Podium zu schubsen, dir den Vertrag mit der Plattenfirma mitsamt der Hand abzubeißen, und dir bleibt nur die Unterführung der U-Bahn oder, wenn du besonders gut bist, der Eingang der Deutschen Bank.
Als wäre es Absicht gewesen ...
Wie soll man unter diesen Voraussetzungen eine Frau finden, die verrückt genug ist, dieses höllische Tempo mitzugehen? Kinder mit dir zu haben? Sich mit dir in die prestigeträchtige Liste der Mittelklasse einzutragen?
Die Buchtel hatte keine Klasse, keine Frau, keine Kinder. Er besaß nur diesen Jaguar, der ihn umgebracht hatte, plus einen Haufen Anlagen, Mikrophone, Synthesizer und alle mögliche Technik in Dänemark, mit der jetzt weiß Gott was geschehen würde.
Vielleicht hätte er auf alles pfeifen, nach Sofia zurückkehren und Taxi fahren sollen wie Benny der Flötist?
Oder ein Tonstudio aufmachen wie der Leberfleck, um Turbofolk zu produzieren?
Oder den Jaguar und die Anlagen verkaufen, sich einen Pick-up zulegen, eine Kneipe im Viertel aufmachen und durch die Dörfer fahren, um Fleisch, Eier und Gemüse einzukaufen wie Sergi das Skelett, dieser phänomenale Flügelhornist?
Vielleicht hätte er zurückkommen und Verkäufer bei einer Firma für Pfannen und Töpfe werden sollen, ungefähr so wie Ina?
Oder – am wahrscheinlichsten – sich in den Kneipen mit Bier und Ouzo volllaufen lassen und darauf warten, dass ihn irgendeine Missgeburt mit dickem Hals einlädt, auf dem Geburtstag seiner Mätresse zu spielen, so wie Josi?
Was sind das für perverse Zeiten, zum Teufel, die solche Wahnsinnstalente zu Verfall, Demütigung und im Endeffekt zum Tode verurteilen, während allerlei minderwertige Typen – Könige, Prinzen, Außenminister, Schurken, Diebe, Mörder, selbstherrliche Taugenichtse und vollgefressene Analphabeten, die dem vor Müdigkeit abgestumpften Volk ihre Parolen für ein nichtexistentes Europa vorkrähen – das Sahnehäubchen der Gesellschaft sind?
Als wäre es Absicht gewesen?
Soll die Nacht kommen. Soll sie sich diese Welt holen.
Ina saß in der Ecke des Séparées neben mir, rauchte nervös und nahm viele kleine Schlucke aus ihrem Glas Whisky, der zumindest an diesem Abend keine Fälschung war, weil wir die Getränke selbst mitgebracht hatten.
Sie trug ein strenges, dunkelrotes Kostüm, eine schwarze Seidenbluse mit schlichtem Kragen und schwarze Seidenstrümpfe. Alle warteten darauf, dass der Doyen Stefan aufstand und einige Worte über Harry sagte. Er saß neben seiner Frau, nahm finster einen Schluck von seinem Getränk, und sein Adamsapfel bewegte sich gequält auf und ab. Irgendwann griff er nach den Zigaretten von Dančo dem Posaunisten, aber seine Frau – eine ergraute Heilige, die stoisch vier Jahrzehnte extremen Lebens mit einem Musiker ausgehalten hatte – legte taktisch klug eine Hand auf die Schachtel. Stefan hatte zwei Jahre zuvor einen schweren Infarkt gehabt, und die Ärzte hatten ihm das Trinken, Rauchen und Spielen verboten, was er mit höchster Verachtung und null Aufmerksamkeit aufnahm.
Er seufzte, stand auf und klopfte mit dem Löffel gegen sein Glas. Das Getuschel und die Gespräche hörten auf.
»Jungs, ihr alle seid meine Kinder«, begann er müde. »Bei jedem Typen war ich bei seinem ersten Konzert dabei, weil ich wusste, dass eines Tages aus euch Musiker schlüpfen würden, dass wir Kollegen werden und gemeinsam dort hinaufsteigen würden.« Er nickte in Richtung Podium und dachte nach. Es trat eine Pause ein. »... auf dieses verfluchte Podium«, fuhr Stefan fort, schüttelte den Kopf und eine weiße Locke fiel ihm in die Stirn, »das zum Guten wie zum Bösen nur für uns bestimmt ist. Und weil ihr mich ›Papst‹ nennt, will ich euch sagen, dass es für jeden Vater das Schrecklichste ist ... das Schrecklichste, verdammt noch mal, wenn sein Kind vor ihm diese Welt verlässt. Harry war gut. Als mich die Pumpe im Stich ließ, schickte er mir Medikamente aus Dänemark. Ich habe ihm nie gedankt, weil er mir was gehustet hätte. Jetzt sage ich zu ihm« – er wandte sich zum Porträt der Buchtel um – »danke für die Medikamente, Harry. Danke für jeden Augenblick, den wir gemeinsam in allerlei Löchern gespielt haben. Aber du hättest dich nicht vordrängen sollen. Du bist stur wie ein Bock. Am meisten danke ich dir dafür, dass du den absoluten Ton in dir trugst und ihn zu jeder Zeit und an jedem Ort hörtest. Wir hier wissen, was es bedeutet, den absoluten Ton in sich zu tragen. Er kann eines Tages explodieren und dich zu den Engeln schicken, aber das unterscheidet den Musiker vom tauben Trottel, der überhaupt keinen Ton hört und noch nie Engel gesehen hat ... Wenn Harry jetzt bei ihnen ist, dann gehe ich jede Wette ein, dass er mit ihnen schon eine Band gegründet hat ... Ein Quintett, Sextett, oder vielleicht auch eine Big Band, wenn es dort oben genügend talentierte Engel gibt. Sie spielen, und die Heiligen marschieren. Gott erbarme sich deiner, Harry! Wir, deine Freunde, machen dir jetzt die Vorgruppe. Hör zu, und wenn es dir gefällt, dann komm runter und spiel mit uns.« Stefan leerte einen Teil seines Glases auf den Boden aus, kippte den Rest auf ex und sagte:
»Auf geht’s, Jungs.«
Stefan, Dančo, Sergi, Žoro der Bassist und Naso die Pauke stiegen aufs Podium. Nach gewissem Zögern schloss sich ihnen auch Bojan an, er nahm vorsichtig Harrys Porträt vom Stuhl, küsste es, stellte es auf das Tischchen neben der Bühne und setzte sich hinter die Hammondorgel.
Naso zählte vier Takte mit den Drumsticks ab, Sergi hob das Flügelhorn an, spielte die ersten drei Töne forte, und die anderen stimmten gemeinsam im vierten ein: »Oh, when the saints«.
Sie donnerten los wie sechs von Musik, Hitze und Maisschnaps wild gewordene Neger aus New Orleans, und von der Bühne floss die heiße Lava der Lebensfreude, des schwarzen Leids, der Begeisterung, des Protests, der Exaltation, des Triumphs, der orgiastischen Trauer, der Besessenheit, des Wahnsinns ... die Heiligen marschierten! Sie marschierten! Marschierten in geschlossenen Reihen vor meinen Augen vorbei, ihre Heiligenscheine wackelten unter Nasos Trommelfeuer, und Harry sah uns vom Porträt aus mit seinen fröhlichen Augen an, die gleichsam schrien: »Let’s go, monkeys! Ihr könnt viel mehr!«
Einer nach dem anderen stiegen alle auf die Bühne, um ein Abschiedssolo an Harry zu richten. Die Atmosphäre heizte sich auf, die Augen der Frauen begannen zu funkeln, die Musiker tobten und wurden immer wilder.
Kiro der Barkeeper zündete die Kerzen auf der Theke und auf den Tischen an und löschte die Beleuchtung. Die langen Schatten der auf der Bühne Spielenden und auf der Tanzfläche Tanzenden verstrickten sich auf groteske Weise an den Wänden. Es roch nach Schweiß, Parfüm, Tabakrauch, Ouzo, Gin, Instrumentenfett und Wein.
Irgendwann nickten Benny und Žoro der Kontrabass mir zu, ich solle zu ihnen hinaufsteigen.
Ich befreite mich aus Inas Umarmung, nahm das Saxophon von Stefan, blies zwei, drei Töne, um das Rohrblatt zu testen, und stieg hinauf.
»Das nächste Stück«, verkündete Benny am Mikrophon, »ist eine Einladung an alle, die die Buchtel mochten und die mit irgendetwas musizieren können. Mit dem Kamm, mit dem Mund, mit den Fingern. Jeder, wie er kann. Los geht’s, Naso!«
Die Tanzfläche leerte sich.
Es trat Stille ein.
Im glühendheißen Halbdunkel begann Naso auf der kleinen Trommel einen forschen, abgehackten Sechsachteltakt abzuzählen.
Beim dritten Takt setzte dumpf und geheimnisvoll Žoro der Kontrabassist ein: eine Achtelnote ... Pause ... eine Achtelnote ... Pause ... zwei Achtelnoten ... Pause ...
»Bolero« von Ravel.
Benny beugte sich zum Mikrophon hinüber, setzte die Flöte an die Lippen, und aus ihnen floss jene endlose Melodie, die aus dem Nichts kommt – geheimnisvoll, sinnlich, warm wie eine spanische Nacht, voll unsichtbarer Gefahr und dunkler Leidenschaft, voll zauberhafter Beschwörung und der Vorahnung von etwas, das sich einschleicht, lauert und unwiderruflich ist ... voll trauriger Mahnung und finsterer Feierlichkeit, ein Messer, Nacht und böses Blut! – ein und dieselbe stolze Melodie ohne Modulationen, die von jedem folgenden Instrument feierlich aufgenommen und wiederholt wird, sich immer lauter und immer finsterer hinaufschwingt, der Rhythmus der kleinen Trommel wird immer abgehackter und immer schärfer, bis sich am Ende die Instrumente in einem Forte zusammenfinden, in der zu riesigen Ausmaßen aufgeblasenen Sphäre der Melodie: exaltiert, schaudernd und verdammt ... dann donnern alle gemeinsam im Finale los, in der einzigen unheilvollen Modulation dieses furchterregenden Stücks, in dem Melodie, Rhythmus und Tanz gleichzeitig in den schwarzen Schlund des endlosen Nichts stürzen.
Benny spielte das Thema und machte mir Platz. Ich machte einen Schritt nach vorn, biss ins Mundstück, wartete darauf, dass mir Žoro die zwei Achteltakte auf dem Bass abzählte, und nahm mein Thema im mittleren Register auf: ein warmer und gerundeter Ton, ein ruhiger und langer Luftstrom, eine immer noch weiche Replik auf die Flöte in Mezzoforte.
In diesem Moment stand Ina von ihrem Platz am Ende des Séparées auf und bewegte sich wie unter Narkose, oder als würde sie jemand fernsteuern, in Richtung Tanzfläche.
Sie blieb in der Mitte des Kreises stehen, stemmte die Hände in die Hüften, beugte den Kopf vor und schüttelte ihn.
Ihr Haar ergoss sich auf ihr Gesicht und verdeckte es.
An der Stelle, wo ich zu den Triolen gelangte, die ich in kaum merklich verlangsamtem Tempo spielte, begann sie, sich wie im Traum um die eigene Achse zu drehen und ihr Jackett mit fast unsichtbaren Zuckungen der Schultern auszuziehen, die genau der Stilistik der Triolen entsprachen.
Als ich das Thema beendete, fiel ihr rotes Jackett weich zu Boden.
Sergi stieg auf die Bühne.
Im Saal herrschte so dichtes Schweigen, dass man es wie Teig mit den Händen kneten konnte.
Sergi hob das Flügelhorn an und spielte erneut das Solo der Flöte – mit geschlossenen Augen und einem Ton wie eine Kugel funkensprühenden schwarzen Pechs im Mondschein.
Nach den ersten beiden Takten, sie drehte sich immer noch langsam um sich selbst, knöpfte Ina ihre schwarze Bluse ganz auf und warf den Kopf in den Nacken. Die dichten Wellen ihrer marsroten Haare ergossen sich auf ihre nackten Schultern, und ihre Brüste, die nur zur Hälfte von den schwarzen Körbchen des BHs bedeckt wurden, erstrahlten im weichen, gelblichen Licht der zwei Dutzend Kerzen.
Sergi beendete seinen Part, und Dančo der Posaunist nahm seinen Platz ein.
Während er sanft den Zug der Posaune bewegte, wobei er mein Thema mit krankhafter Leidenschaft wiederholte, fiel Inas Bluse von ihren Schultern und sie nestelte am Reißverschluss ihres Rocks herum.
Ihre Schenkel bewegten sich im Takt der Achtelnoten und der Pausen des Kontrabasses, und wenn das ein Striptease sein sollte, dann war es der seltsamste Striptease, den ich je gesehen hatte ... vor unseren Augen spielte sich eher eine liturgische Pantomime ab, ein tragisch-erotischer Tanz, ganz im Geiste von »Bolero«.
Nur noch mit schwarzem BH, Hüftgürtel, schwarzen Strümpfen und schwarzen hochhackigen Schuhen bekleidet, begann Ina anfangs scheu, später immer nervöser und konvulsivischer ihre Schenkel, ihre Brüste und den unteren Teil ihres Bauchs zu streicheln.
Ihre Schuhe flogen zur Seite davon.
Benny und ich stimmten gemeinsam ins Thema ein, das in seinem Klang und seiner Dynamik immer aggressiver, in seiner Idee immer zermürbender wurde. Ihr BH fiel, und ihre Brüste begannen frei und unersättlich, über der schmalen Taille zu schwingen.
Mein Zwerchfell verkrampfte sich.
Ich wünschte, sie würde das nicht tun.
Gleichzeitig war ich ganz ergriffen von der Tragik ihres Sex-Appeals, ich erkannte, dass diese erotische Darbietung ihr Solo war, ihr letzter Gruß an die Buchtel, ihr Teil des gemeinsamen Musizierens, und dieser Wahnsinnskörper war tatsächlich ihr Instrument, auf dem sie besser spielte als wir alle zusammen.
Als wir »tutti« mit voller Kraft einstimmten und die letzten Takte unserer durchdringenden Melodie entfalteten, stand sie nur noch im Netzslip da und drehte sich mit ausgebreiteten Armen um die eigene Achse, immer schneller und schneller. Und in dem Augenblick, in dem die Modulation unerwartet, grausam und triumphierend explodierte – wir hackten den finalen Akkord ab –, fiel Ina wie ein toter Vogel vor Harrys Porträt zu Boden, die Arme ausgebreitet, die Handflächen nach oben gekehrt und der Körper nur von ihrem Haar bedeckt ...
... Gegen drei Uhr nachts fiel die Tür ihrer Wohnung ins Schloss, und ich ließ mich erschöpft, frustriert und mit allerlei Giften vollgesogen aufs Bett fallen.
»Willst du einen letzten Drink?«, fragte sie lapidar, während sie Jackett, Bluse und Rock auszog.
»Nein. Ja. Ist mir egal.«
»Was soll es sein?«
»Ist mir egal.«
Sie machte sich eine Wolke, mir goss sie ein Glas Ouzo ein und setzte sich aufs Bett. Sie reichte mir das Getränk und eine Schachtel Zigaretten.
Wir zündeten uns eine an und nahmen einen Schluck. Ich schauderte wegen des unverdünnten, süßlichen Getränks, und verschüttete etwas davon aufs Bett.
»Du fühlst dich nicht wohl«, konstatierte Ina ohne jegliches Mitgefühl.
»Nach so einem Abend?«
»Du warst gut.«
»Du auch.«
»Oh, das war noch gar nichts.« Ina lächelte grausam. »Ich habe auch bessere Darbietungen in petto.«
»Noch bessere? Interessant.«
»Interessiert es dich? Trink aus.«
Ich nahm einen riesigen Schluck, und sie spaltete sich vor meinen Augen.
Dann wurde sie wieder eins.
»Ich hatte gehofft, eine deiner virtuosen Darbietungen zu erleben. Das hatte keine Klasse, gerade gut genug für den Rummelplatz. Beherrschst du auch etwas auf Konzertniveau?«
Ina öffnete das Schränkchen neben dem Bett, wühlte ein wenig darin und holte ein Album mit Ledereinband heraus.
»Erinnerst du dich, dass ich dir versprochen hatte, dir einmal zu zeigen, was sich in diesem Schränkchen befindet? Nun, der Moment ist gekommen.«
Mir drehte sich alles: Ich lehnte das Kissen gegen das Kopfteil des Bettes, hob mit einiger Mühe meinen Oberkörper an und schlug das Album auf.
Auf der ersten Seite – Ina in Reizwäsche, mit gespreizten Beinen auf einem Clubsessel.
Auf der zweiten – Ina ganz nackt auf einem Bett mit blauen, glänzenden Laken. Ihre Augen sind geschlossen, sie saugt am Zeigefinger ihrer rechten Hand. Die Finger der linken halten einen Vibrator umschlossen, den sie an ihre Klitoris hält.
Mein Herz machte einen Sprung und setzte kurz aus. Diese Bilder musste ja jemand gemacht haben. Aber wer?
Auf dem dritten – Inas Gesicht, bedeckt mit Sperma.
Sie lächelt einen dicken und langen Penis an (einen echten!), der ihre Lippen berührt.
Es folgten Szenen mit zwei und drei Partnern, eine zügelloser als die andere, eine wilder und extremer als die andere.
Ina in sexueller Trance, Ina an zwei Penissen auf einmal saugend, Ina aufgenommen von hinten mit geöffneten Hinterbacken, auf denen sich sicherlich eine ganze Mannschaft entleert hat. Ich befand mich am Rande des Wahnsinns.
Ina mit weit aufgerissenen Augen und zum Schrei geöffnetem Mund; zwischen ihren Beinen leckt eine nackte Schwarze das Sperma von ihrer Vagina.
Auf dem nächsten – Ina tut dasselbe mit der Schwarzen, in der ich die englische Jazzmusikerin May Jones erkannte.
Auf dem letzten Bild lag Ina mit vier Partnern auf einmal halb auf einem Sofa. Einer von hinten, ein anderer von vorn, sie massierte den Penis des dritten, der in diesem Moment seine Ladung auf ihre Brüste schoss, während sie an dem des vierten saugte.
Das Album fiel neben mich hin.
Ich stand auf, ging in die Toilette und übergab mich, ohne dass es mich kümmerte, ob man es im Zimmer hören würde oder nicht.
Mein Glied stand schmerzhaft vom Körper ab.
Ich ging zurück und steckte es ihr hinein.
Sie nahm es gefügig hin und gab sich alle Mühe, aber ich konnte mich nicht entleeren.
Mein bestes Stück fühlte sich taub an.
»Warte ...«, sagte sie, holte aus dem Schränkchen einen Flakon mit einer zähen, bräunlichen Flüssigkeit hervor und verschmierte sie von der Eichel bis zur Wurzel. Anfangs brannte es, dann war es, als würden mich tausend kleine Nadeln stechen, wovon meine Erektion noch größer wurde, wenn das überhaupt möglich war.
Ina beschmierte ihre Handflächen mit derselben Flüssigkeit, danach ihre Brüste. Sie begann meinen Penis zu kneten und zu flüstern:
»Quält dich, was du gesehen hast?«
»Ja ...«
»Aber gleichzeitig erregt es dich?«
»Ja ...«
»Begreifst du denn nicht, dass das einfach eine Jamsession ist? Musizieren mit Partnern? Geben und Nehmen? Improvisation?«
»Ja ... Nein ...«
»Warum? Wo liegt der Unterschied? Wenn du deine Partner auf der Bühne mit dem Saxophon verrückt machst und ich es mit meinem Körper tue, wo liegt dann der Unterschied? Mein Körper ist mein Instrument! Verstehst du das nicht? Bist du eifersüchtig?«
»Ja ...«
»Aber du hast es doch auch schon getan ... Sag nicht, du hättest es nicht getan!«
»Ja ...«
Sie schob ihn zwischen ihre Brüste, umfasste sie mit den Handflächen und begann, ihn mit ihnen zu massieren.
»Erinnerst du dich, als ich dir sagte ... dass nur ich dir genaue Informationen darüber geben kann ... mit wem ich geschlafen habe und wie es war? Dass das Vergnügen im Detail liegt ... und ganz mir gehört? ... Stell dir vor, wir wären jetzt mit noch zwei oder drei anderen zusammen ... Altsaxophon ... Baritonsaxophon ... Tenor ... sie haben keine Gesichter, nur Instrumente ... stell dir vor, dass der Schlussakkord naht ...«
Der Schlussakkord war kolossal.
Ich schrie, bäumte mich auf und entleerte mich auf ihre Brüste und ihr Gesicht. Sie schluchzte, küsste mein Glied und saugte es aus, bis ich in katatonischem Stupor vornüberfiel.
Früh am Morgen stand ich entkräftet auf, zog mich an, warf einen Blick auf die tief schlafende Ina, es fanden sich immer noch silbrige Spuren meiner angetrockneten Kraft auf ihrer Wange und ihren Brüsten.
Ich ging hinaus.
Der Morgen war frisch und heiter.
Die Vöglein sangen. Ich fühlte mich leer und zerschlagen.
Ich ging nicht zur Beerdigung der Buchtel.
Um halb sieben flog ich nach Berlin ab, ohne jemanden anzurufen.