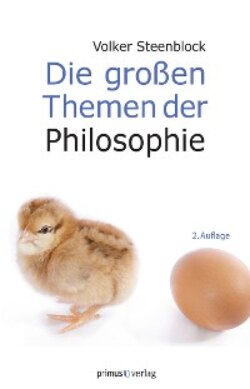Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 Am Anfang war das Wort – Sprachphilosophie
| „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“Joh 1,1 |
Einen grandiosen Text zur Sprache, der zugleich selbst in einem eminenten Sinne sprachlich geformt ist – meditativ und in kreisender Bewegung – stellt der Beginn des Johannesevangeliums dar, das um 100 n. Chr. entstanden ist. Sein Verfasser wählt als Anfang einen Hymnus, der sich hellenistischer „Logospekulation“ zuordnet. Dieser Hymnus verbindet Worte von großer Sprachpräsenz in sich. Das Lied hatte auf der vorchristlichen Stufe „zwei Aussagezentren: die Schöpfungsmittlerschaft und die beständige Heilsmittlerschaft des Logos in der Schöpfung. Die christliche Rezeption […] machte den Inkarnierten [Jesus Christus] zur eigentlichen und endgültigen Offenbarung“.1
Wird im Prolog des Johannesevangeliums der göttliche Logos gefeiert, so wird damit also ein Wort aufgegriffen, das auch für die Philosophie grundlegende Bedeutung hat. Im Griechischen bedeutet „Logos“: „Wort“, „Begriff“, „Argument“, „Beweis“, „Gedanke“, „Rede“, „Vernunft“, „Weltvernunft“. Mit der argumentativen, auf Gründe gestützten Rede (lógon didónai) beginnt jener lange Prozess der ihrer selbst bewussten kulturellen Arbeit von Philosophie und Wissenschaft, in dem menschliche Freiheit und Selbstbestimmung begründet sind.2
Logos, Sprache ist ein grundlegendes Ausdrucksmittel des Menschen. In vielen Alltags- und Lebenssituationen erweist die Sprache sich – wie uns gerade deswegen meist gar nicht auffällt – als ein äußerst funktionsfähiges und höchst differenziertes Medium, so dass ein Nachdenken über die Sprache selbst zurücktritt hinter die vielfältigen Lebenszusammenhänge und Inhalte, in denen und um derentwillen sie gebraucht wird.
Dass die Sprache für die Philosophie besonders wichtig ist, wird metaphorisch deutlich im berühmten Bild von der Sprache als dem „Haus des Seins“ (Heidegger). In der philosophischen Tradition wie in einer gegenwärtigen Reflexion zum Thema „Sprache“ lassen sich zu ihrem Verständnis verschiedene Fragen stellen und (auch mit Hilfe der angegebenen Literatur) diskutieren. So kann man nach der Sprache als Medium des Philosophierens selbst fragen. Das Spektrum reicht hier von Platons Dialogen (als Formen des argumentativen Kampfes um die Wahrheit) bis zur Sprache als normativ in Anspruch genommener, besonderer Form des Philosophierens im Rahmen der zeitgenössischen „Diskurstheorien“, vor allem bei Jürgen Habermas.
Man kann weiter fragen nach der Möglichkeit gelingender Kommunikation angesichts der Sprachenvielfalt und ihrer historischen Wandelbarkeit, nach dem Verhältnis von Sprache und erkennender Vernunft und nach ihrer gemeinschaftsstiftenden bzw. politischen Leistung. Auch wird gefragt, ob nicht „andere“ Redeweisen im Sinne einer „Theorie der Unbegrifflichkeit“ als Korrektiv zur Rationalität des Begriffs denkbar und erforderlich wären. So finden „Mythos“ und „Metapher“ (Hans Blumenberg, 1920–1996) ein erneutes Interesse.
Eine für die Philosophie besonders spannende Frage ist natürlich die nach einem sprachlich-begrifflich „richtigen“ Philosophieren. Besonders im 20. Jahrhundert hat man mit der Sprache in dieser Hinsicht große Hoffnungen verbunden. Nach der antiken und christlichen Metaphysik, nach der klassischen Bewusstseinsphilosophie und nach dem Materialismus naturwissenschaftlicher wie dialektischer Variante steht die Sprachreflexion im Zuge des sogenannten „linguistic turn“ des 20. Jahrhunderts im Zentrum des Denkens einer ganzen geistesgeschichtlichen Epoche. Vor allem die (Sprach-)Analytische Philosophie entwickelt ihre Vorstellung von einer Konstruktion idealer Sprachen bzw. einer therapeutischen Analyse von Normalsprachen. Auf einmal schien es möglich, mittels einer von allen hergebrachten Ungenauigkeiten und alltagsweltlichen Missverständnissen befreiten, streng logisch konstruierten neuen, idealen Sprache die bisher verschleppten philosophischen Probleme nunmehr einer Lösung zuführen zu können, indem manches bislang hin und her gewälzte Problem sich auf Sprachmissverständnisse zurückführen lassen, ein schrittweise konstruiertes Gedankengebäude sich errichten oder sogar eine Ethik sich begründen lassen sollte.
Viel von dieser Methodizität steckt in der Logik, also der Lehre von den Schlüssen, die mit dieser Phase der Sprachphilosophie nicht unverwandt einhergeht und über die Goethe im „Faust“ teuflisch spotten lässt:
„Mein teurer Freund, ich rat Euch drum
Zuerst Collegium Logicum.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt,
Dass er bedächtiger so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn,
Und nicht etwa, die Kreuz und Quer,
Irrlichteliere hin und her.
Dann lehret man Euch manchen Tag,
Dass, was Ihr sonst auf einen Schlag
Getrieben, wie Essen und Trinken frei,
Eins! Zwei! Drei! dazu nötig sei.
Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schießen,
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist Euch, es müsst so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.
Das preisen die Schüler allerorten,
Sind aber keine Weber geworden.
Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.“
Möglicherweise behält diese Skepsis Recht: Nach den hochgespannten Erwartungen an die Sprachphilosophie wird gegenwärtig die Frage wieder weitaus skeptischer beurteilt, ob eine Sprachklärung wirklich als „Universalmethode“ gelten kann, festgefahrenen Debatten in Metaphysik, Ethik und Wissenschaftstheorie zu einer durchgreifenden Klärung zu verhelfen. Es gibt wohl doch nicht „die“, historisch nicht zu differenzierende Sprache – ebenso wenig wie „die“ Philosophie, die sich ihrer bedienen könnte. Wir philosophieren und argumentieren in Kontexten und aus ihnen heraus. Die Hoffnung auf eine problemlösende Kraft purer geschichtsfreier Sprachnormierung könnte sich nicht erfüllen.
Zugleich gilt aber auch: Sprache ist und bleibt das Medium, mit dessen Hilfe wir mehr von der uns umgebenden Kultur verstehen und für uns als Individuen nutzbar machen können. Um unser unbewusstes Empfinden deutlicher fassen, Absichten und Schwierigkeiten begrifflich klarer und trennschärfer formulieren, vielleicht Probleme angemessener lösen zu können, bleiben klare Explizierung und Methodisierung wichtig. Dies gilt auch dann, wenn philosophische Probleme keine sprachlich-logischen Rechenexempel sind. Wir können sozusagen den „Raum“ vergrößern, in dem begriffliche und argumentative Klärungen eine gewisse strukturierende Kraft entfalten und unsere Gedankenmuster „rationalisieren“/„vernünftiger“ zu machen vermögen. Sprache ist damit ein eminenter Zivilisationsfaktor, wie schon der im Anschluss Zum Weiterdenken wiedergegebene Bibeltext deutlich macht. Während in der Naturgeschichte der Informationstransfer zwischen den Generationen weitestgehend genetisch erfolgt, ist er in der menschlich-geschichtlichen Welt sprachlich-symbolisch vermittelt. Jede Sprachreflexion muss darum dem Ziel verpflichtet sein, in Bildungsprozessen ebenso eine je individuelle Orientierung über Sprache zu ermöglichen wie grundsätzlich zum Sprachbewusstsein und zur Sprachkompetenz beizutragen.
Zum Weiterdenken: Materialien, Arbeitsanregungen, Literatur
Sprachreflexion in der Bibel
Ein frühes Zeugnis bewusster Sprachreflexion ist die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel. In sprichwörtlich gewordener Anschaulichkeit deutet sie die Sprachvielfalt als Verlust der Einheit und Erschwernis der menschlichen Kommunikation und schildert diesen Verlust als Strafe für menschliche Hybris.
Der Turmbau zu Babel
Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab, und verwirren wir dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel (Wirrsal), denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt, und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut.
Gen 11,1–9. Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung kommentiert. Kommentierung von Eleonore Beck, Stuttgart 1980.
Arbeitsanregungen
1. Welche Formulierungen im Bibel-Text demonstrieren die Macht der Sprache?
2. Worin wird im Bibel-Text der Zusammenhang von Sprache und Kultur, worin ein Zusammenhang von Sprache und Religion deutlich?
3. Macht der Sprache – Grenzen der Sprache. Lassen sich Beispiele in unserem Leben finden?
4. Welche Vorwürfe erhebt Mephisto in Goethes „Faust“ gegen die Logik?
5. Sprache der Poesie und Literatur – Sprache der Wissenschaft. Vergleichen Sie am Beispiel zweier für Sie greifbarer Texte die Wirkung einer poetischen, phantasievollen, kreativen Sprache (bildhafte Rede, Chiffren, Reim) mit typischen argumentativ-sachlichen Strukturen (Begriffsdefinitionen, logischen Schlüssen usw.). Welche Texte haben Sie (warum? was an ihnen?) eher beeindruckt?
6. Wie empfinden Sie die Sprache(n) der Philosophen?
Literatur
T. Borsche (Hrsg.), Klassiker der Sprachphilosophie. Von Platon bis Noam Chomsky, München (Beck) 1996 (Darstellung wichtiger Sprachphilosophen von Platon bis Heidegger durch namhafte Autoren).
A. Newen, Einführung in die Sprachphilosophie, Darmstadt 2008 (Darstellung aus der Sicht der Analytischen Philosophie).
W. Oelmüller – R. Dölle-Oelmüller – V. Steenblock, Diskurs: Sprache. Paderborn usw. (UTB) 1991 (Einleitung und didaktisch begründete Textauswahl u.a. unter dem Aspekt „Sprache zwischen Wissenschaft und Mythos“).