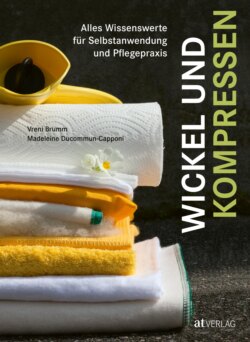Читать книгу Wickel und Kompressen - eBook - Vreni Brumm - Страница 7
ОглавлениеAllgemeines zu Wickeln und Kompressen
Grundlagen
Im Spannungsfeld zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde
Das Wohlbefinden fördern, den Stress abbauen, den Schlaf unterstützen, Schmerzen und gesundheitliche Beschwerden lindern: All dies sind wirkungsvolle Anwendungsmöglichkeiten für Wickel und Kompressen. Dabei gelten diese Maßnahmen als sehr alte und bewährte »Heilmittel«. Bereits in den Schriften des Hippokrates (um 460—370 v. Chr.) sind Anwendungen mit Wasser und Baumwolle oder Öl und Baumwolle zur Linderung von Leiden erwähnt. Damals wie heute werden Wickel und Kompressen sowohl in der Volksheilkunde wie auch als Hausmittel angewendet. Das Wissen beruht auf Erfahrungen, die von Generation zu Generation, in der Regel von Frau zu Frau, weitergegeben wurden. Auch in der Naturheilkunde wurden Wickel und Kompressen seit jeher mit den verschiedensten Zusätzen durch Ärztinnen verabreicht und empfohlen. In der anthroposophischen Medizin sind sie gar ein zentraler Bestandteil vieler Behandlungen. In zahlreichen Therapiezentren, Praxen und Kurhäusern gehören sie heute zu den komplementären Behandlungen. Vor der Entdeckung des Penicillins kamen in den Krankenhäusern Senfwickel als wirksame Therapie bei der Lungenentzündung zum Einsatz.
In der Schulmedizin gehören Wickel und Kompressen heute in einem viel umfassenderen Sinn zu den physikalischen Anwendungen, welche vor allem in der Physiotherapie, immer häufiger aber auch im Pflegebereich genutzt werden. In ausgewiesenen Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie bei der Betreuung zu Hause (Spitex) werden Wickel und Kompressen mittlerweile als eigenständige Pflegemethode von professionell ausgebildeten Wickelfachfrauen und -männern angewendet.
Wickel und Kompressen dienen nicht nur zur Steigerung des Wohlbefindens und zur Unterstützung der körpereigenen Kräfte sowie zur Linderung von Beschwerden. Sie werden im Rahmen der Gesundheitsförderung auch dazu eingesetzt, sich zu entspannen und dem Alltagsstress zu entziehen. Durch gezielte Anwendungen werden die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützt (zum Beispiel bei beginnendem Husten durch Brustkompressen mit Bienenwachslappen). Weiter können Organfunktionen unterstützt werden (etwa die Tätigkeit der Leber durch feuchtheiße Leberkompressen). Wickel und Kompressen können zudem als Begleitung in einem Krankheitsprozess eingesetzt werden (beispielsweise in der professionellen Pflege bei schwerkranken Patienten wie der Palliativpflege). Und schließlich werden Wickel und Kompressen bei gesundheitlichen Störungen wie Erkältungen, Verdauungsbeschwerden oder Muskelverspannungen äußerst vielseitig und erfolgreich angewendet. Das weitaus häufigste Einsatzgebiet von Wickeln und Kompressen ist jedoch die Linderung von Schmerzzuständen, etwa bei rheumatischen Schmerzen und Entzündungen.
Definition
Wickel: Ein Körperteil wie der Fuß, das Bein oder der Arm wird mit einem oder mehreren Tüchern umwickelt. Zur Wirkung gelangen Zusatzstoffe und/oder Temperaturreize (kalt, temperiert, heiß). Das innerste Tuch ist Substanzträger, kann also mit einer Wickellösung getränkt sein.
Kompresse, auch »Auflage« genannt: Auf eine bestimmte Körperpartie (zum Beispiel Bauch oder Brust) wird ein Tuch gelegt. Entsprechend der Auflagestelle erhält die Kompresse ihre spezifische Bezeichnung wie »Bauchkompresse«, »Brustkompresse« und so weiter. Die Kompresse ist Substanzträger, kann also mit einer Wickellösung getränkt sein, oder der Zusatz (zum Beispiel Leinsamen oder Quark) wird darin eingepackt. Ein weiteres Tuch aus Baumwolle schließt die Kompresse ab.
Wickel
Kompresse, auch »Auflage« genannt
Kataplasma, auch »Umschlag« genannt: Angewandt werden Brei- oder Pastenumschläge, zum Beispiel aus Lehm oder Leinsamen.
Wirkung
Die Wirkung von Wickeln, Umschlägen und Kompressen beruht auf einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Im Detail sind viele dieser einzelnen Wirkungsmechanismen wissenschaftlich nicht erklärbar, sie basieren auf Erfahrungswissen. Grundsätzlich können folgende drei Wirkungsfelder unterschieden werden:
Physikalische Wirkung (Temperaturreiz)
Auf einer bestimmten Körperstelle wird eine heiße oder kalte Kompresse aufgelegt. Die Wirkung kann begrenzt sein oder über den ganzen Körper reichen. Die auf der Haut befindlichen Rezeptoren nehmen dabei den Temperaturreiz auf und leiten ihn über die Nervenbahnen weiter. Ausgehend von der Auflagestelle, leiten die Nervenbahnen den Reiz über das Rückenmark zu den inneren Organen. So lindert beispielsweise eine heiße Bauchkompresse die Blähungen, indem die Darmmuskulatur entspannt wird. Informationen zur spezifischen Wirkung der heißen oder der kalten Kompressen sind in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt.
Klaus-Christof Schimmel: Lehrbuch der Naturheilverfahren Band 1, Hippokrates Verlag 1990
Psychosoziale Wirkung (Beziehung zwischen Personen und Umfeld)
Wickelempfängerinnen und -anwenderinnen stehen bei jeder Anwendung im Gespräch miteinander. Dies beginnt bei der Auswahl der Maßnahme, reicht über die Zubereitung, die eigentliche Durchführung bis hin zur Möglichkeit des Nachruhens. Eine Anwendung kann auch an sich selbst durchgeführt und so das eigene Wohlbefinden unterstützt werden. Eingepackt sein in einen Wickel gibt Halt und vermittelt das Gefühl, »umhüllt« zu sein. Ist alles im Einklang, kommen Körper, Seele und Geist zur Ruhe.
Phytopharmakologische Wirkung (Zusatz von Wirkstoffen)
Die Wirkstoffe der Wickelzusätze verhalten sich sehr unterschiedlich. Eine Resorption durch die Haut ist sowohl von den fettlöslichen Pflanzenwirkstoffen wie auch den ätherischen Ölen her möglich. Neben der Aufnahme durch die Haut gelangen die Wirkstoffe durch die Nase zum Zwischenhirn. Die Ausscheidung geschieht über die Nieren, die Haut und die Atmung. Die Wirkung der Pflanzen beruht auf einem Zusammenspiel ihrer unterschiedlichsten Inhaltsstoffe. Informationen zu den einzelnen Wirkstoffen sind in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt.
Wann Wärme – wann Kälte?
• Wärme unterstützt das Wohlbefinden, reduziert Spannungszustände und dient zur Krampflösung. Bei Entzündungen kann, wenn die Möglichkeit zur Sekretion besteht, ebenfalls Wärme angewendet werden (Bronchitis, Blasenentzündung, Stirn-, Kieferhöhlenentzündung). Als »warm« bis »heiß« werden Temperaturen von 36 bis 45 °C definiert (genauere Abstufungen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln, siehe die Definitionen auf Seite 101).
• Temperierte Wärme wird bei chronischen, nichtentzündlichen Schmerzen angewendet, zum Beispiel bei Muskelverspannungen und rheumatischen Beschwerden (28 bis 35°C, siehe Seite 61).
• Kälte dient der Schmerzlinderung bei Sportverletzungen (stumpfe Traumata), Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen sowie bei akuten Hals- und Gelenkschmerzen. Zudem wirkt Kälte entzündungshemmend (zum Beispiel bei akuten Gelenk- und Nervenentzündungen). Bei den Kneippanwendungen wird Kälte zur Anregung des Stoffwechsels und zur Wiedererwärmung (reaktive Hyperämie) eingesetzt. Als »kalt« bezeichnet man Temperaturen von 10 bis 22 °C (siehe Seite 151).
Achtung: Das Wärme- und Kälteempfinden ist bei jedem Menschen anders. Deshalb sind die Temperaturangaben nur ungefähre Richtwerte. Die Empfängerin oder der Empfänger bestimmt die ausgewählte Temperatur, nicht das Thermometer! Besteht Unsicherheit, ob eine heiße Anwendung angezeigt ist, sollte stets ein erster Versuch mit einer temperierten gemacht werden.
Grenzen und Gefahren
Bei akuten medizinischen Problemen, wie beispielsweise bei unklaren Bauchschmerzen, Herzbeschwerden oder akuter Venenentzündung (Phlebitis), muss unbedingt Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin oder entsprechenden Fachpersonal gehalten werden. Vorsicht ist darüber hinaus geboten bei:
• Menschen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit,
• mit Lähmungen, Durchblutungs- und Wahrnehmungsstörungen (Sensibilitätsstörungen),
• Betagten oder geschwächten Personen,
• Menschen mit Demenzerkrankungen,
• Allergikern,
• Personen mit akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
• Kleinkindern und Säuglingen,
• Schwangeren,
• Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung.
Wickel und Kompressen können die unterschiedlichsten Reaktionen hervorrufen. So kann es bei unsachgemäßer Anwendung zu Verbrennungen, zur Verschlimmerung der Symptome, zu allergischen Reaktionen oder zur Unterkühlung kommen. Ebenso können Krankheitsbilder verschleppt oder verfälscht werden.
Kinder und betagte Menschen reagieren auf Anwendungen intensiver und sensibler, deshalb sind milde Zusätze in temperierter Form anzuwenden.
Bei Allergikern sind individuelle Verträglichkeiten zu beachten. Zu empfehlen ist, vorher auf der Innenseite des Unterarms einen Verträglichkeitstest mit dem verwendeten Zusatz zu machen.
Bei akuten Gelenkentzündungen dürfen keine warmen beziehungsweise heißen Anwendungen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall empfiehlt sich der Handtest: Wird die Auflage der warmen Hand als angenehm empfunden, wendet man eine temperierte Kompresse oder einen temperierten Wickel an. Die Verträglichkeit der Kälte kann mit einem Waschlappen geprüft werden.
Grundsätzlich gilt: Bei Verschlechterung der Symptome oder bei Unwohlsein entfernen Sie den Wickel oder die Kompresse sofort. Dies gilt auch dann, wenn die Anwendung zu kalt oder zu heiß ist. Anwendungen mit Wickeln und Kompressen müssen grundsätzlich immer als angenehm empfunden werden!
Dauer und Zeitpunkt einer Anwendung
Grundsätzlich richtet sich die Dauer einer Anwendung nach dem Empfinden der Empfangenden und dem Zweck der Anwendung. Eine heiße Anwendung mit dem Ziel der allgemeinen Wärmezufuhr wird so lange belassen, wie sie als angenehm empfunden wird. Eine kalte Anwendung mit dem Zweck der lokalen Wärmeableitung bleibt so lange auf der betreffenden Stelle liegen, wie sie als kühlend empfunden wird.
Im Tagesverlauf reagiert der Körper verschieden auf die einwirkenden Wärme- oder Kältereize. Physiologisch ist der Körper von 3.00 bis 15.00 Uhr in der »Aufheizphase«. Kältereize werden intensiver empfunden. Von 15.00 bis 3.00 Uhr ist der Körper in der »Entwärmungsphase«. Dann ist genügend Wärme vorhanden, kalte Anwendungen werden als angenehmer empfunden.1
Informationen für Fachleute
In den klassischen Naturheilverfahren werden Wickel und Kompressen der Wärme-/Thermotherapie und der Wassertherapie nach Kneipp allgemein der Hydrotherapie zugeordnet.
Die Wirkungsweise der Wickel und Kompressen wird grundsätzlich über die Beeinflussung der körpereigenen Regulationsmechanismen und somit einer verstärkten Wirkung der Selbstheilungskräfte erklärt. Der thermische Reiz wirkt nervös-reflektorisch über den kutiviszeralen Reflex der Head’schen Zonen. Geruchsimpulse wirken über die Nase und die Siebbeinplatte auf das limbische System und führen weiter über den Hypothalamus zur Ausschüttung von Hormonen. Ein weiterer positiver Effekt ist die Anregung der biografischen Erinnerung, dies im Speziellen bei an Demenz erkrankten Menschen.
Die Reizwirkung resultiert aus der Konstitution der Empfangenden, der Auswahl der Anwendung, dem Temperaturreiz, der Anwendungsdauer und der gewählten Auflagefläche. Bei postoperativen Anwendungen muss Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin genommen werden. In Spitälern, Heimen, Kliniken und in der häuslichen Pflege (Spitex) empfiehlt es sich, für die Umsetzung betriebsinterne Standards zu erarbeiten.
Aus naturheilkundlicher Sicht betrachtet, wirken Wickel und Kompressen über die Haut entgiftend und zielen darauf ab, eine natürliche Ausscheidung zu verstärken. Durch die Anwendung wird zum anderen ein Impuls auf den ganzen Körper gesetzt (zum Beispiel eine Zwiebelkompresse auf den Fußsohlen). Die Reflexzonen stehen in Verbindung mit dem ganzen Körper. Somit kann eine Zwiebelkompresse, auf die Fußsohlen aufgelegt, einen beginnenden grippalen Infekt durch die Anregung der Selbstheilungskräfte reduzieren oder sogar beenden. Andererseits wirken Wickel und Kompressen ableitend auf die Haut, indem sie die lokale Durchblutung fördern und sich anregend auf die Hautatmung auswirken.2
Wärmeregulation
Unser Körper ist auf eine konstante Temperatur angewiesen. Diese beträgt auf der Haut 32 bis 35 °C und im Körperinnern etwa 37 °C. Dadurch wird die Funktion der Stoffwechselvorgänge gewährleistet. Auf Temperaturschwankungen reagiert der Körper sehr sensibel. Entsprechend ist es von Vorteil, die Körpertemperatur möglichst konstant zu halten. Voraussetzung dazu ist das Gleichgewicht zwischen Wärmeproduktion und -abgabe. Diese Regulation bezieht sich auf komplexe Vorgänge innerhalb des Wärmeregulationszentrums im Hypothalamus, einem Abschnitt des Zwischenhirns.
Körpereigene Messfühler als Warm- und Kaltrezeptoren messen konstant die Hauttemperatur, spezifische Messfühler in den Blutgefäßen und im Rückenmark die Bluttemperatur. Über sie wird ein Istwert registriert. Das übergeordnete Wärmeregulationszentrum ist auf einen Sollwert eingestellt. Dieser entspricht einer Ausgangslage von etwa 32 °C auf der Haut und etwa 37 °C im Körperkern. Zeigen Ist- und Sollwert Abweichungen, gleicht der Körper den Temperaturanstieg mit Wärmeabgabe, den Temperaturabstieg mit Wärmeproduktion aus.
Die Wärmeabgabe geschieht überwiegend über die Haut durch Erweiterung der Blutgefäße und somit durch Abstrahlung der Körperwärme. Die intensivste Wärmeabgabe ist das Schwitzen. Dadurch entsteht Verdunstungskälte, die dem Körper weiter Wärme ableitet.
Die Wärmeproduktion wird durch eine erhöhte Stoffwechselfunktion geregelt. Zum Schutz vor weiterer Wärmeabstrahlung verengen sich die Blutgefäße in der Haut. Die »Gänsehaut« zeigt durch das Aufrichten der Haare eine erhöhte Muskelspannung. Durch Kältezittern — eine erhöhte Muskelarbeit — wird die Wärmebildung erhöht. Nach der Nahrungsaufnahme nimmt die Wärmeproduktion dank der Stoffwechselsteigerung zu. Die Leber trägt durch die chemische Umsetzung von Kohlenhydraten und Eiweiß ebenfalls zur Wärmeproduktion bei.
Bei Fieber verändert sich der Sollwert der körpereigenen Temperatur durch die von Krankheitserregern abgegebenen Krankheitsstoffe (Pyrogene). Somit muss der Körper mehr Wärme produzieren. Dies erreicht er wirkungsvoll durch das Muskelzittern (Schüttelfrost). Weitere Informationen siehe unter Wadenwickel auf Seite 161.
Wickelanwendungen können Temperaturreize setzen, die auf den ganzen Körper einwirken und somit die Wärmeregulation beeinflussen. Eine heiße Bauchkompresse kann dabei die Körperkerntemperatur erhöhen, sodass eine gesteigerte Wärmeabgabe durch Schwitzen erfolgt. Kaltanwendungen in der Wickelarbeit zielen dagegen darauf ab, eine lokale Übererwärmung abzuleiten. Durch eine korrekte Anwendung wird die Körperkerntemperatur nicht beeinflusst. Eine großflächige kurze Kälteanwendung, wie zum Beispiel eine kalte Armwaschung (Kneippanwendung), senkt hingegen die Körperkerntemperatur und führt somit zu einer vermehrten Wärmeproduktion.
So werden die Anwendungen zum Erfolgserlebnis
Damit die Anwendung von Wickeln und Kompressen zu einem guten Ergebnis führt, bedarf es vorweg einiger grundsätzlicher Informationen und Abklärungen. Beachten Sie darüber hinaus, dass Wickel und Kompressen sowohl eine Wirkung auf den Körper als auch auf die Psyche haben. Nehmen Sie sich daher genügend Zeit für eine gute Abklärung, Vorbereitung und Durchführung.
Eine Anwendung sollten Sie unter Betreuung und Beobachtung vornehmen, dies im Besonderen bei Kindern und betagten Menschen. Akut medizinische Geschehen sind dagegen grundsätzlich keine Anwendungsgebiete für Wickel und Kompressen. Lediglich nach medizinischer Abklärung und Absprache können sie unterstützend eingesetzt werden.
Stellen Sie sich vor der Anwendung von Wickeln und Kompressen auf jeden Fall die folgenden Fragen:
• Welches Bedürfnis hat die Person?
• Was ist die Ausgangslage, welche Beschwerden sollen mit welchem Ziel gelindert werden?
• Welche Erfahrungen mit Wickeln sind möglicherweise bereits vorhanden, und wie können sie eventuell genutzt werden?
• Welche Temperatur ist sinnvoll: heiß, temperiert oder kalt?
• Mit welchem Zeitaufwand inklusive Nachruhen ist zu rechnen?
• Welche Zusätze und welches Material stehen zur Verfügung beziehungsweise werden benötigt?
• Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?
Jede Anwendung dient einem klar umrissenen Zweck, jeder Wickel und jede Kompresse unterliegt einer festen (und bewährten) Rezeptur. Grundsätzlich aber gilt: Die Bedürfnisse und Vorlieben der Empfänger und Empfängerinnen haben erste Priorität.
Die Dosierungen sind der Größe der Auflagestelle und der Person anzupassen. Hier gilt der Grundsatz: »Milde Reize regen an, große Reize hemmen.« Die Einhaltung der beschriebenen Mengen ist besonders bei den ätherischen Ölen wichtig. Im Umgang mit Kindern und älteren Menschen ist zudem erhöhte Vorsicht geboten. In der professionellen Pflege lassen Sie sich die Mischungen der ätherischen Öle von einer speziell ausgebildeten Fachperson zubereiten.
Die verwendeten Wirkstoffe und/oder Zusätze können ihre Wirkungsweise anders entfalten als bei einer Einnahme. Daher sind in diesem Buch bei der Beschreibung der Zutaten jeweils die Wirkstoffe aufgelistet, die überwiegend bei der äußerlichen Anwendung zum Tragen kommen. Alle Zusätze werden — mit einigen Ausnahmen — nur einmal verwendet und danach entsorgt.
Das A und O einer korrekten Anwendung ist die fachgerechte Durchführung und die angepasste Fixation (Befestigung). Muss ein Zusatz eingepackt werden, ist darauf zu achten, dass immer eine Schicht Stoff zwischen dem Zusatz und der Haut liegt.
Übung macht die Meisterin: Je mehr Anwendungen Sie ausprobiert haben, desto sicherer werden Sie sich bei der Umsetzung fühlen. Besuchen Sie bei Interesse deshalb gegebenenfalls auch Kurse und Weiterbildungsangebote (siehe Anhang).
Wickelmaterial
Tücher/Materialien
Für den Hausgebrauch und die Berufspraxis können verschiedene Wickeltücher verwendet werden:
• Für Erwachsene eignet sich ein Badetuch von etwa 160 × 40 Zentimeter Größe.
• Baumwoll-, zum Beispiel Moltontuch, oder Wolltuch (etwa 200 × 40 Zentimeter).
• Bei Kindern bis zu 10 Jahren verwendet man ein Wolltuch von zirka 80 × 25 Zentimeter Größe oder ein Frotteehandtuch.
Außerdem braucht man folgende Materialien:
• Frotteehandtuch
• Flanellwindel (zirka 80 × 80 Zentimeter)
• Gazewindel (zirka 60 × 60 Zentimeter)
• Gazewindel klein (zirka 30 × 30 Zentimeter)
• Baumwollwaschlappen
• Küchenhandtücher aus Baumwolle und Leinen oder Halbleinen
• Taschentuch aus Baumwolle
• Rohwolle
• Leggings aus Baumwolle
• Strumpfhose aus Wolle
• Stirnband
• Leinen- und Wollsocken
• Leinentuch für Lendenwickel
• Elastische Binde
• Windeleinlagen aus Viskosevlies
• Haushaltspapier
• Baumwollwatte, roh
• Plastikwärm- beziehungsweise Bettflasche
• Klebestreifen
• Plastikbeutel/Mehrzweckbeutel (etwa 20 × 30 Zentimeter)
Informationen für Fachleute
Für die professionelle Umsetzung in der Institution oder der Praxis:
Großes Badetuch oder Moltontuch (zirka 230 ×45 Zentimeter)
• Netzhosen
• Longuetten
• Watte roh
• Elastischer Schlauchverband
• Fixationen (siehe Seite 30)
Wissenswertes
Die Wickeltücher sollten aus Naturfasern wie Baumwolle, Wolle oder Leinen hergestellt sein:
• Leinen nimmt bis zu 35 Prozent Feuchtigkeit auf und gibt diese schnell der Umgebung ab. Sie wirkt kühlend, ist antistatisch und schmutzabweisend. Der Stoff ist strapazierfähig und langlebig, reißfest und extrem unelastisch. Leinenstoff ist waschbar (Kochwäsche, 95 °C).
• Baumwolle kann bis zu 65 Prozent des Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Der nasse Baumwollstoff trocknet sehr langsam. Er gibt die Wärme optimal ab, ist hautfreundlich, aber anfällig für Keimbesiedlung. In feuchtem oder nassem Zustand ist er reißfester als im trockenen. Baumwollstoff ist sehr gut waschbar (Kochwäsche, 95 °C).
• Wolle besteht zu etwa 85 Prozent aus Luft und zeigt ein gutes Wärmehaltevermögen sowie natürliche Thermoregulationseigenschaften. Die Fasern können bis zu 33 Prozent ihres Trockengewichts an Wasser aufnehmen, ohne dass sie sich feucht anfühlen. Wolle leitet zudem die Feuchtigkeit schneller ab als Baumwolle. Sie ist schmutzabweisend und nicht geeignet für häufiges Waschen. Wollstoff ist mit Wollwaschmittel bei 30 °C waschbar, eine Reinigung durch Lüften ist möglich.
Schichten der Wickeltücher
Innentuch
• Material: Baumwolle, Leinen, Windeleinlagen aus Viskosevlies und so weiter.
• Das Innentuch wird direkt auf oder um die entsprechende Körperstelle gelegt.
• Das Tuch wird mit einer Wickellösung, zum Beispiel einem Kräutertee, getränkt. Der Wickelzusatz (zum Beispiel Quark, Leinsamen, Kartoffeln) wird in Form eines Päckchens eingepackt.
Zwischentuch
• Material: Baumwolle, Watte, Rohwolle, Leggings und so weiter.
• Das Zwischentuch wird auf oder um das Innentuch gelegt, dient zur Grobfixation oder nimmt Feuchtigkeit vom Innentuch auf. Weiter dient es als Wärmeisolation, zum Beispiel mit der Rohwolle.
Außentuch
• Material: Baumwolle, Wolle, elastische Binde.
• Das Außentuch dient zur Wärmehaltung und zur Schlussfixation einer Anwendung.
Päckchen
Der Wickelzusatz, wie zum Beispiel Leinsamen, wird in die Mitte einer Windeleinlage aus Viskosevlies gegeben. Die vier Seiten werden umgelegt, sodass daraus ein Päckchen entsteht. Dieses wird mit einer Schicht zwischen Wickelzusatz und Haut auf die entsprechende Stelle aufgelegt.
Informationen für Fachleute
In der Berufspraxis werden nur zwei Schichten verwendet. Das Innentuch, zum Beispiel die feuchtheiße Kompresse, wird mit einem Moltonstoff in der Größe von etwa 230 × 45 Zentimetern aus Baumwolle oder einem flauschigen Baumwolltuch fixiert. Wollstoffe werden aus hygienischen Gründen nicht empfohlen.
Wickelzusätze
Nahrungsmittel/Gewürze (Auswahl)
• Ingwer
• Kartoffeln
• Kohl
• Meerrettich
• Meersalz
• Olivenöl
• Quark
• Weizenkleie
• Zitronen
• Zwiebeln
Heilpflanzen getrocknet (Auswahl)
• Augentrost
• Heublumen
• Kamille
• Lavendel
• Schafgarbe
• Thymian
Weitere Zusätze (Auswahl)
• Algenpulver
• Ätherische Öle
• Bademilch
• Bienenwachslappen
• Bockshornklee
• Extrakte, zum Beispiel Heublumenextrakt
• Fango
• Fertigmischungen ätherischer Öle
• Fette Öle wie Mandelöl
• Heilpflanzensalben
• Heusack
• Hydrolate
• Lehm
• Leinsamen
• Ölauszüge (Mazerate), zum Beispiel Johanniskrautöl
• Senfmehl
• Tinkturen, zum Beispiel Arnika- oder Wallwurztinktur
Fixationen
Die Fixation (vom lateinischen fixare für »befestigen, festlegen«) beeinflusst wesentlich den Erfolg einer Anwendung! Eine korrekt angepasste Fixation ermöglicht den optimalen Kontakt zwischen Wickelzusatz und der Auflagestelle. Bei heißen Anwendungen ist dadurch die Wärmehaltung gewährleistet.
Fixationen sind entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Person und der Auflagestelle zu wählen. Die Bewegungsfreiheit sollte erhalten bleiben. Fest, aber nicht zu fest und faltenfrei ist beispielsweise eine optimale Fixation für eine Bauch- oder Lendenkompresse. Sicherheitsnadeln sind nicht zu empfehlen, zum Abschluss einer Halskompresse etwa ist ein Klebeband geeignet.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Beispielen für Fixationen und ihre Anwendungsbereiche.
Brustfixation
• Bienenwachskompresse
• Brustkompresse mit Zitrone
• Feuchtheiße Kompresse
• Ingwerkompresse
• Johanniskrautölkompresse
• Kartoffelkompresse
• Leinsamenkompresse
• Olivenölkompresse
• Ölkompressen mit ätherischen Ölen
• Rohwollekissen
• Salbenkompresse
• Senfmehlkompresse
• Thymian-Brustkompresse
• Weizenkleiekompresse
• Zwiebelkompresse
Schulter-Nacken-Fixation im Sitzen
• Fangokompresse
• Ingwerkompresse
• Johanniskrautölkompresse
• Kartoffelkompresse
• Olivenölkompresse
• Rohwollekompresse
• Weizenkleiekompresse
Schulter-Nacken-Fixation im Liegen
• Feuchtheiße Kompresse
• Heublumenkompresse/Heusack
• Kartoffelkompresse
Halsfixation
• Lehmkompresse
• Quarkkompresse
• Zitronenkompresse
• Zwiebelkompresse
Gelenkfixation
• Arnikawickel
• Bockshornkleekompresse
• Kohlwickel und -kompresse
• Lehmkompresse
• Quarkkompresse
• Solewickel und -kompresse
• Wallwurzwickel und -kompresse
Bauch-/Lendenfixation
• Dampfkompresse
• Feuchtheiße Kompresse
• Johanniskrautölkompresse
• Kamille-Bauchkompresse
• Lenden-Kartoffelkompresse
• Schafgarben-Leberkompresse
Ohrenfixation
• Rohwollekissen
• Zwiebelkompresse
Wadenwickel
1 Wolfgang Brüggemann (Hg.): Kneipp-Therapie. Ein bewährtes Naturheilverfahren, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1980
2 Michael Schünemann: Ableiten, ausleiten, entgiften. Konzepte der traditionellen Naturheilkunde, Foitzick Verlag, Augsburg 2006