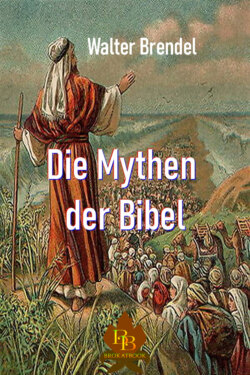Читать книгу Die Mythen der Bibel - Walter Brendel - Страница 5
In göttlicher Mission
Оглавление3000 Jahre Weltgeschichte zwischen Glaube, Mysterien, Liebe, Hoffnung, und Wissenschaft – Religion soll seit jeher eines: Halt geben. Woran sich der Mensch bindet, kann unterschiedlicher Natur sein; die Palette reicht von Götter- und Gottesvorstellungen über politische Weltbilder und zwischenmenschliche Beziehungen bis zum Kult und Materielles. Gibt es überhaupt jemanden, der an gar nichts glaubt? Ohne diesen Nihilismus gleich wieder zur Religion zu erheben? Das mag sich alles recht philosophisch anhören, daher ist es uns ein Anliegen, die Welt des Übernatürlichen greifbar zu machen: 3000 Jahre Geschichte ziehen in diesen Buch an uns vorüber, eine spannende Gratwanderung zwischen Theologie, Naturwissenschaft und übersinnlichen Phänomenen, ohne die keine Religion auszukommen scheint. Propheten, Wunder und Dämonen – wo kein Licht, da keine Dunkelheit. Wir pilgern nach Lourdes und durch das Alte Testament, wir zeigen was hinter Marienkult und der blutigen Stigmata an Fragwürdigen steckt. Aufschlussreiche Informationen in Zeiten, in den die Suche nach Gott boomt.
Begleiten Sie uns, verehrte Leserinnen und Leser auf diesem Weg. Lernen Sie die Legenden kennen und die Meinung der Wissenschaft. Wir wollen die Welt des Wissens um neue, faszinierende Perspektiven erläutern.
Der Begriff „Gott“ kommt aus dem althochdeutschen Begriff „ got: anrufen“, höchstes Wesen. Im Monotheismus ist Gott der Schöpfer der Welt, dem die Attribute Unendlichkeit, Unveränderlichkeit, Ewigkeit, Güte, Wissen (Allwissenheit) und Macht (Omnipotenz) zugeschrieben werden (Schöpfung). In vielen Religionen werden Gott menschliche Gefühle und Charaktereigenschaften zugesprochen wie Willen, Liebe, Zorn und Vergebung (Anthropomorphismus).
Der französische Philosoph, Mathematiker und Physiker Blaise Pascal (1623-1662) vertrat die Ansicht, dass der Mensch nur mit Hilfe der intuitiven Logik des Herzens (Logique du coeur) dazu in der Lage sei, Gott zu erfassen.
Blaise Pascal stellte den „Gott der Philosophen” als bloße abstrakte Idee dem „Gott des Glaubens” als einer erfahrbaren, lebendigen Realität gegenüber. Nikolaus von Kues war der Überzeugung, dass Gott nur durch mystische Vereinigung erfasst werden könnte und betonte das „Zusammenfallen der Gegensätze” in Gott.
Søren Kierkegaard verstand Gott als „Paradoxon”. Der Theologe Paul Tillich bezeichnete Gott als „Seinsgrund” und als „das, was uns unmittelbar angeht”. Gott wird einerseits als transzendent (übersinnlich) betrachtet, wobei sein Anderssein, seine Unabhängigkeit von der Weltordnung und seine Macht über die Weltordnung betont werden. Andererseits wird er als immanent angesehen, d. h. er ist in der Welt gegenwärtig und greift in das Weltgeschehen ein (siehe Theismus, Deismus). Während die monotheistischen Religionen Gott als den Einen verehren, als das höchste Wesen, das alle Dinge umfasst, geht der Polytheismus von einer Vielzahl verschiedener Götter aus.
Das Judentum, das Christentum und der Islam, die auf die Tradition des Alten Testaments zurückgehen, glauben an den einen personalen und transzendenten Gott.
Michelangelo: Die Erschaffung Adams Michelangelo malte seine Erschaffung Adams 1510. Sie ist Teil seiner Ausschmückung der Sixtinischen Kapelle
Im Alten Testament ist die Welt nicht die Emanation Gottes, sondern das Produkt seines Willens. Da Gott nicht erfasst werden kann, ist es verboten, sich ein gegenständliches Bild von ihm zu machen. Obwohl Gott nicht der Welt angehört, trägt er menschliche Züge: Er macht Versprechungen und spricht Drohungen aus, er empfindet Zorn und sogar Eifersucht. Als seine wesentlichen Merkmale werden jedoch Gerechtigkeit, Gnade, Wahrheit und Beständigkeit angesehen, wobei er metaphorisch als König, Richter und Hirte bezeichnet wird. Darüber hinaus ist Jahwe ein lebendiger Gott, dessen Einzigartigkeit in dem Gebot „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!” zum Ausdruck kommt.
Der Gott, zu dem Jesus betete, war der Gott des Alten Testaments. Während seines Lebens wurde Jesus vermutlich als heiliger Mann angesehen, aber bereits im 1. Jahrhundert erhoben ihn die Christen in die göttliche Sphäre. Da dies zu Spannungen mit der jüdischen monotheistischen Tradition führte, entstand die Lehre vom dreieinigen Gott, der Trinität. Der Gott des Alten Testaments wurde für die Christen der Vater, während Jesus selbst, der Christus, als der fleischgewordene Sohn bzw. als das fleischgewordene Wort (Logos) gesehen wurde, als die Manifestation Gottes innerhalb der endlichen Ordnung. Der Heilige Geist, der seinen Ursprung nach der westlichen Kirche in Vater und Sohn hat, für die Ostkirche jedoch nur im Vater (siehe Filioque), ist die immanente Präsenz und Tätigkeit Gottes in der Schöpfung. Die christliche Theologie spricht zwar von den drei „Personen” der Dreieinigkeit, bezeichnet damit jedoch die drei Seinsarten des einen Gottes.
Von den drei auf dem Alten Testament basierenden Religionen ist der Monotheismus im Islam am stärksten ausgeprägt. Wie den Juden so ist es auch den Muslimen verboten, Gott in irgendeiner Form abzubilden. Die zentrale Aussage des Islam lautet: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.” Allah besitzt sieben elementare Attribute: Leben, Wissen, Macht, Wille, Gehörsinn, Gesichtssinn und Sprache, wobei die letzten drei nicht in anthropomorphem Sinne zu verstehen sind.
Sein Wille ist absolut, und alles, was geschieht, ist durch ihn vorherbestimmt. „Im Anfang war das Wort“, heißt es im Johannesevangelium, „und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Der Glaube ist so alt wie Sprache und Verstand. Ist Religion also ein angeborenes Streben nach Erkenntnis?
Bei den alten Griechen war alles noch übersichtlich: Im Himmel saßen Götter mit menschlichen Eigenschaften, die zur Jagd und manchmal mit verheirateten Damen fremd gingen, die sich liebten und hasten, von schönen, manchmal auch hässlichem Aussehen waren. Die Unsterblichen wohnten dem Olymp, dem höchsten Berg Griechenlands, waren verantwortlich für Böses und Gutes, das sich auf der Erde ereignete, für Blitz und Donner, aber auch für fruchtbaren Boden. Und die Sterblichen auf der Erde konnten sich in ihnen wiedererkennen.
Heule kümmert sich auf unserem Planeten ein einziger Gott um mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung - seien es Christen, Moslems oder Juden. Dieser „Gott“ (Christentum), „Allah“ (Islam) oder „Jahwe“ (Judentum) ist allwissend, weise und gütig, kann aber auch zornig werden, wenn der Mensch noch andere Gottheiten verehrt oder seine Gebote missachtet. Er ist ein „eifersüchtiger Gott“, wie er von sich im Zweiten Gebot sagt. Er hat die Welt erschaffen, die Natur, die Tiere und den Menschen.
Doch dieser Gott ist unsichtbar, er hat keine Gestalt und keinen Wohnsitz. Ob er, wie der griechische Göttervater Zeus, Sturmfluten und Sonnenschein erzeugt. Glück und Elend über die Menschen bringt, weiß man nicht so recht. Man muss dennoch an ihn glauben, denn Gott existiert in den Köpfen vieler Gläubiger.
Göttervater: Auf dem Gemälde "Jupiter und Thetis“ (1811, von Jean-Auguste-Dominique Ingres) bittet die Meeresnymphe Thetis den obersten Gott um Waffen für ihren Sohn Achilles - der sterbliche Halbgott spielt in der griechischen Mythologie eine entscheidende Rolle im Trojanischen Krieg. Nach der Eroberung Griechenlands durch die Römer übernahmen diese viele Elemente der antiken hellenischen Kultur - so betrachtete man den römischen Jupiter als identisch mit dem griechischen Zeus
Seit der Mensch existiert, beschäftigen ihn diese grundlegenden Fragen: Woher komme ich, wohin gehe ich, gibt es ein Paradies, gibt es eine Hölle? Was geschieht nach dem Tod? Gibt es ein Weilerleben danach? Hat der Mensch eine Seele? Diese Fragen verunsichern und ängstigen. Der Mensch sucht deshalb nach einem Halt, nach jemandem, der ihm Erklärungen bietet. Hier setzt die Religion an - ob christlich, jüdisch, islamisch, hinduistisch, buddhistisch oder konfuzianisch.
Generationen von Naturwissenschaftlern, Philosophen und Theologen haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Seit Charles Darwin (1809 - 1882) seine Evolutionstheorie aufstellte, scheint zumindest die Herkunft des Menschen geklärt: Er ist ein naher Verwandter des Affen. Der Religionswissenschaftler Peter Antes zieht ein Resümee:
Gottvater: Dem Alten Testament zufolge gibt es nur noch einen Gott, der die Welt und die Menschen wie ein Handwerker nach seinem Bilde schuf und diesen dann Leben einhauchte. Das Bild zeigt „Die Erschaffung Adams“ (1511/12) von Michelangelo Buonarroti - Ausschnitt aus einem Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan
„Die Wissenschaft hat den Menschen vom Gefühl der Angst und des Ausgeliefertseins befreit, und der Glaube an etwas Höheres scheint für viele in Mitteleuropa erloschen zu sein (...}. Religion und die Hinwendung zu Gott beschränken sich somit (...) auf Grenzsituationen des menschlichen Daseins, auf Situationen von unheilbarer Krankheit. Todesnähe oder Tod sowie auf Naturkatastrophen, schwere Unfälle oder Verbrechen, die den Menschen die Sprache verschlagen. In solchen Fällen bieten oft Religionen ihre Dienste an.“
Mittlerweile haben sich auch Hirnforscher der Sache angenommen: Vielleicht kann man ja eine biologische Erklärung für das Phänomen „Glauben“ finden. Der gebürtige Inder und Neurologe Vilayanur Ramachandran, der an der University of California lehrt, ist sicher, ein „Gottesmodul“ im menschlichen Gehirn gefunden zu haben. Beim Meditieren, das scheint erwiesen, werden bestimmte Bereiche der Schläfenlappen im Gehirn stärker als üblich aktiviert. Das Überraschende: Die Wissenschaftler stellten diese Hyperaktivität sowohl bei buddhistischen Mönchen als auch bei katholischen Nonnen fest, wenn sie meditierten oder beteten.
Ramachandran hat auch herausgefunden, dass in Momenten der Meditation oder des intensiven Betens die Gehirnfunktionen jenen ähneln, die ein Epileptiker bei einem Anfall hat. Viele derart Erkrankte sprechen von “Visionen“ die sie „gesehen“ und empfunden haben. Dies wäre auch eine Erklärung dafür, warum manchen Gläubigen die Muttergottes erschienen ist oder Heilige zu ihnen gesprochen haben. Und wenn jemand „im Gebet versunken“ ist so befindet er sich wohl in einem tranceähnlichen Zustand.
Martin Urban legt die Erkenntnisse der Forscher so aus: „Unser Weltbild hat also sehr viel mit den natürlichen Funktionen unseres Gehirns .zu tun. Denn im Menschen ist beides angelegt, sowohl das Bedürfnis zu beobachten als auch das Bedürfnis zu interpretieren. Beides gilt sowohl für den Blick nach außen wie für den nach innen. Der Mensch will die Welt verstehen und sich selbst (...). Er sucht also Antworten auf die Frage nach dem Warum und damit nach dem Sinn seines Lebens.“
Lebenslust: In einem fantastischen Götterhimmel schwelgen die „obersten Zehntausend“ bei reichlich Speis und Trank in ihrem antiken Paradies. So stellte sich zumindest der Maler Giulio Romano um 1532 das "Bankett der Götter“ vor (Fresko im Palazzo del Te in Mantua). Für die alten Griechen hatten die Unsterblichen oft sehr menschliche Eigenschaften; sie konnten so zornig, eifersüchtig, missgünstig, aber auch liebend und mildtätig sein wie ihre sterblichen Spiegelbilder auf Erden. Die Götter wohnten auf dem Olymp und waren für Glück und Unglück der Menschen verantwortlich
Während bei Ägyptern, Griechen und Römern noch viele Götter für alles zuständig waren, was an guten wie schlechten Dingen passierte, ist es erstmals bei der Religion der Israeliten und später der Juden nur ein Gott. Diese Glaubensausrichtung geht auch auf das Christentum und den Islam über. Neu ist die „Erfindung“ der Israeliten allerdings nicht: In ihrer Religion finden sich Elemente, die wohl aus Ägypten und Persien stammen. Unter Pharao Echnaton (1353 - 1336 v.Chr.) entstand zum Beispiel am Nil ein kurzlebiger Ein-Licht-Gott-Kult, und in Persien predigte Zarathusura (um 630 – 553 v. Chr.) eine stark monotheistisch geprägte Religion. Diese Ein-Goll-Religion mache das Glauben noch schwieriger, ja komplizierter. Der „Herr“, der nicht fassbar ist, macht Dinge, die gut, aber oft auch böse sind. Da er der einzige Gott ist, gibt es außer den Christen nur noch Heiden: der Islam unterscheidet zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Noch heute meinen viele Christen, die Nicht-Christen bekehren zu müssen - wobei oft die indigene Kultur der „Heiden“ auf der Strecke bleibt.
Manchmal, so scheint es, kann man an Gott verzweifeln oder ihn in Frage stellen. Denn er verlangt viel von seinen Gläubigen. "Der Priester“, schrieb der Atheist und Philosoph Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), „herrscht durch die Erfindung der Sünde.“
Dazu hat der Gott der katholischen Kirche ein Sündenregister parat:
Es gibt schwere Vergehen (Todsünde) und leichtere (lässliche Sünde). Bei den Ersteren droht dem Verstorbenen die Hölle, wo man, so die Vorstellung im Mittelalter, unsäglichen Qualen ausgesetzt ist. Die "lässlichen Sünden“ muss der Katholik im „Fegefeuer“ büßen. Ähnliches kennt auch der Protestantismus. Alle Sünden können aber schon im irdischen Leben vergeben werden - heute geschieht das durch die Beichte beim Geistlichen. Doch das war nicht immer so: Den Erlass der Sündenstrafen konnte der Sündige lange Zeit auch durch die Zahlung von Geld erlangen. Der besonders in der Renaissancezeit ausgeprägte Ablasshandel (zur Finanzierung des Neubaus der Peterskirche in Rom) führte letztlich zur Reformation.
Das Sündenverständnis hat auch mit Sexualität zu tun, glauben die Wissenschaftler herausgefunden zu haben. Dazu Martin Urban: „Das Christentum hat wie das Judentum (...) und der Islam die orientalisch-patriarchalische Gesellschaftsstruktur übernommen, und dies, obwohl es in der christlichen Urgemeinde zunächst anders aussah und Jesus selbst die Vorurteile seiner Zeit gegen Frauen nicht hegte. Das Herrschaftsinstrument „Sünde“, mit dem die Gläubigen in Angst gehalten werden sollen, wird deshalb in den monotheistischen Religionen bis heute vorzugsweise von Männern und auf die Sexualität bezogen definiert.“
Festzustellen bleibt, dass die katholische Kirche ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat. Da gibt es einmal die Lehre von Maria, die als Jungfrau ihren Sohn empfangen und geboren hat. Das muss man als Katholik glauben, ob einem das als absurd erscheint oder nicht. 1854 legte dies Papst Pius IX. in einem Dogma fest. Dogmen sind in der katholischen Kirche unumstößliche Glaubensgrundsätze. 1870 beschloss derselbe Papst in einem weiteren Dogma die Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er in höchster Lehrgewalt spricht und entscheidet.
Christophorus mit dem Jesuskind auf der Schulter ist der Schutzheilige der Reisenden (Mitteltafel eines Triptychons von Hans Memling, 1484). Die Heiligenverehrung ist im Volk beliebt
Und dann gibt es noch die Heiligen, die Mittler und Fürsprecher hei Gott sein sollen. Der Islam kennt Märtyrer, denen die Aufnahme in das Paradies garantiert ist. In der katholischen Religion gibt es lausende von Märtyrern, Heiligen und Seligen, sie alle hüben entweder Wunder vollbracht oder sich für ihren Glauben geopfert. Viele von ihnen sind für irdische Probleme zuständig: Christophorus beschützt die Reisenden und die Autofahrer, Florian soll Brandkatastrophen verhindern. Hubertus ist der Heilige der Jäger, und Nepomuk kümmert sich um die Brücken. Papst Johannes Paul II.
der medienbewusste Prediger aus Polen, hat allein in seiner Amtszeit 482 irdische Frauen und Männer zu Heiligen erhoben - so viele wie noch kein Pontifex vor ihm.
Wer einmal im bayerischen Wallfahrtsort Altötting gewesen ist und dort all die weggeworfenen Krücken, Prothesen und Votivtafeln bestaunt hat - auf Letzteren wird oft in einfacher, fast kindlicher Sprache beschrieben, wie sieh das „Wunder" der Heilung ereignete, kommt unweigerlich ins Grübeln. Warum lässt Gott Nebengeschäfte zu, bei denen geweihtes Wasser, Amulette und Muttergottesfiguren an die Gläubigen verkauft werden und für einen guten Umsatz ähnlich dem Ablasshandel sorgen? Warum hat er seinen Sohn Jesus nicht erneut zum Ausmisten dieses Tempels geschickt?
Reliquien werden verehrt, Bruchstücke von Knochen oft, Fetzen von Tüchern, Teile von Holzkreuzen, an denen Märtyrer starben - gibt es also neben dem christlichen Gott noch andere Personen und Dinge, die man verehren kann? Götzen etwa im Sinne der Bibel?
Jungfrau Maria, der Heilige Geist, das Paradies, die Hölle, die Sünden, die Auferstehung, Heilige - der gläubige Katholik scheint viel Geisteskraft und Fantasie zu benötigen, um all das auf einen (irdischen) Nenner zu bringen. Glauben, ohne etwas beweisen zu können, ist das Grundprinzip der Ein-Gott-Religionen. Das ist wie mit dem „Urknall“, der das Universum, so erklären es uns die Astrophysiker, hat entgehen lassen. Viele glauben daran, ohne die Zusammenhange überhaupt verstehen zu können. Warum soll man also nicht auch glauben, dass ein Gott in sieben Tagen unsere Erde geschaffen hat?
Der protestantische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, er wurde noch kurz vor Kriegsende am 9 April 1945 im KZ Flossenburg von den Nazis ermordet, schrieb in einem Brief aus dem Gefängnis: „Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis (manchmal schon aus Denkfaulheit) zu Ende ist oder wenn menschliche Kräfte versagen - es ist eigentlich immer der Deus ex machina, den sie aufmarschieren lassen, entweder zur Scheinlösung unlösbarer Probleme oder als Kraft bei menschliche tu Versagen ...“
Gott also als Problemlöser für alles. Sollten Sie aber einmal mit der Problemlösung von Gott nicht einverstanden sein und wollen ihn verklagen, dann denken Sie daran, dass er keine ladefähige Anschrift besitzt.