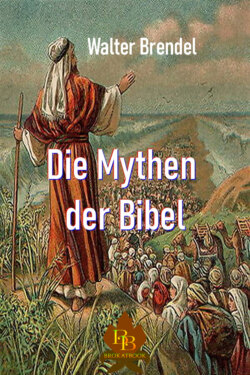Читать книгу Die Mythen der Bibel - Walter Brendel - Страница 7
Das Rätsel um die Wundmale Christi
ОглавлениеUnter dem Titel „Vier Jahre Nulldiät“ beschreibt ein Artikel des Wochenmagazins „Der Spiegel“ im Juli 2008 ein mittelalterlich anmutendes Szenario: Es handelt sich um den Fall einer Berliner Architektin, die in der Karwoche 2004 die Wundmale Christi empfangen haben will. Eine Anhängerin der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners, die im Namen Jesu aus Händen und Füßen blutet und seit ihrer Verwandlung angeblich keinen Bissen mehr gegessen hat. Eine weltgewandte Frau Anfang dreißig, die von sonderbaren Sinneswahrnehmungen und visionären Zeitreisen auf den Berg Golgatha berichtet.
Der Fall der blutenden Steiner-Jüngerin aus jüdischer Familie entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ebenso atypische wie mustergültige Wiederbelebung einer uralten Vorlage. Stigmata (griechisch: Zeichen) stehen für die drastischen Seiten des katholischen Glaubens: Menschen, die mit den Malen Jesu gezeichnet werden – mit Hand-, Fuß- und Brustwunden. manchmal auch mit dem Abdruck der Dornenkrone oder des Kreuzes. Menschen, die an den Leidenstagen des Herrn immer wieder neu bluten, zugleich verzückende Visionen erleben, keine Nahrung mehr brauchen und mitunter heilende Fähigkeiten erlangen: Ähnliche schaurig-faszinierende Superlative scheint nur der Exorzismus zu bieten.
Die Traditionslinie beginnt mit Franziskus von Assisi, dem abtrünnigen Kaufmannssohn und 1228 heiliggesprochenen Gründer des nach ihm benannten Bettelordens.
Kurz nach seinem Tod im Jahre 1226 verfasst sein Ordensbruder Elias von Cortona einen Brief, der der Welt ein „neues Wunder“ verkündet: „Lange vor seinem Tode erschien unser Vater und Bruder als ein Gekreuzigter, der an seinem Körper die fünf Wunden trug, die in Wahrheit die Stigmata Christi sind. Denn seine Hände und Füße trugen Male, wie wenn Nägel von oben nach unten hineingeschlagen worden wären, welche die Wunden offenlegten und schwarz waren wie Nägel: die Seite erschien wie von einer Lanze durchbohrt, und oft floss Blut aus ihr.“
Volksheilige: Franziskus (um 1181-1226) soll auf dem Berg Alverna die Wundmale Christi empfangen haben: Altargemälde (um 1300) von Giotto di Bondone. Die oberpfälzische Bauernmagd Therese Neumann litt ab 1926 unter Stigmatisation, wobei Blut aus Händen und Augen ausgetreten sein soll
Die später verfassten Heiligenviten liefern genaue Angaben über das „Wo“ und „Wie“. Ihnen zufolge ereignete sich das Mirakel um das Fest der Kreuzeserhöhung (gefeiert zum Andenken an die Wiedererlangung eines Teils des Kreuzes Christi im Jahr 628), im September 1224. als sich Franziskus auf dem Berg Alverna in die Leiden Jesu versenkte. Auf dem Höhepunkt der Andacht erschien ihm ein gekreuzigter Engel mit sechs Flügeln - und ließ ihn mit Nägelmalen in Händen und Füßen zurück.
Seither gebiert jede Epoche eigene blutende Träger der Christusmale - getreu den Worten des Auferstandenen, der sich seinen Jüngern durch die Echtheit seiner Wunden zu erkennen gibt (Lukas 24,39): „Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst.“ Die Zahlenangaben variieren stark. 321 Fälle listet der Arzt Antoine Imbert-Gourbeyre 1894 auf, darunter 40 Männer. Seine Sammlung umfasst allerdings auch "innere Stigmata“: unsichtbare „Wunden“, die sich lediglich in Schmerzen äußern.
Der Jesuit Herbert Thurston (1856-1939) - einer der renommiertesten Kenner der Materie - spricht von 50 bis 60 vollständig Stigmatisierten. Neben Franziskus von Assisi nennt er nur einen weiteren Mann: Padre Pio, den 2002 heiliggesprochenen Kapuzinermönch aus Apulien, der die Wunden 1918 vor einer Statue des Gekreuzigten empfängt. Doch wer sind all jene Menschen, Katholiken in der Mehrzahl, die nach frommer Lesart als Auserwählte Gottes gelten müssen? Und: Wie haltbar ist der Glaube an blutige „Wunder“ aus der Sicht des 21. Jahrhunderts?
Todesmal: Laut Johannesevangelium soll ein römischer Soldat seine Lanze in die Seite des Gekreuzigten gestoßen haben. Blut und Wasser flossen aus - ein Zeichen, dass Jesus gestorben war
Wer Betrug wittert, stößt mühelos auf eine „schwarze Liste“, die vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit reicht. Auf ihr finden sich längst vergessene Kurzzeit- „Heilige“ wie die portugiesische Dominikanerin Maria de la Visitacion, deren Christuswunden um 1587 von der Inquisition abgewischt werden. Argwohn trifft indes auch Padre Pio - Italiens verehrten Nationalheiligen, durch dessen Wunden Weggefährten angeblich sogar Zeitung lesen konnten. Glaubt man dem Historiker Sergio Luzzatto, wandte sich der Pater hilfesuchend an eine Apotheke in Foggia - um dort zunächst hautverätzende Karbolsäure und schließlich eine ebenso bedenkliche Ration des schmerzstillenden Gifts Veratrin zu ordern.
Weitere, übergreifende Beobachtungen verstärken die Zweifel am göttlichen Ursprung des Blutwunders. So sind die Jesusmale bis in die jüngste Gegenwart nie dort erschienen, wo sie sich - nach neuen historischen Erkenntnissen - tatsächlich befunden haben mussten: nicht in den Handflächen, sondern nahe der Handwurzel, zwischen Elle und Speiche. der einzigen Stelle, die eine sichere Befestigung am Kreuz garantierte.
Ähnliche Vorbehalte beziehen sich auf die Glaubwürdigkeit der Begleitvisionen. Arm an Zeitkolorit, teils historisch falsch und - wie das Aussehen der Wunden – verdächtig nah an zeitlich verhafteten Erbauungstexten und bildlichen Darstellungen: Dieses Forscherurteil gilt mithin selbst für die berühmten Schauungen der seliggesprochenen Dülmener Nonne Anna Katharina Emmerick (1774-1824). Was der romantische Dichter Clemens Brentano einst am Bettrand der Gezeichneten notierte, diente 180 Jahre später als Vorlage für Mel Gibsons umstrittenen Film „Die Passion Christi“.
Das Endprodukt erweist sich als ebenso grausame wie schillernde Detailorgie - bis hin zur Darstellung einer Geißelung, die sich in dieser Extremform, als Blutrausch aus Widerhaken und umherfliegenden Fleischstücken, nicht in der Bibel findet.
Fanatiker: Auf den Philippinen lassen sich gläubige Christen an Karfreitag für kurze Zeit ans Kreuz schlagen. Damit die Wunden nicht ausreißen, werden die Gekreuzigten mit Seilen gesichert
Ärzte und Biologen, die das geheime Regelwerk von Epidemien erforschen, richten besonderes Augenmerk auf den Patienten „null“, der das Virus als Erster in Umlauf bringt. Der Volkskundler Christoph Daxelmüller verdichtet das Interesse an Franziskus in der Frage: „Warum sparte Gott über mehr als ein Jahrtausend hinweg an einem Wunder, mit dem er von nun an heiligmäßige Menschen in der Mehrzahl Frauen, bis ins 20. Jahrhundert ( ... ) auszeichnen sollte?“
Die Suche nach Antworten fördert überraschendes zutage: Das Mirakel wird nicht nur in einer Epoche geboren, die wie keine vorhergegangene nach sinnlichen Verkörperungen der Christusgewalt verlangt. Noch dazu lassen sich viele Muster, denen das Wunder bis heute zu folgen scheint, auf hochmittelalterliche Weichenstellungen zurückführen.
Als Franziskus die Zeichen empfängt, befindet sich die abendländische Frömmigkeit in einer revolutionären Umbruchphase. Über tausend Jahre lang triumphierte der siegreiche Christus - seit dem Hohen Mittelalter aber richtet sich die Anbetung auf den leidenden Menschensohn, der durch die Kreuzzüge und Pilgerfahrten ins Heilige Land in nie gekannter Weise greifbar wird. Die Besessenheit von den leiblichen Dimensionen der Erlösung führt schließlich zu einer veränderten Umsetzung des Nachfolgegebots: „Das Kreuz auf sich nehmen“ bedeutet zu Lebzeiten von Franziskus nicht mehr nur, in Armut oder im Dienst am Nächsten leben. Sondern: leiden, ächzen - und fühlen wie der Fleischgewordene.
Vor diesem Hintergrund erschafft der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux neue Passionsmystik, die den Körper zum Ort der Gotteserfahrung macht. ln einem Zeitalter, das die zärtliche Liebe als Ideal verherrlicht, soll sich der Gläubige als „Braut“ zur „Jesusminne“ emporheben. Das leibliche Sich-Einfühlen in die Qualen Christi wird in erotischen Bildern beschworen - just in dem Moment, als die Kirche die Ehelosigkeit für Priester und Ordensleute zementiert.
Beispielhaft hierfür steht das Hohelied des Alten Testaments: ein betörend-sinnliches Zwiegespräch zwischen zwei Liebenden, das den Moment der höchsten Lust mit der Berührung der Lippen gleichsetzt. In Bernhards Deutung steht dieser Kuss für das Einswerden mit Gott, dem das Hochmittelalter mit einer neuen Technik - der Bildmeditation - entgegenarbeitet.
Schon im 12. Jahrhundert werden Mönche ermahnt, ihre Zellen mit dem „Bildwerk des am Kreuze hangenden Heilands“ auszustatten und sich mit seiner Hilfe in die Passion zu versenken. Im Spätmittelalter greift die Bildmeditation schließlich derart um sich, dass sich der Historiker Peter Dinzelbacher dafür ausspricht, „sehr viele Visionen“ als Beschreibungen von Kunstwerken zu lesen.
Bezeichnenderweise spricht die Verherrlichung des schwachen Christus gerade Ordensfrauen an. Wie Kulturwissenschaftler betonen, gilt demütiges Erdulden seit frühester Zeit als weibliches Verhalten. Dies erklärt, warum der „Schmerzensmann“ - just in dem Moment, da er das vormals nackte Kreuz erobert - mit kindlich-mädchenhaften Zügen ausgestattet wird. Aber auch die Brautmystik richtet sich in besonderer Weise an die Töchter Evas - und ermahnt sie, ihre Triebhaftigkeit in marienhaft-jungfräuliche Gottesliebe umzuwandeln.
Wunder? Bei dem italienischen Priester Padre Pio (1887 -1968) zeigten sich ab 1918 Wundmale an Händen, Brust und Füßen (nächste Seite). Auch Krankenheilungen und Weissagungen werden ihm zugeschrieben, weswegen er 2002 heiliggesprochen wurde. An der Padre-Pio-Statue in Messina beobachteten Gläubige im selben Jahr einen Ausfluss blutiger Tränen. Eine Frau aus der Stadt gestand später, dass es sich um einen Scherz ihres Sohnes handelte, der sein Blut auf die Figur gesprenkelt hatte
Sadistisch: Mit einem langen Nagel fixierten die römischen Soldaten die Füße Christi am Kreuz. Der kleine Querbalken sollte verhindern, dass der Verurteilte durch sein Gewicht nach unten sackte und ohnmächtig wurde - was die Qualen verkürzt hätte
Hieraus entsteht eine eigenwillige, weibliche Leidensfrömmigkeit, die Nonnen mitunter sogar veranlasst, ihr Bettlager mit der Statue des Gekreuzigten zu teilen. Der Wille, dem Mitleid nachzuhelfen, treibt indes beide Geschlechter zu Extremen. Wenn sich die Klosterfrau Maria von Oignies (um 1177-1213) in höchster Ekstase ein Fleischstück aus der Hand schneidet, gleicht sie unzähligen Glaubensbrüdern, die sich im Leidenswahn Christuswunden zufügen oder sich - im Extremfall – freiwillig ans Kreuz schlagen lassen.
Stigmatisiert: Therese Neumann erblindete 1919, war gelähmt - und genas wie durch ein Wunder. Seit 1926 soll sie weder gegessen noch getrunken haben. Sie wurde weltberühmt und starb 1962
Selbst beigebrachte Jesuswunden, die in den Quellen gleichfalls als Stigmata bezeichnet werden, haben freilich einen Makel: Sie kommen nicht von Gott - und wer
sie sich aneignet, muss sich wegen Anmaßung verantworten.
Ganz anders die Stigmata des Franziskus von Assisi, die sich geschmeidig in das Programm des 4. Laterankonzils (1215) einfügen. Nicht nur, dass die Kirchenversammlung den eucharistischen Verzehr von Christi Leib und Blut zum zentralen Glaubenssakrament erhoben hat. Seit diesem Konzil gilt es als Gewissheit, dass sich der Erlöser buchstäblich in Brot und Wein verkörpert - oder aber im Körper frommer Gläubiger: Es ist die Idee der freiwilligen Reinkarnation, die erklärt, warum die Male so viel mit Macht zu tun haben. Wer als Einschreibfläche auserkoren wird, erreicht im Idealfall das Ansehen eines „zweiten Christus“. Franziskus erhält den Gnadenerweis in einer Zeit, als sein Führungsanspruch innerhalb der Gemeinschaft wankt. Das Wunder stärkt daher den Franziskanerorden als Ganzes und verleiht ihm das Siegel der Einzigartigkeit.
Beobachtungen zeigen, dass sich das Gesetz von Angebot und Nachfrage überzeitlich geltend macht: Stigmata ereignen sich bevorzugt da, wo das Verlangen nach drastischen Christusbeweisen situationsbedingt ansteigt und wo sie auf Jünger stoßen.
Jesusmale erscheinen, wo Gruppen, die sich auf Christus berufen, nach einem sinnlichen Beweis für ihre Rechtmäßigkeit suchen - mitunter auch außerhalb des Katholizismus.
Vor allem aber vollzieht sich die Neuauflage der Passion immer wieder dort, wo sich Christusanhänger in der Opferrolle wähnen, wo sie Angriffe erleiden und sich ihres Glaubens rückversichern müssen.
So auch im frühen 19. Jahrhundert, als die römische Kirche - vom napoleonischen Joch befreit - auf neue Feinde trifft. Der Katholizismus wähnt sich im Kampf gegen staatliche Übergriffe und protestantische „Ketzer“-Theologen, die die Evangelien als
Kindermärchen verleumden; hieraus entsteht eine Frömmigkeitsbewegung, die um 1830 eine regelrechte „Sucht nach Wundern“ produziert. Wie der Historiker Bernhard
Gißibl zeigt, verlangt die Zeit nach Zeichen, die das Wirken Christi wieder greifbar machen: nach leidenden „Jungfrauen“, die das Martyrium der „reinen“ Kirche verkörpern.
Prompt kommt es in den ländlichen Gebieten Frankreichs, Südtirols und Oberbayerns zu einer neuen Welle von Stigmatisationen, die vielerorts gezielt von Seelsorgern gesteuert werden. Dies gilt auch für das oberbayerische Waakirchen, wo Pfarrer Matthias Weinzierl mit heiligem Eifer an der „plastischen Durchbildung“ der Stigmata arbeitet: Rosenkranzgemeinschaften und Ölbergsandachten, die das Passions-geschehen dramatisch lebendig machen. Ältere und neue Leidensvorbilder, die systematisch eingepaukt werden, allen voran der spektakuläre Fall der „Kindfrau“
Maria von Mörl, die ab 1834 in Südtirol blutet. Und: geheimnisvolle priesterliche Hausbesuche, die bereits damals mit Hypnose in Verbindung gebracht werden. All dies beschert der Gemeinde Waakirchen um 1840 gleich vier - teils blutende - Ekstatikerinnen.
Viele der vormärzlichen „Wunder“ werden unter dem Zugriff von Staatsbeamten und Ärzten als Täuschung entlarvt. Andere Phänomene erscheinen dafür umso rätselhafter: Woher rühren die Stigmata der belgischen Bauerntochter Louise Lateau, deren Hände 1875 mit Glaszylindern überzogen werden - und trotzdem bluten? Fälle wie dieser verengen das Erklärungsmodell bereits vor 1900 auf die Alternative „Betrug
oder psychische Ursache“.
Eine Frage, die sich auch in Sachen Franziskus stellt: Waren die Male Wunden einer
Selbstkreuzigung, die erst nach dem Tod des Ordensgründers zum Mirakel verklärt wurden? Oder muss der Heilige viel eher als Patient betrachtet werden? Die Psychoanalytikerin Nitza Yarom spricht in diesem Zusammenhang von Vaterhass und
unterdrückten bisexuellen Tendenzen, die als Ausdruck von Hysterie körperlich sichtbar wurden.
In der Tat besitzt das Krankheitsbild „Hysterie“ Ähnlichkeit mit religiösen Ekstase-Erscheinungen: ein Phänomen. das der Pariser Nervenarzt und Freud-Lehrer Jean-
Martin Charcot bereits um 1890 in Hypnosesitzungen vorführt. Menschen mit hysterischer Symptomatik leiden unter einem labilen Selbstgefühl, sind extrem beeinflussbar und schlüpfen aus Gefallsucht wiederholt in Rollen. Verdrängte Konflikte werden in körperliche und geistige Ausfallerscheinungen umgewandelt.
Vor allem aber spüren die Betroffenen den Drang, ihre Leiden vor Publikum aufzuführen - ein letztes Merkmal, das sich auf eine Vielzahl von Blutwundern beziehen lässt. Fast alle Gezeichneten können auf eine Krankengeschichte zurückblicken, und fast alle erleiden die Stigmatisation in einem Zustand der Trance. So auch die berühmte Oberpfälzer Dorf-“Heilige“ Therese von Konnersreuth, die vor dem dramatischen Empfang ihrer fünf Wundmale (1926) auf wundersame Weise von Blindheit und Lähmung geheilt wird. Bernhard Gißibl betont, dass die Schmerzensrolle im 19. Jahrhundert gerade für einfache Frauen eine Form der „Krisenbewältigung“ war.
Körperliche und seelische Gebrechen, die in harten Lebensumständen wurzelten, verwandelten sich urplötzlich in die Leiden Christi - und erhielten Aufmerksamkeit und Zuspruch.
Die Amtskirche hat sich dem Wissensstand schrittweise angepasst. Im 13. Jahrhundert werden mehrere päpstliche Bullen ausgefertigt, um Zweifel an der Echtheit des Franziskus-Mirakels zu zerstreuen. Heute ist die Anerkennung einer Stigmatisation nur von Fall zu Fall möglich - kein Katholik ist verpflichtet, an sie zu glauben; auch wurde seit dem 20. Jahrhundert in Deutschland nirgendwo mehr eine erteilt. Ein Allmächtiger, der Menschen unmittelbar ins Fleisch fährt? Diese Vorstellung wurde – auf institutioneller Ebene - tatsächlich bereits im 18. Jahrhundert hinterfragt. Getreu der theologischen Mehrheitsmeinung heißt es heute vielmehr auch im „Lexikon der katholischen Spiritualität“: „Stigmata sind ( ... ) körperliche Symptome psychogenen und auch sozialen Ursprungs, bei deren Entstehung äußere und innere Faktoren zusammenwirken.“
Dennoch, die Entzauberung bleibt unvollständig - nicht nur, weil immer noch Raum
für eine von Gott ergriffene Seele bleibt. Entscheidender ist, dass der „Link“ zwischen
Psyche und Stigmata bis heute nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Traumatisierte Unfall- und Misshandlungsopfer produzieren mitunter psychogene (Unterhaut -)Blutungen, die alte Verletzungen rückwirkend „erinnern“ lassen. Doch wie steht es mit dauerhaften, tiefen Wunden, die periodisch neu bluten?
Mehr als 780 Jahre nach Franziskus scheint die Faszination der Wundmale gerade darin zu bestehen, dass sie so offensichtlich von dieser Welt sind - und doch ein Mysterium in sich bergen. Judith von Halle verarbeitet ihre Passionserfahrung in Büchern und hat sich mit ihren Anhängern in der „Freien Vereinigung für Anthroposophie“ organisiert. Laut Homepage soll die Arbeit der Gesellschaft beweisen, „dass die Geisteswissenschaft“ von Rudolf Steiner ihren Ursprung „dem Christus-Impuls“ verdankt.
Die Wissenschaft ist da völlig anderer Meinung. Z.B. kann Haut-Milzbrand (Anthrax)
offene, auch blutende Male verursachen, die den Wunden Christi ähneln. Eine logische Erklärung für Häufungen von Stigmata auf dem Land?
Die bakterielle Infektionskrankheit Milzbrand (auch Anthrax genannt) wird von Tieren
auf Menschen übertragen - durch Kontakt mit kranken Tieren oder den Verzehr ihres
Fleisches. An der Stelle, an der die Keime in den Körper eintreten, meist an den Händen, bilden sich erst Bläschen, dann größere Karfunkel, die sich zu Ödemen erweitern können. Breitet sich die Krankheit nicht auf Darm oder Lunge aus, überleben
die Patienten meist und sind auch kaum ansteckend. Heute kann Anthrax mit Antibiotika gut behandelt werden. Dass im 19. Jahrhundert so viele arme, junge Frauen im ländlichen Bereich „stigmatisiert“ wurden, oft sogar innerhalb einer einzigen Region,
könnte an einer Milzbrand-Epidemie gelegen haben. Die Frauen hatten engen Kontakt
zu Tieren, etwa beim Melken, und vielleicht wegen armutsbedingter Mangelernährung
ein schwaches Immunsystem. Auch die kränkliche Bauernmagd Therese von Konnersreuth hat möglicherweise Anthrax gehabt. Den Nachweis könnten Untersuchungen der sterblichen Überreste der Betroffenen erbringen. Sporen des Milzbranderregers überleben jahrhundertelang auch in einem toten Wirt.
Diagnose Haut-Milzbrand: Diese Patienten sind von den offenen, schlecht heilenden Karbunkeln der Infektionskrankheit gezeichnet. Die Ähnlichkeit zu Stigmata ist verblüffend
An Hand der ersten drei Kapitel wurde nachgewiesen, dass viele Glaubenserscheinungen und Wunder ganz einfach durch die moderne Wissenschaft entzaubert werden können.
Wie sieht es aber mit dem „Buch der Bücher“ aus?
Die Bibel (von griechisch tà biblia: die Bücher), ist die Sammelbezeichnung für all jene Texte, die im Schriftenbestand des Alten Testaments und des Neuen Testaments enthalten sind. Als solche bildet die Bibel die zentrale Grundlage bzw. den verbindlichen Offenbarungsbericht des christlichen Glaubens und wird nach einer Erwähnung in Römer 1, 2 in diesem Sinn auch als „Heilige Schrift” bezeichnet.
Stimmen dort wenigsten die Geschichten? Lesen Sie dazu die nachfolgenden Kapitel: