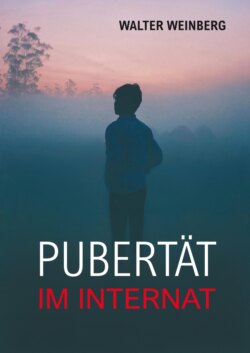Читать книгу PUBERTÄT - Walter Weinberg - Страница 6
2. Umzug ins Kloster
Оглавление10. September 1985: Es war ein schwüler, bewölkter Spätsommertag, an dem meine Mutter und ich Bettzeug, Kleidung und Schulsachen packten. An diesem Tag zog ich als Zehnjähriger in das Internat Dachsberg.
Im Februar hatte ich mit meinen Eltern das Gymnasium und Internat besichtigt. Wir hatten damals einen Termin mit dem Heimleiter P. Prinz vereinbart. Es schneite und war sehr kalt an diesem Sonntagnachmittag. Wir fuhren durch St. Thomas, wo mein Onkel lebte und nach ein paar Minuten waren wir schon in Dachsberg. Es war also nicht weit von zu Hause.
Wir betraten das Internatsgebäude, das wir glücklicherweise sofort fanden bei diesem Dorf ähnlichen Gebäudekomplex. Auch das Präfektendienstzimmer war leicht zu finden, wo gerade ein älterer Herr telefonierte: „Tut mir leid, unser Heimleiter Pater Prinz ist heute leider nicht hier. Bitte rufen Sie morgen wieder an. Auf Wiederhören!“ Mein Vater fragte trotzdem: „Grüß Gott, wo finden wir Herrn Pater Prinz?“ „Ja“, antwortete Pater Elias: „Der ist heute nicht da. Ich kann Sie aber zu unserem Direktor führen!“
Mir flößte das Gebäude wegen seiner Größe Angst ein. Das war für mich als Kind vom Lande eine völlig andere Welt. Wir begrüßten den Direktor Pater Biregger. Meine Eltern sprachen mit ihm über mein Halbjahreszeugnis von der Volksschule: „Ob Walter mit einem Dreier in Mathematik überhaupt aufgenommen werden kann?“ Pater Biregger meinte: „Leider sind wir ja schon ziemlich voll für das nächste Schuljahr, aber wenn jemand ausfällt, werden wir ihn aufnehmen. Es fallen jedes Jahr welche aus!“ Er führte uns durch einen dunklen, fensterlosen Gang zur Kapelle, als mich plötzlich ein totes Zebra, dessen Fell an der Wand hing, erschreckte. Ich war etwas verängstigt, was Pater Biregger merkte: „Ich muss mich entschuldigen, es brennt kein Licht, weil ja am Sonntag kein Schulbetrieb ist!“ Vorm Eingang zur Kirche war eine dicke Betonsäule und ein großes Kreuz mit einem lebensgroßen voll Schmerz und Wunden gezeichneten Christus.
Zur Kapelle musste man durch eine schmale Schiebetür die Stiege hinunter gehen. Unten war es eiskalt! Pater Biregger erklärte: „270 Personen finden hier Platz.“ Später als Schüler bei Schulgottesdiensten merkte ich, wie wenig Platz das war. An der Altarwand hing eine übergroße, sehr ungewöhnliche Jungfrau Maria mit ausgestreckten Armen, die mir vorkam wie ein Jüngling. Der Direktor sagte über die Statue: „Das ist unsere Sonne!“ Er meinte allerdings den Heiland Jesus, also doch keine Jungfrau Maria! Die ganze Kapelle wirkte sehr seltsam und kühl in ihrer Siebzigerjahre-Architektur.
Wir gingen zu den kleinen Seitenaltären. Pater Biregger fragte mich: „Walter, wer ist denn der Mann, der da im Seitenaltar dargestellt ist?“ Ich sah das bunte Glasbild an und antwortete: „Das weiß ich nicht!“ Pater Biregger war über mein Unwissen überrascht: „Das ist der Heilige Josef mit dem Jesuskind!“ „Aber der Josef hat doch einen Bart?“, entgegnete ich. Anscheinend war in dieser Kirche alles ein wenig anders. Anschließend zeigte er uns den Bastelraum. Die Fenster vom Bastelraum, durch die man in den Turnsaal blicken konnte, gefielen mir. Wir besichtigten noch den Festsaal mit der barocken Bühne und den Speisesaal. Das war der einzige Raum, der mich glauben ließ, dass Dachsberg ein Schloss ist. Am Weg zum Auto faszinierte mich ein Übergang mit Fenster direkt über der Straße.
Als wir von meinem ersten Besuch in Dachsberg nach Hause kamen, sagte ich zu meiner Mutter: „Mama, mir gefällt es dort nicht, ich will da nicht hin!“ Sie meinte: „Das wird schon! Wenn Du erst einmal dort bist, wird es Dir schon gefallen!“ Ich dachte, wenn kein Platz frei wird, nehmen sie mich sowieso nicht!
Ein halbes Jahr verging und ich fuhr mit meiner Mutter wieder nach Dachsberg, nur dass ich dieses Mal dortbleiben musste. Vor den Sommerferien meldete mich meine Mutter endgültig in Dachsberg an. Kurz zuvor erfuhren wir, dass ein Schüler mit den besten Schulnoten abgesagt hatte und sein Platz frei für mich wurde. Pech gehabt, dachte ich und übte mich in Realitätsverweigerung.
Am Vorabend meines Umzuges ins Internat fing im Fernsehen eine neue Serie an „Der Leihopa“. Ich wusste, ich werde die zweite Folge nicht mehr sehen können. Mein Vater schenkte mir eine Armbanduhr, damit ich nie zu spät zur Schule komme. Im Internat bemerkte ich bald, wie viele Uhren es an den Wänden gab. Eigentlich waren sie überall.
Es war so weit und ich musste von zu Hause weg! Während der Autofahrt erblickten meine Mutter und ich nach dem Schild „Ausfahrt Schule“ den riesigen Gebäudekomplex von Dachsberg. Angst und Traurigkeit überkamen mich. Wir gingen durch den Internatseingang zum Präfektendienstzimmer und begrüßten dort endlich den Heimleiter Pater Prinz. Als wir damals nach der Besichtigung heimfuhren, verband ich den Namen Prinz mit dem sympathischen Direktor Pater Biregger. Jetzt war es für mich schwierig, den Namen Prinz mit diesem Mann in Verbindung zu bringen. Er teilte uns die Nummer meines Zimmers mit: 24 im zweiten Stock. Oben angekommen, schritten wir den langen Gang hinter der Glaswand entlang bis zum Ende. Es war jener Stock, in dem die Türen orange waren. Im ersten Stock waren die Türen grün. Das letzte Zimmer hatte die Nummer 24.
Bevor wir das Zimmer betraten, sah ich aus dem Fenster am Ende des Ganges. Es war weit bis nach unten! Im Zimmer erblickte ich meinen Freund aus der Volksschule, Christoph, der einzige meiner Freunde, den ich überreden konnte, mit mir nach Dachsberg zu gehen. Christoph hatte anscheinend bereits einen neuen Freund gefunden, mit dem er Fußballspielen wollte. Ich fragte ihn, weil ich nicht alleine bleiben wollte: “Hast Du denn einen Fußball mit?“ „Nein, aber der Herr unten hat gesagt, er gibt uns einen!“ Jedenfalls wusste ich jetzt, dass Christoph und sein neuer Freund mit mir das Zimmer teilen. Es fehlten noch zwei Burschen, die ebenfalls in meinem Zimmer schlafen werden.
Eine zarte Frau trat mit ihrem dicken, stark wirkenden Sohn ins Zimmer. Der kam mir vor, als würde er sich gerne prügeln. Meine Mutter plauderte mit der Frau, während ich den starken Buben beobachtete. Meine Mutter fragte sie, ob sie uns bei einem Rundgang durchs Internat begleiten will. Der starke Junge ging auch mit. Ich musste dringend auf die Toilette, aber wir kamen an keiner vorbei. Ich traute es mir wegen der Frau und dem Jungen nicht sagen, aber jetzt musste ich wirklich! Wir gingen hinunter zum Heimleiter und Mama fragte, wo die Toilette ist. Ich musste eine Tür mit einem „H“ darauf finden. Am Rückweg fand ich eine Tür mit einem „D“ wie Dame. Ich hatte es begriffen!
Jetzt musste sich Mama von mir verabschieden. Ich konnte mir das Weinen nicht mehr verhalten. Sie begleitete mich noch bis in den Studiersaal und verließ mich dann. Die fremden Buben im Saal machten mir Angst. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt ganz auf mich allein gestellt war. Ein Mann kam durch die Tür und stellte sich vor: „Ich bin Euer Präfekt Pater Angleitner.“ Ein blonder Junge stellte ihm gleich eine Frage: „Herr Lehrer ...“ Ich war überrascht, denn meine Mutter wies mich darauf hin, die neuen Lehrer und Erzieher nur mit „Herr Professor“ anzusprechen. Ich war also doch nicht der Einzige, dem das komisch vorkam. Ich hatte mich gerade ein wenig beruhigt, als ich plötzlich Mama durchs Fenster erblickte, wie sie die Stiege zum Parkplatz hinauf ging. Mir fiel erst jetzt auf, dass sie das dunkelbraune Kleid mit dem weißen Muster anhatte, dass sie sonst nur zu feierlichen Anlässen trug. Vielleicht hat sie noch mit der kleinen Frau gesprochen, sonst wäre sie schon weg gewesen. Ich fing wieder an zu weinen. Nach der Begrüßung des Präfekten führte er uns in den barocken Speisesaal. Der Saal war riesig und sah aus wie eine Kirche. Später erfuhren wir, dass der Speisesaal tatsächlich früher die Kapelle des Schlosses war. Nach dem Essen mussten wir auf unsere Zimmer gehen. Wir stellten uns dort gegenseitig vor. Die anderen sprachen davon, dass einer mit dem Namen „Guido“ fehlt. Solch einen Namen hatte ich noch nie zuvor gehört. Und schon kam er herein. Ein dicker rothaariger Junge, der sehr gut gelaunt war. Er hatte sich das Eckbett an der Trennwand zu den Waschbecken reserviert. In allen vier Jahren, egal in welchem Zimmer, beanspruchte er dieses Bett für sich. Für mich war kein gutes Bett mehr frei. Es war das Mittlere, wo man am besten gesehen wurde. Ich konnte mich auf keine Seite drehen, wo ich unbeobachtet war.
Pater Köckeis betrat das Zimmer und bot allen Interessierten an, sich seiner Führung durchs Haus anzuschließen. Ich hatte Angst, mich in diesem riesigen Haus nie alleine zurechtzufinden. Der Blick von unten in das Stiegenhaus hinauf machte mich schwindelig. Das Schulgebäude war das höchste Gebäude, das ich in meinem bisherigen Leben gesehen hatte.
Wir mussten noch einmal in den Studiersaal. Dort hänselte der große blonde Junge, der „Herr Lehrer“ gesagt hatte, den starken dicken Buben und verhöhnte ihn: “Gel? Du bist mit Deiner Mama verheiratet!“ Irgendwie musste er erfahren haben, dass die Mutter des starken Buben nicht verheiratet war. Der starke Junge blickte traurig und hatte Tränen in den Augen. Nach dem Abendgebet mussten wir Schlafen gehen. Der starke Bub zog sich vollständig nackt aus und wusch sich beim Waschbecken mit einem Waschlappen. Als wir das sahen, mussten wir alle kichern. Es fielen auch blöde Bemerkungen wegen seiner Figur. Er war gar nicht so stark. Auch er weinte, wie ich in dieser Nacht. Ich vermisste es, allein in einem Zimmer zu schlafen. Es war auch viel zu früh für mich, um diese Uhrzeit ins Bett zu müssen. Zu Hause durfte ich gewöhnlich noch fernsehen und bekam eine heiße Schokolade. Irgendwann schlief ich dann doch ein.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich sehr gespannt auf den ersten Schultag in der neuen Schule. Es hat ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen! Nach dem Frühstück suchten Christoph und ich unsere Klasse, die wir im zweiten Stock fanden. Alle Möbel waren schön und sauber, nicht zerkratzt, so wie in der Volksschule. Die „externen“ Schüler, die mit dem Bus kamen, waren bereits alle in der Klasse. Christoph und ich setzten uns nach hinten. Er sprach gleich die zwei Buben in der vorderen Reihe an und berichtete: “Der eine da vor Dir heißt auch Walter!“ Ich war zu ängstlich, um etwas zu sagen. Nun betrat eine große blonde Dame das Klassenzimmer. Es wurde still und wir mussten aufstehen. Nach der Begrüßung wurde das Morgengebet gesprochen. Sie schrieb ihren Namen auf die Tafel: „Frau Professor Söllinger“. Sie forderte uns auf, ihr in die Kirche zu folgen.
Die kleine Klosterkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach dem Glockenläuten betraten zehn Patres und zwei Ministranten den Altarraum. So viele Priester um einen Altartisch hatte ich nie zuvor gesehen. Der Direktor Pater Biregger begrüßte die Schüler, vor allem die Neuen. Dann sprach er von einer Sonne im Altarraum. Ich wusste nicht, ob er das große runde Glasfenster an der Decke meinte, von dem Licht auf den Altar strahlte, oder die Jungfrau Maria alias Jesus ohne Bart.
Nach der Messe gingen wir wieder in die Klasse und die blonde Dame teilte die Schulbücher aus. Es klopfte jemand an die Tür, und eine nette Frau betrat die Klasse: “Brigitte, teilst Du heute schon die Schulbücher aus?“ Frau Professor Söllinger antwortete: “Ja, Ulli!“ Die freundliche Lehrerin sagte darauf: “Dann mach ich das bei meiner Klasse auch heute schon!“
Wir waren alle überrascht, als wir am ersten Schultag schon eine umfangreiche Hausübung von Frau Professor Söllinger bekamen. Um elf Uhr entließ sie uns, und wir mussten gleich zu Pater Angleitner in den Studiersaal gehen. Er teilte uns mit, dass wir nun zur „Ausgabe“ von Pater Prinz gehen müssen, um uns Packpapier für das Auskleben unserer Pultladen zu holen. Dort bekamen wir auch weiteres Schulzeug wie bunte Leuchtstifte, Lineale, Hefte usw. Alles, was wir dort holten, wurde auf die Internatsrechnung gesetzt.
Danach mussten wir unser Taschengeld bei Pater Köckeis abgeben, der es in einer Eisenkassette verwahrte. Wir konnten es in der sogenannten „Geldausgabe“ wieder bekommen. Nur 25 Schillinge (1 Euro und 80 Cent) durften wir behalten. Nach dem Auskleben der Pultladen mussten wir die Hefte und Bücher einbinden und alles in das Pult einräumen. Diejenigen, die das Pult am schönsten eingeräumt hatten, bekamen nach der Kontrolle von Pater Angleitner Waffel oder Schokolade zum Verdruss der weniger Ordnungsbegabten.
Um 13.05 gab es jeden Tag Mittagessen. Es wurde vor und nach dem Essen gebetet. Jeder bekam einen Platz im Speisesaal zugewiesen. Ich saß am Tisch nahe dem Eingang. Unser „Tischmeister“ war Glas Peter aus der vierten Klasse. Die Aufgabe des Tischmeisters bestand darin, das Essen auszuteilen und für Ordnung zu sorgen. Als disziplinarisches Mittel gab es „Nachschubverbot“. Unser Tischmeister war Gott sei Dank gerecht beim Verteilen des Essens, im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden. Jedem Tisch waren bei den Kühlregalen zwei Boxen mit der jeweiligen Tischnummer zugewiesen, in denen wir unser mitgebrachtes Essen unterbringen mussten. Die überfüllten und schweren Boxen mussten in den großen Pausen von den zugeteilten Schülern auf die Tische getragen werden. Da ging öfters etwas zu Bruch, wie zum Beispiel Flaschen. Zusätzlich gab es für jeden Tisch einen Kasten für Brot und Getränke, wo alles sicher war.
Nach dem Essen wollte ich mich im Zimmer etwas ausruhen und alleine sein. Der Gang zu den Zimmern war versperrt! Auf dem Weg in den Studiersaal sah ich eine hölzerne Telefonzelle in der Aula. Dort stellten sich Schüler an, um zu telefonieren. Als ich mich auch anstellte, kam Pater Angleitner auf mich zu und teilte mir mit: “Walter, die Neuen dürfen im ersten Monat nicht telefonieren!“ Ich verstand nicht, warum das verboten war. Mir kamen die Tränen, weshalb ich wirklich allein sein wollte. Wieder fand ich keinen Platz, wo ich mich zurückziehen konnte. Um Viertel nach vier nachmittags begann die Freizeit. Einige Schüler fragten den Präfekten, ob sie Süßigkeiten einkaufen dürfen. Ich war überrascht, dass es hier mitten am Land ein Geschäft gab. Als Christoph und ich fragten, ob wir auch einkaufen gehen dürfen, sagte Pater Angleitner: “Hab ich nicht schon gesagt, dass die erste Klasse im ersten Monat nicht weggehen und nicht telefonieren darf?“
Als wir um acht Uhr ins Bett gehen mussten und das Licht abgedreht wurde, musste ich wieder weinen. Ich hatte starkes Heimweh. Ich lag lange wach im Bett und konnte nicht einschlafen. Ich fühlte mich, als wäre ich nur hier, weil ich etwas Schlimmes angestellt hatte, wovon ich nichts wusste. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr weit weg von zu Hause war.
Es war wieder morgen, und der Junge namens Guido zog sich an, obwohl es erst sechs Uhr war. Er weckte den vom Heimweh geplagten „starken“ Buben und fragte ihn, ob er mit ihm in die Kirche gehen möchte. Ich überlegte, woher er wusste, dass man hier um halb sieben in die Messe gehen konnte.
An diesem Schultag ging der Unterricht richtig los. In Deutsch schrieben wir schon einen Aufsatz, und in Englisch mussten wir bei der blonden Dame die Hausaufgabe abgeben. Guido und ich machten uns nach dem Unterricht näher bekannt, und am nächsten Morgen ging ich mit ihm in die Kirche. Es war Freitag, und am folgenden Tag werde ich endlich nach Hause fahren. Nach dem Unterricht wurde das Pult wieder kontrolliert, und die Ordentlichsten bekamen wieder Süßigkeiten von Pater Angleitner, und dieses Mal sogar ich. In der Freizeit erzählten Guido und ich einander von zu Hause, und ich wünschte, ich wäre schon dort.
Endlich war Samstag, und es war soweit: Um Viertel nach elf werde ich nach Hause fahren. Wir hatten eine Fahrgemeinschaft mit den Eltern der Schüler aus meinem Heimatdorf. Manchmal fuhren wir auch mit einem Lehrer mit, der aus Pollham war. Daheim, als wir beim Essen saßen, fragten mich meine Eltern, wie es mir in Dachsberg gefällt. Ich überspielte meine Gefühle und antwortete: “Es geht so.“ So wie auf der Karte, die alle am ersten Schultag schreiben mussten, um sie nach Hause zu schicken:
Liebe Eltern und Geschwister!
Es gefällt mir gut hier in Dachsberg. Das Essen ist gut, und das Wetter ist auch recht schön. Mein Klassenvorstand heißt Prof. Brigitte Söllinger, und sie ist sehr nett. Ich komme am Samstag heim.
Euer Walter!
Blick von zu Hause auf Pollham und die Alpen
Nach dem Essen im Kreis der Familie ging ich nach draußen und setzte mich auf die Bank vorm Haus. Ich betrachtete die Blumen, die Bäume, die Wiesen und die Felder. Ich kannte jeden Baum und jedes Detail unseres Gartens. All das schätzte ich erst jetzt, weil ich es nicht mehr jeden Tag sehe. Ständig musste ich daran denken, dass ich am nächsten Tag um sieben Uhr abends wieder in Dachsberg zurück sein muss. Als meine Mutter im Stall die Kühe molk, schilderte ich ihr meine wirklichen Gefühle und weinte. Mama konnte mich gar nicht beruhigen. Ich bat sie, nicht mehr dorthin zu müssen.
Nachts schlief ich in meinem eigenen Bett endlich wieder gut. Am Sonntag war ich die ganze Zeit nervös. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, als dass ich um halb sieben wieder wegfahren musste. Diesmal nahm ich viele Packungen Fruchtsaft mit, weshalb meine Tasche sehr schwer wurde. Als wir am Schild „Ausfahrt Schule“ abbogen, wurde mir richtig übel.
Meine Geschwister und ich 1985: Sabine, Walter (ich), Ulli und Thomas
Wir mussten in der zweiten Schulwoche einen Klassensprecher wählen. Nach zwei Wochen kannten wir einander kaum, wodurch diese Wahl keinen Sinn hatte. Dem entsprechend war das Ergebnis: Christof Bauer. Unser Klassenvorstand Frau Professor Söllinger nahm es sehr genau mit dieser Wahl. Wir mussten die Wahlzettel in eine Schuhschachtel mit Schlitz einwerfen. Die Frau Professor machte dann bei den jeweiligen Namen der Kandidaten Striche. In den Folgejahren durften sich nur Schüler mit einem „Sehr gut“ in „Betragen“ aufstellen lassen. Das galt jetzt noch nicht.
Bei einem Fußballspiel Lehrer gegen Lehrer dachte Guido, dass Professor Lehner und Professor Söllinger ein und dieselbe Person wären, und wir stritten deswegen. Beim Mittagessen plauderte ich mit Christoph, als ich schroff gestoppt wurde: “Weinbergmair, sei sofort still!“ Ich erschrak sehr! Pater Prinz marschierte in die Mitte des Speisesaales und begann mit seiner Rede, bei der er jeden Tag Verschiedenes bekannt gab. Seine Anrede mir gegenüber mit „Weinbergmair“ beschäftigte mich etwas. Noch nie zuvor wurde ich mit meinem Nachnamen angesprochen. Nach seiner Rede folgte das Dankgebet, das wie alle anderen Gebete mit dem Satz beendet wurde: „Heiliger Franz von Sales, bitte für uns!“ Am nächsten Tag beim Mittagessen war Pater Prinz witzig angezogen. Er hatte ein sehr altmodisches Hemd mit einem übergroßen Kragen und orange-blauen Streifen an. Dazu trug er eine Hose, die mit Farbe bekleckert war. Beim Mittagessen sagte mir Pater Prinz, dass es in einer höheren Klasse noch einen „Weinbergmair“ gibt. Ich kannte keinen und dachte nicht, dass er zu mir verwandt war.
Pater Prinz gab bekannt, dass an diesem Nachmittag alle Internatsschüler bei der Kartoffelernte arbeiten müssen. Dachsberg hatte einen enormen Bedarf an Kartoffeln. Das Kloster wurde von zehn Patres, neun Mönchen, zwei Klosterschwestern und 96 Internatsschülern bewohnt. Viele auswärtige Schüler, wie auch die meisten Lehrer speisten täglich in Dachsberg. Die Ernte wurde jedes Jahr den Internatsschülern aufgezwungen. Wir schwitzten ganz schön in der Spätsommerhitze. Die Zeit schien endlos, da es sehr eintönig war, ständig nur Kartoffel in die Kübel zu werfen, und das Feld war riesig. Nach der Schinderei gab es wenigstens ein besseres Abendessen als sonst.
Mit der Zeit lernten wir die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Internat kennen. Wir spielten im Freizeitraum Gesellschaftsspiele oder spielten auf den langen Gängen fangen, was verboten war. Im Keller gab es zwei Räume, wo wir Tischfußball spielten. Mich faszinierte, dass dort an der Wand ein riesiger Batman aufgemalt war. Den anderen Raum zierten Mini- und Micky-Maus.
Als Guido und ich nachmittags auf den Weg ins Zimmer waren, kamen uns zwei Zimmerkollegen entgegen, um Pater Angleitner zu holen. Mit ihm kamen noch andere Schüler in unser Zimmer. Der „starke“ Bub Thomas weinte laut und bitterlich in seinem Bett. Er hatte Heimweh und war nicht zu beruhigen. Ihn so zu sehen tat mir sehr leid. Ich hatte mein Heimweh schon etwas überwunden. In der Schule am nächsten Tag begann ich ein Gespräch mit Thomas. Er war sehr nett und lachte sogar, als wir von zu Hause sprachen. Guido verteilte in der Pause „Heimweh-Tabletten“. Die sahen nicht nur aus, sondern schmeckten auch wie „Dixi“ Traubenzucker. Natürlich hatte niemand etwas gegen Medizin, die gut schmeckt, und der Placebo-Effekt zeigte Wirkung.
Mittwoch abends hatten wir immer Filmtag. Es wurden alle zwei Wochen im barocken Festsaal ältere Kinofilme auf die Leinwand auf der Theaterbühne projiziert. Das Rattern des Filmprojektors, der die Filmstreifen durch zog, faszinierte mich. So etwas hatte ich als Bub vom Bauernhof noch nie erlebt.
In der nächsten Woche hatten wir unseren ersten Wandertag. Wir wanderten zusammen mit der „B-Klasse“ durch St. Marienkirchen, wo wir bei den Eltern einer Schülerin etwas zu trinken bekamen. Danach erreichten wir Egg nahe Pollham, wo wir bei Christophs Mutter ebenfalls unseren Durst löschen konnten. Wir gingen ungefähr zwei Stunden von Dachsberg nach Pollham. Das war beruhigend für mich zu wissen, dass ich zu Fuß so schnell nach Hause kommen würde. Unsere Essenspause hatten wir bei der Jausenstation „Wirt in der Pfleg“, wo es riesige „Wizeln“ gab, die auch meine Oma gern machte, allerdings viel kleiner. Weiter führte unser Marsch über den Magdalenaberg nach Bad Schallerbach. Dort wohnte die Sportlehrerin der Mädchen Professor Rosenauer, die uns zusammen mit Frau Professor Söllinger und Frau Professor Geidl begleitete. In Bad Schallerbach angekommen wartete schon ein Bus, der uns wieder zurück nach Dachsberg brachte.
Im Unterrichtsfach Religion hatten wir einen jungen Lehrer, von dem ich sehr beeindruckt war. Ich fand den Religionsunterricht von ihm sehr interessant. In der Volksschule las uns der Pfarrer in Religion gewöhnlich etwas Langweiliges vor.
In Biologie hatten wir einmal draußen Unterricht. Wir betrachteten die Pflanzen im Garten des Maierhofes, wo sich die Zimmer der Patres und der anderen Ordensleute befanden. An diesem Tag plauderte ich etwas intensiver mit Thomas, vor dem ich am ersten Tag so Angst hatte. Wir verstanden uns sehr gut und wurden Freunde. Die meiste Zeit verbrachte ich aber mit Guido.
Es war schon die vierte Schulwoche, als wir zum ersten Mal Spaß mit den externen Schülern hatten. Isabell Landl schrieb auf gelbe Klebezettel Sprüche wie „Du dumme Sau“ oder „Du blöder Affe“. Diese Zettel klebten dann auf den Rücken einiger Mitschüler, die diese wieder jemand anderen auf den Rücken klebten. Guido riss sich gerade einen Zettel mit der Aufschrift „Ich bin so blöd“ vom Rücken und überlegte, wer sein nächstes Opfer sein könnte. Er stand am Katheder des Lehrers und beobachtete die Klasse. Seine Hand mit dem Zettel hatte er unbewusst am Katheder. Nikola, die stellvertretende Klassensprecherin, sah Guido und rief im Eifer ihres Amtes: “Habt Ihr das gesehen, Guido klebt den Zettel „Ich bin so blöd“ auf den Katheder von Frau Professor Söllinger!“ Sie drohte ihm: „Guido, das melde ich!“ Der Klassensprecher Christof Bauer war auch dafür, es zu melden, dass Guido die Söllinger für blöd hält. Es war offensichtlich, wir hatten bei der Klassensprecherwahl schlecht gewählt. Seither gab es eine Kluft zwischen den Externen- und den Internatsschülern.
Als nach der Pause die Söllinger hereinkam, stürmten Christof Bauer und Nikola nach vorn zum Katheder und berichteten: “Frau Professor, der Guido hat einen Zettel auf Ihren Tisch gelegt, auf dem steht, dass Sie blöd sind!“ Sofort zog Nikola den verhängnisvollen Zettel aus ihrer Hosentasche und reichte ihn der Söllinger. Der Klassensprecher und Isabell bestätigten den Vorfall. Die Söllinger richtete ihren tötenden Blick auf Guido und fällte sogleich das Urteil: “Guido, Du bekommst eine Mahnung nach Hause geschickt!“ Sie wurde etwas lauter und fügte hinzu: „Bei der dritten Mahnung wirst Du von der Schule gegangen!“ Den Ausdruck „von der Schule gegangen“, hörten wir noch öfter in diesem Schuljahr.
Wir hatten unseren ersten Skandal in der Klasse! Der völlig unschuldige Guido musste sich schrecklich gefühlt haben. Er hat vor Angst keinen Ton von sich gegeben, auch weil ihm die Söllinger keine Gelegenheit dazu gab. Ahnungslos, wie es sich wirklich zugetragen hatte, unterschrieb der Direktor Pater Biregger die Mahnung. Diese Ungerechtigkeit sollte nicht die Einzige bleiben für den armen Guido. Die Eltern, die so eine Mahnung bekamen, mussten denken, aus ihren Kindern sind kleine Monster geworden. Es wurde monatlich ein Internatsbericht über unser Verhalten an die Eltern verschickt, der voller Übertreibungen bezüglich kindlicher Streitigkeiten war. Ich bekam deswegen oft Probleme mit meinem Vater, da ich so ein schlimmes Kind geworden bin.
Es war Anfang Oktober und man spürte, dass der Sommer endgültig zu Ende war. Wir konnten die Abendfreizeit nur noch drinnen verbringen. Jetzt, da das erste Schulmonat zu Ende war, durften wir endlich von der Indoor-Telefonzelle nach Hause telefonieren. Voller Freude nutzte ich das und rief jeden Tag nach dem Mittagessen meine Mutter an. Endlich durften auch wir ins zehn Minuten entfernte Geschäft, um einzukaufen. Der Greißlerladen „Pucher“ war der beliebteste Treffpunkt in der Vier-Uhr-Freizeit. Der alte Pucher hatte die Buben gerne und quatschte lange mit uns. Es fiel ihm auf, wenn einer länger nicht kam, und er fragte, ob derjenige krank ist. Guido und ich machten uns in der Freizeit auf, den Dachsberger Wald zu erkunden. Die anderen spielten meistens Fußball oder Tennis.
Im Sportunterricht mussten wir am Beginn jeder Stunde weit joggen. Es wurde immer kälter, und das Joggen wurde unerträglicher. Schließlich mussten Guido und ich wegen der Kälte unsere Spaziergänge im Wald einstellen. Eigentlich war es einfacher, drinnen zu spielen, denn wir mussten jedes Mal die Erlaubnis des diensthabenden Präfekten einholen, um draußen spazieren oder einkaufen zu dürfen. Am meisten Spaß machte uns das Fangenspielen auf den langen Gängen. Dabei fassten wir saftige Strafen aus, wenn wir erwischt wurden.
Schloss, Schule und Internat Dachsberg mit dem Maierhof 1985
Der Tagesablauf im Internat war bereits Routine geworden:
06.15: Aufstehen
06.35: Morgengebet, Morgenstudierzeit oder Besuch der Heiligen Messe
07.10: Frühstück
07.30: Gebet, Schulbeginn
13.05: Gebet, Mittagessen, Dankgebet
13.35: Beginn der Freizeit oder Nachmittagsunterricht
14.30: Gebet, Nachmittagsstudierzeit
16.10: Zweite Freizeit und Möglichkeit im Speisesaal Mitgebrachtes zu essen
17.30: Studierzeit
18.30: Abendessen
18.50: Freizeit
19.30: Abendstudierzeit
20.00: Abendgebet in der Kirche, danach Bettruhe
Mittwochs war es Pflicht, abends die langweiligen und in die Jahre gekommenen Kinofilme von Pater Prinz anzusehen.
Die Studierzeiten wurden uns schon zu kurz, um mit dem Lernen des Stoffes durchzukommen. Wer in der Studierzeit flüsterte, musste eine Seite Lesebuch abschreiben. Wenn man auf die Toilette musste, war die Erlaubnis der Aufsicht einzuholen.
Von den älteren Internatsschülern wurden spezielle Handzeichen, wie zum Beispiel das Hochstrecken des Mittelfingers, der sogenannte „Fuck-Finger“ verwendet. Auch mein Jahrgang praktizierte immer mehr diese sexuelle Zeichensprache. Ich konnte diesen „Fuck-Finger“ lange nicht richtig zeigen, weswegen mich die anderen auslachten. Ich wusste einfach nicht, welchen Finger ich als „Mittelfinger“ hochzeigen sollte.
Am Nachmittag ging ich den Gang entlang zum Speisesaal. Ein Zweitklassler kam mir entgegen. Blitzartig griff er in meine Körpermitte und drückte zu. Der Schmerz war unerträglich, und ich bekam kaum Luft. Er ging einfach weiter. Ich stand da wie angewurzelt und konnte nicht begreifen, was gerade geschehen war. Mein Herz pochte heftig, und ich zitterte am ganzen Körper. Immer noch spürte ich den Druck in meinen Genitalien. Warum hat er das getan? Ich konnte es nicht verstehen. Ich gab ihm doch überhaupt keinen Anlass dafür. Noch nie zuvor wurde ich so berührt. Ich fühlte mich allein und hilflos. Etwas wurde mir gerade gestohlen, und ich hatte Angst. Ich wusste nicht, dass man Menschen auf diese Art berühren kann!
Auch andere machten das mit mir. Obwohl ich erst zehn Jahre war, musste ich das Zusammendrücken meiner Genitalien von älteren Internatsschülern mehrmals täglich ertragen. Das wurde „Ausgreifen“ genannt. Mit der Zeit wurde es sogar normal für uns, und einige aus meinem Jahrgang praktizierten es selber. Meldungen an die Präfekten brachten leider keine Besserung der Situation.
Christian lief den Gang entlang auf unser Zimmer zu. Ich wollte ihn mit meinem ausgestreckten Arm erschrecken. Er landete allerdings mit seiner Körpermitte genau in meiner Faust. Er krümmte sich vor Schmerz. Aber wegen des „Ausgreifens“ war dieses Missgeschick nichts Ungewöhnliches für ihn. Mir war es zwar peinlich, aber ich entschuldigte mich nicht. Wir verhielten uns, als sei nichts geschehen.
In den Nächten, wenn wir zu wach zum Schlafen waren, machte hin und wieder jemand eine „Strip-Show“ zum Spaß der anderen. Manchmal entblößten wir uns alle fünf im Zimmer und betrachteten uns nackt. Nun waren wir also in der Pubertät. Ich kannte dieses Wort vorher gar nicht, aber dieses Thema wurde jetzt im Biologie-Unterricht von Professor Zimmerer behandelt. Meine Kindheit war zu Ende, das fühlte ich eindeutig.
Aufklärungsunterricht brauchte ich aber keinen mehr. Seit ich im Alter von acht Jahren die TV-Serie „Dornenvögel“ gesehen hatte, wo sich ein junges Mädchen in einen Priester verliebte, hatte ich meine eigenen Vorstellungen von Sex. Die hatte ich dann stolz mit meinen Freunden geteilt, die diese Serie nicht sehen durften. Es war allerdings völlig falsch, was ich mir unter körperlicher Vereinigung vorstellte. Ich war mir damals sicher, ich hatte das Geheimnis gelöst, wie es zur Empfängnis kommt.
In den Sommerferien, bevor ich ins Internat kam, gab mir meine Mutter ein Aufklärungsbuch zu lesen. Alle meine romantischen Vorstellungen waren dahin, und ich musste die schockierende Realität zur Kenntnis nehmen. Ein persönliches Gespräch mit meinen Eltern hätte geholfen, aber die zogen es vor, das einem Buch zu überlassen.
Im Internat waren auch nicht gerade harmlose Schimpfwörter in Gebrauch. Eigentlich kann man sie nur als pervers bezeichnen. Einigen Schülern wurden solche Spitznamen verpasst, die ihnen bis zum Ende ihrer Schulzeit erhalten blieben. Lehrer und Erzieher hörten manchmal davon, nahmen es zur Kenntnis und ignorierten es. Von einigen mutigen Internatskollegen wurde ihnen immer wieder das „Ausgreifen“ gemeldet. Unternommen dagegen wurde von den katholischen Priestern, die unsere Erzieher waren, aber nichts. All diese Unannehmlichkeiten gehörten nach einiger Zeit auch für mich zum Alltag. Ich dachte, man sollte wenigstens beim Besuchen der Toilette seine Ruhe haben. Es war wieder ein Zweitklassler, der sich auf die Trennwand zwischen die Toiletten hängte und mir in meiner Kabine dabei zu sah.