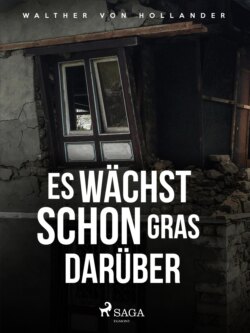Читать книгу Es wächst schon Gras darüber - Walther von Hollander - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLangsam begann es zu regnen. Aber es blieb warm. Die Wolken krochen dicht über die Ruinen, die den Bahnhofsplatz säumten, und es wurde sehr dunkel. Die zwei- oder drei- oder viertausend Flüchtlinge, die auf Säcken, Kisten, Koffern oder auf den wenigen rohgezimmerten Bänken des Platzes gehockt hatten, nahmen ihr Gepäck auf und schoben sich stumpf durch die Eingänge in die Bahnhofshalle hinein. Da aber diese Halle nur mit einem Gerippe aus verbogenen Eisenträgern überdacht war, regnete es auch hier hinein, und so sickerte der zähe, lehmgraue Fluß der Flüchtlinge und Vertriebenen tiefer in den Bahnhof, um in den spärlich erleuchteten Gewölben unter den Bahnsteigen Schutz vor der Nässe zu suchen.
Eine halbe Stunde lang schleppten sie, zankten sich um die besseren, zugfreien Plätze, schoben ihre Kisten und Säcke, ihre Koffer und Packen zurecht. Dann saßen sie wieder stumpfsinnig oder ergeben. Die Männer stocherten in ihren Pfeifen, suchten Tabakreste aus den Taschen ihrer verschmutzten Jacken. Ein paar Frauen schwatzten eintönig. Einige kauten trübe an Brotkanten, und nur ein paar Kinder spielten unermüdlich zwischen den graugrünen Hügeln des Gepäcks Verstecken. Ihre kreischenden Stimmen übertönten hell das dunkle Gemurmel der Ermüdeten.
Paul Wolffenau hatte sich einen Platz auf der Treppe zu dem Bahnsteig ausgesucht, auf dem irgendwann einmal, vielleicht in sechs oder acht oder vierundzwanzig Stunden, ein Zug gehen sollte. Freilich hatte das nur ein beliebiger Bahnbeamter gesagt, und auch der wußte nicht, wohin der Zug gehen würde. Immerhin, wenn er nur ging, wenn man nur aus diesem verdammten Nest herauskam, in dem man schon seit sechsunddreißig Stunden festsaß.
Wenn der Zug südwärts ging, so würde er Jochen aufsuchen, vorausgesetzt freilich, daß Jochen noch lebte, daß er schon zurück war. Aber wenn er nicht zurück war, würde vielleicht Lena da sein, seine Frau. Ganz bestimmt würde sie da sein! Sie verteidigte mit Klauen und Zähnen das winzige Haus, den Rosengarten, die Möbel, die Meißner Tassen und die Ahnenbilder. Aber vielleicht ging der Zug auch nach Norden. Ebenso recht. Da konnte er erst mal bei den Larsens unterschlüpfen. Die hatten ihr Landhaus bei Hamburg mit dem Blick über die majestätische, in Trümmer eingefaßte Elbe mit den spärlichen Fischdampfern, die da schon wieder aus- und eingehen mochten. Oder der Zug ging nach Westen. Nein, bitte nicht. Denn dann würde er sich verpflichtet fühlen, seinen Vater aufzusuchen. Paul I., wie er ihn nannte. Dann schon lieber nach Nordwesten zum großväterlichen Schloß nach Holstein, zur Mama, die sich gern noch immer die „schöne Mossigny“ nennen ließ. Er sah sie neben ihrem Vater, dem mürrischen alten Grafen Mossigny, im Biedermeiersalon sehr gerade auf den unbequemen Stühlen sitzen, ein Buch vor sich, dessen Inhalt sie in vornehmer Distanz wohl kaum zur Kenntnis nahm, oder über das Haushaltsbuch gebeugt, das sie mit ihrer kleinen, zierlichen Schrift sorgsam führte und das doch nie stimmte. Er sah sich eintreten. Sie hob den Kopf, lächelte ihm höflich und freundlich zu und sagte mit ihrer klagenden und klangvollen Stimme: „Ah, da bist du ja, Paul. Gedulde dich einen Moment. Ich habe ein kleines Defizit. 106 Mark. Das muß doch herauszukriegen sein.“ Aber es war nicht herauszukriegen. Nein ... er würde also nicht nach Norden und Westen und nicht nach Nordwesten fahren. Und nach Osten auch nicht. Denn da kam er ja gerade her. Wohin also?
Wolffenau setzte sich seufzend auf seinen Rucksack, der prall gefüllt und nachgiebig wie ein Kissen war. Angenehm, einmal weich zu sitzen. Aber es wurde jetzt kühler. Er knöpfte das bunte türkische Seidenhalstuch fester, klappte den Kragen des Regenmantels hoch und schob den Hut in den Nacken. Man konnte jetzt das gelockte, etwas drahtige, schwarze Haar sehn und seine merkwürdig hellen blauen Augen. Noch den Koffer zwei Stufen tiefer zurechtgerückt und als Fußschemel benutzt! So. Nun saß es sich ganz gemütlich.
Noch eine Pfeife? Er begann in seinen Taschen zu kramen. Der Teufel mochte wissen, wo sich wieder der Tabaksbeutel verkrochen hatte. Brieftasche, Taschentuch, Messer, ein kleines goldenes Salzlöffelchen mit dem Wappen der Mossignys, einem Greifen mit gierig gespreizten Krallen (ein Hochzeitsgeschenk der Mama), das Feldbesteck, Löffel und Gabel in einem, blechern und etwas verschmutzt von der letzten Flüchtlingssuppe, die mit Leukoplast bandagierte Pfeife, das runde Feuerzeug, blitzblank und für dreißig Mark soeben auf dem Schwarzen Markt vor dem Bahnhof erworben, eine bunte Kette aus indischen Halbedelsteinen, der Pfeifenstopfer und endlich der Tabaksbeutel, speckig glänzend und verdammt mager. Wolffenau hatte den Tascheninhalt neben sich auf die Stufen geschichtet, reinigte umständlich die Pfeife und stopfte sie langsam und sorgfältig. Ein bärtiger zerlumpter Mann blieb neben ihm stehn und sah ihm mit gierigen Augen zu. Paul blickte auf und hielt ihm den Beutel hin. Der Bärtige bediente sich blitzschnell und gewandt. Dabei begann er seine Leidensgeschichte herunterzuleiern. Von einem Kolonialwarenladen im Osten, dem ersten am Platze, mit blitzenden Scheiben und vollgestopften Auslagen. Spezialität: Schnäpse und Liköre aller Art. Zweihundert Flaschen lagen noch eingemauert und von niemandem zu finden unter den Trümmern. Ein Kapital heute, wenn man nur herankönnte. Von einer Wohnung, ganz modern eingerichtet mit spiegelnden Hölzern und einem riesigen Kristallüster im Speisezimmer, den man beim Brande klirrend hatte herabfallen hören. Von seiner Frau, die noch vor zwei Jahren lustig, schön und elegant war, und jetzt saß sie zerlumpt und alt, immer weinerlich, mit Tränensäcken unter den Augen, da hinten zwischen den anderen aus der Stadt, kaum zu unterscheiden von den Grünkramhändlerinnen, mit denen sie früher kein Wort gesprochen hätte.
Paul hielt ihm das Feuerzeug hin. „Ja“, sagte er abschließend, „so ist das.“ Wie viele Schicksale hatte er in den letzten fünf Tagen aufgeblättert gesehn, vergleichsweise harmlose wie das dieses Kolonialwarenhändlers und schauerliche, die man am besten gleich wieder wie Herbstlaub ins Vergessen hinuntersinken ließ, um damit das eigene Schicksal zuzudecken. „Schauderhaft“, sagte er abwesend und abweisend und steckte nun auch seine Pfeife in Brand. Das neue Feuerzeug funktionierte wirklich tadellos! Der Bärtige blieb noch eine Weile höflich wartend stehn, in der untertänig vertraulichen Haltung, mit der er früher seine prima Liköre und Schnäpse angeboten hatte. Dann kletterte er die Treppe hinab und verschwand im Halbdunkel des Gewölbes.
Wolffenau packte seine Sachen wieder in die Taschen. Die bunte Halbedelsteinkette behielt er einen Augenblick in der Hand. Es war ein Geschenk Cassemberts, des großen belgischen Architekten, seines Lehrers, an Gertie, seine Frau. Vielleicht fuhr er zu Cassembert nach Genf. Er lachte. Ein wahrhaft abwegiger Gedanke! Ein Deutscher, der in die Schweiz fahren wollte! Wie viele Behörden, ja wie viele Regierungen hätte man fragen müssen! Nein — alle Deutschen waren in Deutschland als in einem riesigen Gefängnis gefangengesetzt und warteten, geduldige und hoffnungslose Angeklagte, auf ihr Urteil. Er drehte bei diesen Gedanken die Kette wie einen Rosenkranz. Die gelben, mattroten und rauchblauen, roh geschliffenen Steine glänzten in dem Gefängnislicht, das von einer trüben Lampe über der Treppe ausging. Mechanisch knüpfte er das Schloß und betrachtete gedankenlos die Rundung. Plötzlich fiel ihm ein: So schmal war Gerties Hals. Dies war genau sein Maß. (Wie oft abgemessen!) Auf dem ponte vecchio in Florenz lag, genauso groß, eine Korallenkette in einem schäbigen Schaufenster. Gertie wollte jede Kette haben. Wie viele besaß sie? Fünfzig? Hundert? Alle verloren! „Das Korallenkettlein ist für dich gemacht“, sagte er zu Gertie. Er ging mit ihr in den Laden. Es roch nach Öl, nach Fisch und in Käse gebackenen Tomaten. Er nahm dem geschwätzigen Händler die Kette aus der Hand und legte sie Gertie um den Hals. „Du siehst ... ich kenne dich ganz genau“, sagte er stolz. Und Gertie lächelte ein wenig unsicher. Halb stolz, halb ertappt. „Wieso kennst du mich?“ Sie hatte es gern, geheimnisvoll zu sein, und fast noch lieber, wenn man ihr hinter ihre kleinen Geheimnisse kam.
„Also lüge in Zukunft vorsichtiger“, lachte Paul damals in Florenz. Er hatte es ganz leichthin gesagt. Aber als sie errötete, wurde er einen Augenblick mißtrauisch. Da war dieser windige Brasilianer mit dem Oliventeint. Conte Silverspoon nannten sie ihn oder auch Graf Silberlöffel, weil er immer silbergrau gekleidet war von oben bis unten, Anzug, Krawatte, Hemd, Schuhe. Wie hieß er? Vergessen. Aber vielleicht hatte Gertie doch mehr Spaziergänge mit ihm gemacht, als sie eingestand, vielleicht ... Ach, wie einerlei! Die Korallenkette war längst verbrannt, und diese Kette, die gerettet war ... Er schob sie schnell zusammen und steckte sie in die Tasche. Sein Gesicht zeigte, als er jetzt seine Pfeife von neuem in Brand steckte, einen kühlen, gleichgültigen Ausdruck. Er war auch kühl und gleichgültig. Er hatte es sich ja vorgenommen. Er haßte die Exaltierten, die immer Aufgeregten, die in ihren Gefühlen Wühlenden, die in der Liebe Maßlosen, die dann auch maßlos haßten. „Das ist ja alles nur halb wahr“, pflegte er früher zu sagen. „Die Leute finden es nur sehr großartig, großartige Gefühle zu haben. Was sie in Wirklichkeit empfinden ... du lieber Himmel ... gar nichts ... armselig ... wenig ...“ Und was empfand er nun wirklich nach den schauerlichen Erlebnissen in Berlin? Was hatte er empfunden? Ach — wozu darüber nachdenken! Erstens steht es nicht ganz fest, ob man sich an frühere Empfindungen überhaupt richtig erinnern kann. Denn wenn man es in Worte einfängt, ist es schon einen verfälschenden Umweg gegangen. Und zweitens: es war ja ganz einerlei, was er vor ein paar Tagen, aufgeregt durch die Endgültigkeit, die Bildhaftigkeit des Entsetzlichen empfunden hatte. Es kam vielmehr darauf an, was er jetzt, in dieser Sekunde, noch empfand. Dann konnte man eher ermessen, was daraus werden würde, was aus ihm also werden würde. Ob er es überwinden konnte. Was hieß denn das? Er saß doch hier, ganz behaglich sogar, und rauchte eine Pfeife, die ihm wundervoll schmeckte. Hatte er also nicht schon überwunden? War nicht alles ganz schön grau und leer, wie eine Wand, an die man wieder die bunten Bilder neuer Erlebnisse hängen konnte, die man in der trostlos grauen Gegenwart mit Erinnerungen schmücken durfte? Erinnerungen? Nein ... lieber nicht. Dann Sehnsüchte? Wozu dieser Backfischausdruck! Wünsche? Was wünschte er? Im Augenblick fiel ihm nichts ein. Doch ... ein wenig schlafen. Der Zug kam noch lange nicht. Schlafen. Er neigte den Kopf und schlief sofort ein.
Im Traume kam natürlich, was er im Wachen noch abgewehrt hatte. Der kleine Weg im Dahlemer Garten dehnte sich nur ins Unendliche und endete im Trüben, in dem Gewölbegang des Bahnhofs. Aber vorn die Rosenpergola war da, genau wie er sie vorgefunden hatte, die eine Hälfte vom Brande angesengt und jetzt erst mit wilden Trieben wieder emporwuchernd, die andere aber von einer wahren Kaskade von kleinen rosa Rosen überschäumt. Dahinter sah man nur undeutlich die Ruinen des völlig zusammengestürzten Hauses. Vor vierzehn Tagen, als er in Berlin angekommen war, nach den Mühen des Rückmarsches, nach den Wochen des Dösens im Kral, dem Gefangenenlager bei Stuttgart, in dem er sich überhaupt nicht bemühte freizukommen, weil er ja wußte, daß Gertie tot war, das Dahlemer Haus, sein bestes Werk, die witzigste Architektur, die ihm je eingefallen war, vernichtet ... damals ... vor vierzehn Tagen also, als er „heimgekommen“ war, um sich endlich das anzuschauen, was er sich immer wieder vorgestellt und doch nie begriffen hatte, damals war er langsam schlendernd auf das Haus zugegangen. Aber jetzt im Traum wagte er sich nicht weiter. Denn er hörte Gerties Schritte, die leisen hochhackigen Schritte im Kies, und nun kam sie auf ihn zu und stand unter der Pergola still, eine Hand an den ausgeglühten, halb zerschmolzenen Stäben der Pergola. Sie war seltsam gekleidet. Zur Hälfte nämlich in ihren rosa Morgenrock aus durchsichtigem Chiffon. Aber die andere Hälfte war versengt und hing in braunen Lappen über die Haut. Die Haut wiederum war unverletzt, schimmerte weiß mit einem abendlichen Widerschein von rosa. Sie stand lächelnd, ein wenig schuldbewußt, wie sie immer gewesen war, und sagte zwitschernd: „Alles futsch, Paul. Aber ich kann nichts dafür. Es ist eben so.“ Und als er nichts antwortete, setzte sie seufzend hinzu: „Du wirst natürlich böse sein. Kann ich nicht ändern. Außerdem bringst du es ja doch wieder in Ordnung. Nicht wahr?“ Paul lachte. „Ist schon in Ordnung. Da.“ Und er bückte sich zu seinem Rucksack und hob ihn triumphierend auf. „Da ist alles drin. Wäsche, Kleider, dein Gabardine-Kostüm, dein kirschrotes Complet. Ich habe doch deinen Koffer ausgegraben.“ „Danke“, sagte Gertie, ohne das Gesicht zu verziehn. Damit ärgerte sie ihn immer, daß sie nie zeigte, wenn sie sich wirklich freute. Er sollte es raten, und wenn er es nicht riet, liebte er sie eben nicht. „Danke, und nun such’ noch den Schuhkoffer. Er muß da auch noch irgendwo liegen.“ Endlich konnte sich Paul in seinem Traum bewegen. Er lief auf sie zu, um sie zu packen und „wegen Frechheit“ zu verhauen. Aber sie war verschwunden, und er stand vor den Trümmern und hatte einen Spaten in der Hand. Die Spitzhacke lag daneben, und er grub vorsichtig. Der Schutt war bereits im Zerfallen, und es wuchs schon Gras darüber. In einer Ecke blühte sogar Fingerhut, digitalis. Gut gegen Herzschmerzen. Vorsichtig hob er die grüne Schicht ab, grub den Mörtel heraus, nahm die Spitzhacke und — im Traum ging das schneller, als es vor drei Wochen im Dahlemer Garten gegangen war— legte bald den Eingang zum Keller frei. Noch zwei Stunden Arbeit und er würde hineinkriechen können. Er sah schon die Rippen des Gewölbes, das nun Gerties Grabgewölbe geworden war. Er hieb wütend auf die Steine, daß die Funken sprühten — der Rücken schmerzte ihn. Und er wachte auf.
Er sah hinauf und stellte fest, daß es noch ganz dunkel war. Er hatte sich den Rücken an der Kante der Steinstufe schmerzhaft gerieben. Er nahm seinen Rucksack, legte ihn als Kissen hinter den schmerzenden Rücken. Jetzt fiel ihm der Traum wieder ein. Ja ... im Wachen konnte er seine Gedanken beherrschen, konnte von Dahlem wegdenken, konnte stundenlang alles Vergangene vergessen. Als ob es Gertie nie gegeben hätte, als ob sie nicht verbrannt und erstickt wäre, vier Wochen vor dem Waffenstillstand. Am Nachmittag noch hatte sie einen ganz heiteren, komischen Brief geschrieben, daß Bomben sie bestimmt nicht totkriegen würden, nachdem sie nicht einmal an Pauls Gefühllosigkeit, an seiner maßlosen Kälte und Herrschsucht, an seinem verdammten und überflüssigen Hineinrennen gestorben sei. „Paul der Erste hätte Dich zähneknirschend reklamiert, wenn ich ihn gebeten hätte, und ich habe ihn sogar heimlich gebeten, und man wird Dich telegraphisch herausholen, und Du wirst Deine verdammte Pflicht und Schludrigkeit tun und Dein Weib schützen einschließlich Heim und Herd.“
Das war also ihr letzter Brief, und am Abend dieses Tages war sie zusammen mit der dicken Köchin Minna und deren Soldaten verschüttet und verbrannt, und niemand hatte nachgegraben, niemand sich bis zu diesem August 1945 darum gekümmert, wo Gertie geblieben war. Er selbst aber? Nun, er hatte gegraben und gehackt. Regierungsrat Dittmoser von nebenan hatte ihm geholfen. Er hatte Zeit. Es gab keine Regierung, und er stand sicher auf irgendeiner schwarzen Liste, war auch mal verhaftet worden und erzählte, während sie gruben, von seinen Leiden und von seinen dunklen Zukunftsaussichten, bis er ihn fortschickte. Denn bald mußte er Gertie finden, und da wollte er allein sein. Weg, weg damit. Er hatte sie nicht gefunden. Er war nur auf einen Soldatenstiefel gestoßen, der dem Schatz der dicken Minna gehört haben mußte, auf das Häubchen der Köchin. Nein ... dann hatte er es aufgegeben und hatte die Koffer geöffnet, die im Vorkeller gestanden hatten. Der graue Flanellanzug stammte daher, den er jetzt trug, die drei Hemden, die er besaß, die beiden hübschen Paar Schuhe ... kurzum, die Ausrüstung, die Gertie für ihn zusammengestellt hatte, wenn sie zusammen als Bettler auf die Wanderschaft würden gehn müssen. Und im anderen Koffer waren Gerties Sachen gewesen. Warum hatte er die eingepackt — die Wäsche, die Sommerkleider, das Gabardine-Kostüm und das kirschrote Complet? Die füllten nun den prallen Rucksack, auf dem er lag, und der leise Duft von Chypre war nicht auszulöschen.
Zwei Stunden mochten vergangen sein, vielleicht waren es auch drei. Vielleicht auch nur zwanzig Minuten. Das eine nämlich hatte Wolffenau wie so viele in dieser Zeit gelernt, die Zeit für nichts zu erachten, sie gar nicht zu fühlen, sie an sich herabrinnen zu lassen wie Landregen, den man ja auch nicht abstellen, nicht schneller oder langsamer verströmen lassen kann. Die Zeit, früher kostbar, karg zugemessen, genau eingeteilt auf einem Kalender, den das dicke Fräulein Bröse, seine Privatsekretärin, halbstundenweise ausfüllte, diese Zeit war nun seit Jahren im Überfluß vorhanden. Auf den unendlichen Fahrten durch Rußland bis dicht an die Vorberge des Kaukasus, am Steuer des großen LKW, auf den gefährlichen Fahrten im Westen, die von den heulenden, tackenden Schwärmen der Jabos begleitet waren, und später im Kral unter den Gesprächen über Essen, Hungern, Frauen und die Ungewißheit der Zukunft ... da war die Zeit soviel wert wie ein Tausendmarkschein in der Inflation. Man konnte ihn einwechseln, einteilen. Der Teil war so wenig wert wie das Ganze. Man konnte nichts anderes mit der Zeit anfangen, als sie verrinnen lassen, nachdem man eine Zeitlang sich noch bemüht hatte, zu glauben, daß dieses Fahren und Warten, Warten und Fahren nur ein vorübergehender Zustand sei, nachdem man sich im ersten Jahr oder im zweiten noch knirschend gegen die Zügel gebäumt hatte, die das Schicksal allen Männern gleichmäßig angelegt hatte, den Dummen wie den Klugen, den Geschickten wie den Ungeschickten, den Fügsamen wie den Wilden, den Abenteurern wie den Kassenrendanten. Die Zeit verrann, und man ließ sie über sich hinrinnen. Man spürte sie nicht mehr. Es war ganz gleichgültig, ob es Montag war oder Donnerstag, ob Februar oder Juni. Die Sonne stieg an und versank wieder. Die Bäume ergrünten und warfen die Blätter ab. Blumen, einst kunstvoll mit liebender Hand in die Gärten der Ukraine oder der Normandie gepflanzt, zur Augenweide am Feierabend — sie blühten unbeachtet in einem tapferen Kampf gegen das wuchernde Unkraut, blühten und blühten ab, nachdem die Besitzer der Gärten längst vertrieben waren oder tot und ihre Häuser zertrümmert oder verbrannt waren. Die Zeit rann und verrann, und man konnte nur leben, indem man sich ihrem Zerrinnen nicht widersetzte, indem man sie nicht mehr fühlte, indem man sich schließlich stundenweise, ja tageweise aus seiner Existenz herausschlich, abwesend war, gefühllos und pflanzenhaft vegetierte. Kam man dann zu sich zurück, dann freilich mochte es sein, daß plötzlich alle Schmerzen wieder da waren, alle Ungeduld die Nerven zerbiß und die Wut auf die Welt, auf die Großen der Erde, auf das blödsinnige, unsinnige Schicksal sich in lächerlichen Ausbrüchen austobte, wegen einer zu dünnen Schnitte Brot etwa, oder weil der Leutnant Siemers noch eine Zigarette hatte, oder weil man das stumpfsinnige, unrasierte, landstraßengraue Gesicht des Nebenmannes einfach nicht mehr ertragen konnte. Dann gab es noch zwei Möglichkeiten. Entweder man gab diesen zwecklosen Ausbrüchen nach und bekam schließlich einen Nervenknacks, oder man zähmte sich und ergab sich endgültig und hatte damit den Zugang zur großen asiatischen Geduld, zur orientalischen Apathie gefunden.
Wolffenau gehörte zu den Geduldigen. Und als er jetzt zu sich zurückkehrte, kaum wissend ob er geschlafen hatte, waren in der Tat vier Stunden vergangen. Das Gefängnislicht auf der Treppe wurde ausgelöscht, und die erste graue Dämmerung sickerte langsam über die Stufen nach unten. Er sah sich um. Es hatten sich viele der reisenden Flüchtlinge aus den kellerartigen Gewölben auf die Stufen geflüchtet. Wahrscheinlich war unten das Gedränge unerträglich geworden. Rechts über ihm lag ein Bein in einem Soldatenstiefel. Das andere Bein des Schläfers fehlte. Die graue, schmutzige Hose war mit einer Sicherheitsnadel über dem Knie zusammengeheftet, die beiden Krücken mit den halben Rundungen für die Arme und den lederbezogenen Griffen wirkten daneben fast elegant. Jetzt sah Wolffenau, daß der Mann mit seinem Kopf im Schoße einer breithüftigen Frau lag. Die Frau hatte in ihrem rechten Arm ein etwa dreijähriges, engelhaft schlafendes Kind mit verschwitzten Löckchen. Mit der linken Hand streichelte sie langsam und feierlich das struppige Haar ihres Mannes. Ließ sie mit Streicheln nach, so wachte der Mann auf, lächelte ihr zu und schlief sofort wieder ein, wenn sie das Streicheln fortsetzte. Man sah: sie hatten sich erst seit wenigen Tagen wiedergefunden, und ihr Zusammensein machte sie glücklich im Haufen der Elenden und in ihrem eigenen Elend.
Die Frau mochte wohl fühlen, daß Wolffenau sie beobachtete. Sie blickte flüchtig auf, lächelte etwas verlegen, als müsse sie sich wegen ihres Glückes entschuldigen, und beugte sich wieder über den schlafenden Mann. Jetzt erst bemerkte Wolffenau, daß neben ihm eine junge Frau lag, die ihren Kopf gegen seinen weichen Rucksack gebettet hatte und in einen Schlaf kraftloser Erschöpfung versunken war. Sie mochte wohl zu anderen Zeiten eine Schönheit sein. Der Mund, mit Spuren von Rouge, war sehr klein, die Nase zierlich. Die Augenbrauen, ehemals ausrasiert, wuchsen ein wenig wild. Das Gesicht, rundbogig, mit etwas heraustretenden Backenknochen und grauen Schattentälern des Kummers, der Einsamkeit und der Entbehrungen unter den Augen, war eingerahmt von einem hellblauen, kunstvoll und straff geknüpften Kopftuch. Sie war in ein hellgraues Kostüm gekleidet, das nicht mehr ganz sauber war, mit einem Trenchcoat darüber, der von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Ihre sehr kleinen Füße steckten in zerschlissenen Seidenschuhen. Die Hände, die sie gefaltet hielt, hatten rote Nägel, von denen der Lack zum größten Teil abgesprungen war. Am Ringfinger trug sie einen Trauring und einen Schlangenring mit einer kostbaren Perle. Wolffenau studierte sie so genau, nicht eigentlich aus Interesse, sondern weil er von Natur und Übung her und von Berufs wegen eben ein Augenmensch war, gewohnt, jede Einzelheit sofort zu registrieren und aus tausend Einzelheiten im Augenblick das Gesamtbild zu haben. Er stellte sich ihr früheres Dasein vor: Verwöhnt, von vielen Männern begehrt, kleiner Sportwagen mit blauem Leder vor dem Haus. Eine gute Tennisspielerin vielleicht, ein gepflegter Fünf-Zimmer-Haushalt irgendwo in der Vorstadt mit viel unnützem Zeug, Porzellankatzen auf hellen Vitrinen, Füllen aus Ton von der Renée Sintenis, großen Vasen auf den Teppichen, in die sie jeden Morgen die Blumen ordnete. Ein gutes, älteres Dienstmädchen, das sie in ihrer hochmütigen Art gut versorgte und in Distanz hielt. Ein behütetes, angenehmes, warmes Leben, etwas ziellos, ziemlich sinnlos, voll kleiner Spannungen, die sich zumeist um den Mann konzentrierten, zuweilen aber auch um irgendwelche hübschen, gutgekleideten Tennisspieler, trefflichen Tänzer, brillanten Autofahrer, berühmten Schauspieler, die im Hause aus- und eingingen. Und dann dieser Krieg. Erst ferne. Dann näher am Herzen, weil der Mann fortmußte. Dann mit den grollenden Flugzeugen, den pfeifenden Bomben bis ans Haus getragen. Dann das ferne Brummen der Front und die ersten Abschüsse, die man nachts schon leuchten sah. Dann Flucht, zuerst noch mit Koffern, schließlich ohne irgend etwas. Ja ... sie trug ihre ganze Habe in einer Art Jagdtasche mit sich, deren Riemen sie über die Schulter gelegt hatte.
Wolffenau unterbrach ärgerlich seine sinnlosen Betrachtungen. Warum beschäftigte er sich mit dem Schicksal dieser Frau? Nur weil sie seinen Rucksack als Kopfkissen benutzte? Er mußte ihr zudem die Kopfstütze jetzt wegziehn. Denn er wollte gehn. Er hatte genug von diesem Warten. Es wurde Zeit, sich aus dem Haufen der Elenden zu lösen. Gerade hörte er, wie ein Bahnbeamter erzählte, daß vorläufig an einen Zug nicht zu denken sei. Also weg! Den Rucksack genommen ... Statt dessen zog er sein Notizbuch und schrieb auf einen Zettel: „Sie schliefen so schön. Da konnte ich Ihnen das Kopfkissen nicht wegnehmen. Nehmen Sie den Rucksack als Geschenk eines unbekannten Verehrers, als eine kleine Ermunterung des Himmels. Die Sachen werden Ihnen sicher passen und bis auf das kirschrote Complet sogar gut stehn. Alles Gute.“
Dann nahm er seinen Koffer, stieg die Stufen hinab, kletterte über ein Gewirr von Beinen, Koffern, Kisten auf den Ausgang des Bahnhofes zu.
Draußen regnete es immer noch. Eigentlich, so dachte er, hätte ich lieber den Rucksack mitnehmen sollen und ihr Gerties Sachen in den Koffer einpacken. Denn so ein Koffer trägt sich viel unbequemer. Dann aber fiel ihm ein, was Gertie gesagt haben würde: „Mensch, Paul, sei manchmal ein Kavalier.“
So wandte er sich denn ganz befriedigt und bestieg eine Straßenbahn, die ihn an die Peripherie der Stadt bringen sollte. Was dann? Das war so ungewiß, wie es ungewiß war, wann je ein Zug diesen Bahnhof der Verdammten verlassen würde.