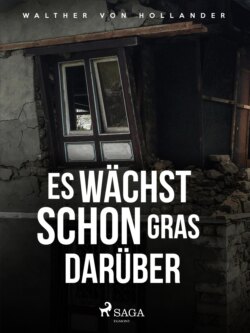Читать книгу Es wächst schon Gras darüber - Walther von Hollander - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Schloß der Mossignys, 1530 gebaut und gegen die räuberischen Banden des Dreißigjährigen Krieges mit einem breiten Graben und einer Wehrmauer aus Felssteinen geschützt, liegt auf einer kleinen Anhöhe über dem Fluß, der sich schon fächerförmig in fünf Flußarme teilt, um ein paar Kilometer weiter sich ins Meer zu ergießen. Es ist ein nicht gerade schöner Bau, massig und trutzig im altdeutschen Sinn, mit einem breiten Quaderturm an der einen Seite, von dem aus man an hellen Tagen das Meer sehen kann. Von diesem Turm aus erschoß ein Graf Eckeholm — die Mossignys erbten das Schloß erst 1850, da ein Mossigny die letzte Eckeholm geheiratet hatte — im Dreißigjährigen Krieg einen schwedischen Hauptmann, der mit Plünderern eingedrungen war, und wurde vom Turm geworfen. Von der Plattform stürzte sich um 1730 eine Eckeholm, weil ihr Liebhaber in einem Duell mit ihrem Mann gefallen war. Hier oben versammelten sich nach 1864 beim Vater des jetzigen Mossigny die Großgrundbesitzer der Umgebung, die „Eiderdänen“, die durch den Wiener Frieden zu Mußpreußen geworden waren, in nächtlichen Gelagen und wetterten in kräftigen Trinksprüchen gegen den Herrn von Bismarck und den preußischen Zwangsherrn. Hier oben spielte zu Anfang des 20. Jahrhunderts der Inspektorsohn mit den Dorfjungen Räuber und Piraten, wenn die Mossignys auf ihren monatelangen Reisen in Paris waren oder an der Riviera, in London oder in Kairo. Sie drehten dann drohend das alte Fernrohr, das ein Geschütz vorzustellen hatte, und jagten mit Katapulten, in die sie Rehposten einlegten, die Hühner, die verbotenerweise im Rosengarten vor der Schloßterrasse scharrten.
Hier spielte auch um die Jahrhundertwende Christa Mossigny, die einzige Tochter, mit ihrer Riesenpuppe Betsebel oder mit Frieda Rothart, der Försterstochter, die, rotbackig, gesund und beflissen, sich kommandieren und schurigeln ließ.
Hier gab es in derselben Zeit an den sehr seltenen heißen Tagen die sogenannten Aussichtstees der alten Gräfin Mossigny, zu denen ein Dutzend alte, vornehme Damen erschienen, keuchend von den achtzig Stufen, aber stolz, zugelassen zu sein. Die Tees waren so langweilig wie die „Kreuzzeitung“, aus der die Damen ihre Hofnachrichten sogen, die Trauungen und Geburten unter den Standesgemäßen, die Beförderungen und Auszeichnungen, um sie nun wieder von sich zu geben. Neuigkeiten, die alle schon kannten.
Später schloß man die Turmtür zu, und in den aufgeregten Zeiten zwischen den beiden Kriegen betrat niemand mehr den Söller. Sonne, Regen und Schnee gingen drüber weg. Das alte Fernrohr rostete völlig ein, zwei rote Gartenstühle, die man oben vergessen hatte, verloren ihre Farbe, vermorschten und fielen zusammen. Im letzten Krieg wurde eine Flugmeldestation auf dem Turm eingerichtet. Davon war eine Bretterbude, mit Dachpappe überzogen, zurückgeblieben.
Jetzt aber, an diesem heißen Augusttage des Jahres 1945, stand in kurzen Hosen und nackten Knien, das schneeweiße Hemd aufgeknöpft, braungebrannt und pfeifend Captain Kelley auf dem Turm, der Adjutant des englischen Generals, der sein Hauptquartier im Schloß Mossigny aufgeschlagen hatte. Kelley hatte eine Ölkanne in der Hand und ölte eifrig das alte Fernrohr. Kreischend und unwillig bewegte es sich jetzt. Langsam konnte man es auf das Meer richten. Drei, vier Fischerboote standen mit weißen Segeln auf der Wasserfläche. Sonst war nichts Bemerkenswertes zu entdecken. Kelley ölte von neuem, schraubte. Jetzt ließ sich das Fernrohr auch etwas seitlich bewegen. Er sah hindurch. Ein Motorradfahrer überquerte schnurrend, die Befehlstasche umgehängt, den sonnigen Hof. Weiter: ein paar deutsche Kriegsgefangene beschnitten die Tannenhecke. Sie arbeiteten bedachtsam und gemütlich. Weiter: die Feldsteinmauer, auf der eine Ziege angepflöckt war, um die Gräser abzuweiden, der Graben, wieder eine Hecke und dahinter ein kleinerer sonniger Platz vor dem Inspektorhaus. Dort lehnte nun der alte Mossigny, ein Seidenkäppchen auf dem kahlen Schädel, die Sonnenbrille auf der Nase, in einem Gartenstuhl, und vor ihm saß seine Tochter, eine etwa sechzigjährige Dame in einem hellen Sommerkleid. Kelley, der ein wenig Deutsch verstand, wußte, daß die Leute hier sie die „junge Komteß“ nannten. Nun — gegen den siebenundachtzigjährigen Mossigny war sie ja noch jung. In Wirklichkeit war sie nicht jünger als Kelleys Tante Jessie aus Liverpool, die niemand „die junge Kelley“ genannt haben würde. Sie war auch keine Komtesse, sondern hieß Frau Christa Wolffenau. Warum man sie also die junge Komtesse nannte, begriff Kelley nicht. Dafür verstand er wieder nicht genug Deutsch. Außerdem interessierte es ihn auch gar nicht. Langsam hob er wieder das Fernrohr. Es kreischte noch immer entsetzlich. Er beschloß, es acht Tage lang täglich zu ölen, falls man so lange hier blieb.
Noch auf zehn Schritt Entfernung konnte man den alten Mossigny für sechzig oder siebzig Jahre halten. Er lag bequem, lässig die Beine übereinandergeschlagen, gekleidet in einen schneeweißen Anzug, mit einem scharfgebundenen dunkelblauen Schmetterlingsschlips. Aber wenn man näher kam, sah man, daß das Gesicht verwittert war, durchzogen von unendlich vielen kleinen Fältchen. Seine Tochter, Frau Christa Wolffenau, die Frau des Ruhrindustriellen Paul Wolffenau, den sein Sohn respektlos Paul den Ersten nannte, konnte immer noch für eine schöne Frau gelten. Ihr Haar war bis vor kurzem mit Hilfe guter Friseure tiefschwarz gewesen. Jetzt, da bei dem Friseur der Kreisstadt das Noirin ausgegangen war, ergraute es von den Wurzeln her, was Frau Wolffenau an jedem Morgen zu vielen Seufzern über die entsetzlichen Nachkriegsentbehrungen veranlaßte.
Sie war im übrigen sehr gepflegt. Das hellblaue Sommerkleid war frisch gebügelt. Sie trug dünne weiße Seidenstrümpfe und lackrote durchbrochene Schuhe. Ihr Gesicht, gut geschnitten und etwas kantig, wurde von einer zu großen Nase beherrscht, die sie vom alten Mossigny geerbt hatte.
Der Alte hielt in der herabhängenden Rechten einen Brief, und jetzt begann er mit seiner leisen und trotzdem krähenden Stimme zu sprechen. „Er ist und bleibt hartnäckig, dein Gatte“, sagte er höhnisch, „aber — das ist nun einmal eine Grundeigenschaft der Herren von der weltumspannenden Industrie — er sieht die Wirklichkeit immer noch nicht.“ Er schob einen Augenblick die schwarze Brille auf die Stirn und sah seine Tochter mit funkelnden Fuchsaugen prüfend an.
Christa Wolffenau erwiderte seinen Blick flüchtig, dann senkte sie ihr unbewegtes Gesicht wieder auf die kleine Handarbeit, sogenannte Frivolitäten, und zog die Fäden erbittert fester. Sie kannte diese Auseinandersetzungen seit dreißig Jahren, seit dem Tage, an dem sie ihrem Vater erklärt hatte, sie werde den eleganten, lustigen, schwerreichen Paul Wolffenau heiraten.
„Der berühmte Kohlenpott“, krähte der Alte weiter, „ist endgültig zertöppert. Selbst die Herren der Ruhrindustrie können ihn nicht mehr flicken. Produktiv ist und bleibt allein das Land, wie ich das vor sechzig Jahren im Reichstag Herrn von Bismarck gesagt habe. Damals hat man mich ausgelacht, und sechzig Jahre lang habe ich unrecht gehabt, aber jetzt habe ich recht. Zurück in die Kartoffeln. Alles andere ist Quatsch.“ Christa Wolffenau antwortete klagend: „Paul sagt, ihr könnt mit euren Kartoffeln nicht alle Leute ernähren.“ Der Alte lachte: „Aber T-Träger können die Leute zum Mittag essen, vorausgesetzt, sie haben genug Kohlen, um sie weich zu kochen. Ist ja alles Blödsinn! Tatsache bleibt, wenn man eine riesige Industrie aufzieht, kriegen alle Leute entsetzlich viel Kinder. So viel, daß wir wirklich mit den Kartoffeln nicht reichen und Weizen einführen müssen, Bananen und all so’n Zeug. Und dafür müssen sie natürlich Maschinen ausführen, und wenn sie viele Maschinen ausführen, verdienen alle Leute viel Geld und kriegen noch mehr Kinder. Und eines Tages haben sie zuviel Maschinen in der ganzen Welt, und dann hauen sie sich um die Absatzmärkte, und schon ist der Schlamassel da. Ich frage dich hiermit, wozu hat unsere vielgerühmte industrielle Entwicklung geführt? Kaputtgeschmissene Städte — ist allerdings kein Schade um die meisten —, kaputtgeschossene Menschen — ist auch kein Schade um die meisten. Aber wozu erst diese Ziegelsteinmeere aufbauen, wozu erst diese Millionen in die Welt setzen, wenn man nachher doch alles kaputtgehen läßt! Willst du mir das freundlichst beantworten?“
„Ich verstehe nichts von diesen Männersachen“, sagte Frau Wolffenau ungeduldig. Dabei hätte sie ihrem Vater ganz gut mit den Gegenargumenten ihres Mannes antworten können, die sie aus vielen früheren aufgeregten Streitgesprächen zwischen den beiden Männern kannte. Aber sie wußte aus Erfahrung: das führte zu nichts. Sie wußte auch nicht, wer von den beiden recht hatte. Der Großagrarier, der nach einem Ausspruch Pauls die Welt auf „Anno Vollkornbrot“ zurückführen wollte, oder der Großindustrielle, der nach Ansicht ihres Vaters an „fortschrittlichem Blödsinn“ litt.
„Er soll sich gefälligst herscheren und seine kaputten Fabriken liegenlassen. Irgendwann werde ich schließlich doch auch mal in die feuchte Grube fahren, obwohl mein Urgroßvater hundertdrei geworden ist.“ Christa lächelte, sie mußte sich einen Augenblick einmal vorstellen, wie es sein würde, wenn Paul I. mit dem Grafen Mossigny zusammenhauste. Länger als drei Tage hatte Paul es nie hier ausgehalten. „Ich wundere mich bloß, daß die Mossignys nicht noch mit dem Holzpflug ihre Äcker bestellen“, pflegte er zu sagen. „Eisen ist doch eigentlich auch so’n modernes Teufelszeug. Und seitdem Traktoren hier über die Felder brummen, glaube ich, daß selbst die Konservativen eines Tages aussterben werden.“
„Paul ist nun mal kein Landwirt“, sagte sie geduldig. Der Alte erhob sich ächzend und ging stelzbeinig auf das Haus zu. Nach ein paar Schritten wandte er sich zurück und krähte mit sich überschlagender Stimme: „Aber er ist mein Schwiegersohn, und soviel Verstand wird er ja wohl haben, um einen tüchtigen Inspektor beaufsichtigen zu können. Außerdem, wenn er durchaus nicht will, soll er seinen Sohn herschicken. Architekten gibt’s sowieso wie Pilze nach ’m Dauerregen, und was der schon gebaut hat ... schauderhaft, höchst schauderhaft. Meine Kätner hätten sich geweigert, in den geweißten Italienerbuden zu hausen, die der Bengel da nach Berlin gestellt hat für die Verrückten des Kontinents.“
„Von Paul haben wir seit Februar nichts gehört“, sagte Christa ergeben.
Aber der Alte gab sich nicht geschlagen. „Dann wird’s Zeit, daß der Bengel sich meldet. Der Krieg ist aus. Wo treibt er sich noch herum?“ Und um weiteren Antworten aus dem Wege zu gehen, stampfte er eilig ins Haus.
Christa sah ihm mit leeren Augen nach. Sie seufzte. Zu Mittag würde sich dieses Gespräch wiederholen. Sie liebte es nicht, sich zu streiten. Am liebsten gab sie dem recht, der gerade da war. Nie hatte sie sich mit ihrem Mann gestritten. Selbst damals nicht, als er für die Schauspielerin Fröhwerth eine Villa außerhalb von Elberfeld gebaut hatte. Was hätten Vorwürfe und Auseinandersetzungen genützt? Die Männer waren nun mal so, wie sie waren. Die Welt war so, wie sie war. Es blieb ihr immer noch genug und übergenug, um ihre Luxusbedürfnisse zu befriedigen, um ihre kostbare Medaillonsammlung zu vergrößern, um sich Perlen zu kaufen, von denen sie einen ganzen Beutel voll auserlesener Stücke besaß, um zu reisen, um junge Maler zu unterstützen, die unverständliche Bilder malten, von denen sie einige Dutzend auf dem Speicher des Elberfelder Hauses gestapelt hatte und die in irgendeinem Salzbergwerk vor den Bomben sichergestellt waren und dort sicherlich und Gott sei Dank verkamen. Jetzt allerdings, nachdem die Werke ihres Mannes zum größten Teil zerstört waren oder in der russischen Zone abmontiert wurden, seit hier Gerüchte umgingen, es würde zu einer Landreform kommen und man würde das Gut der Mossignys enteignen, jetzt war sie manchmal ein wenig unruhig. Wenn weder die großen Güter noch die großen Werke übrigblieben ... dann, ja dann blieben eigentlich nur die Medaillons und die Perlen, und wie lange mochten die reichen?
Paul, ihr Sohn, hatte ihr schon vor zehn Jahren gesagt, daß eines Tages alles weg sein würde und daß es nicht weiter schade darum sei. Aber er hatte damals kommunistische Freunde oder sozialistische. (Den Unterschied zwischen den beiden würde sie nie begreifen, er war ihr auch gleichgültig. Beide waren jedenfalls Feinde, die man bekämpfen mußte, mit denen man sich nicht verbrüdern durfte.) Paul war also nicht objektiv, er hatte völlig verquere Ideen, er war ihr unsäglich fremd. Wenn sie ehrlich gewesen wäre, hätte sie zugeben müssen, daß es ihr ziemlich gleichgültig war, ob er noch lebte. Denn während er lebte, hatte sie ihn fast nie gesehen, zweimal im Jahr ein, zwei Stunden. Das war alles. Was hatte sie mit diesem fremden Menschen zu tun, der sich über alles lustig machte, was sie tat, über die Maler, über die Medaillons und selbst über die Perlen, die doch unstreitig ihren Wert zu jeder Zeit behalten hatten? Wenn sie also jetzt seufzte bei dem Gedanken, wo Paul sei, so war es eigentlich ein lügnerischer Seufzer. Nichts würde sich in ihrem Leben ändern, wenn Paul auftauchte.
Sie seufzte noch einmal. Dann nahm sie aus ihrer Handtasche ein Paket Karten und begann mit fixen, gewandten Fingern eine Patience zu legen. Da es ganz windstill war, brauchte sie nicht zu fürchten, daß die Karten wegfliegen würden.