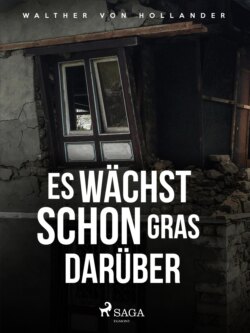Читать книгу Es wächst schon Gras darüber - Walther von Hollander - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas kleine Jagdhaus lag abseits vom Dorf auf einem Hügel. Man konnte durch das Unterholz die Elbe schimmern sehen. Es fuhren aber nur wenige Kähne darauf. Denn die Brücken waren noch zerstört und hingen im Wasser. Das Haus selbst war durch einen der unsinnigen Kriegszufälle zerstört worden. Zwei Soldatengräber deckten die beiden letzten Verteidiger, Hellmuth Grabert und Kurt Seßner, gefallen am 3. Mai 1945. Dieselbe Granate, die das Haus auseinandergerissen hatte, mochte die beiden getötet haben. Ein Zimmer war übriggeblieben, mehr eine Kammer. Darin standen jetzt ein alter Ledersessel als Prunkstück, ein kleiner Diwan, grünüberzogen mit gräßlichen Schlangenmustern, ein dreibeiniger Tisch, dessen dritter Fuß durch Ziegelsteine ersetzt wurde. Ein paar graue Gardinen hingen vor dem Fenster, das man durch ein Zugrollo von Wachstuch verdunkeln konnte. Auf einer Kiste war eine zerbrochene Waschschüssel aufgestellt, eine zerbeulte Emaillekanne als Waschkrug, und in einer Ecke war ein graubrauner Kachelofen, auf dessen eisernem Einsatz man kochen konnte. An den Wänden hingen einige angekohlte Geweihe, gut zu brauchen als Handtuchhalter und Kleiderhaken. Trat man aus dem Zimmer, so stand man gleich im Freien, zwischen halbmannshohen Mauern, verkohlten Balken, angebranntem Ried, das noch vom Dach übriggeblieben war, und natürlich auch zwischen größeren und kleineren Geweihen, unter denen Metalltäfelchen angebracht waren, die den Abschußort, den Abschußtag und den glücklichen Jäger aufzeichneten.
Jetzt lag ein trüber Himmel über dem Jagdhaus. Von den Bäumen tropfte es ruhig und gleichmäßig wie schon seit vierzehn Tagen, und zwischen den Trümmern hatten sich Pfützen gebildet.
Paul Wolffenau kam vom Dorf, wo er seine kleinen Einkäufe gemacht hatte. Das Beste war eine zwei Meter lange Angelrute und zwanzig Meter erstklassige Angelschnur, die er in der Hand trug. Er hatte sie beim Kaufmann Klösters eingetauscht gegen ein hübsches, sehr buntes Aquarell, darstellend den Klöstersschen Kolonialwarenladen, der rechts und links von Sonnenblumen eingerahmt war. Eine etwas mühsame Arbeit, da Herr Klösters alles sehr genau auf dem Bilde zu haben wünschte, einschließlich der Firmeninschrift: Theodor Lüttjohanns Nachfolger, Inhaber Hermann Klösters. Die Reißfeder war kaum fein genug, um das alles aufzuzeichnen.
Übrigens hatte er noch zwei Pfund Grieß darauf bekommen, zwei Päckchen Tabak und eine große Tüte Tee, der in einem Winkel des Ladens den Krieg überdauert hatte und nicht besonders frisch roch. Aber es war Tee. Paul trug diese Sachen alle in seinem Koffer. Wie oft hatte er schon geflucht, daß er in einem Anfall von unangebrachtem Mitleid seinen Rucksack verschenkt hatte. Wahrscheinlich trug jetzt der stämmige Gatte der Dame den Rucksack, und er schleppte sich mit dem Koffer, den er allerdings jetzt, mit einer Wäscheleine verschnürt, auf den Rükken gebunden hatte.
„Guten Abend“, sagte Paul, als er das Zimmer betrat. „Da wären wir also. Und es hat sich gelohnt. Bitte schön ... eine Flasche Milch wie immer, Grieß, ein widerliches Gericht, aber ausreichend für drei Tage. Ein halbes Pfund Margarine, ein Klecks Butter — weniger als sonst, aber immerhin. Ein Sechspfundbrot, ein halbes Pfund Zucker, und zwar bester weißer, wie Herr Klösters betont hat, Kartoffeln ... und das meiste — ja, hier ist noch Tee — gegen ganz gewöhnliche, ins Käufliche herabgedrückte Kunst eingetauscht.“
Er kam, während er die Sachen wegpackte, an dem kleinen, grünlichen Spiegel vorbei, blieb stehn und brach das unsinnige Selbstgespräch ab. Er sah sich prüfend an. Eigentlich wäre es gut, mal wieder ein Selbstporträt zu machen. Jetzt hatte er doch Zeit, zu malen. Kein Bauherr kommandierte, keine Behörde verlangte die Entwürfe termingemäß. Immer wieder hatte er seufzend zu Gertie gesagt: „Laßt mich doch mal aus der Geldmühle heraus, ich will malen. Stein und Eisen und Glas ... das ist nicht biegsam, das leuchtet nicht.“ Also jetzt ein Selbstporträt. Ölfarben hatte er noch aus Dahlem mitgebracht. Eine Holzplatte ließ sich präparieren. Es gab also keine Entschuldigung. Bitte, hier ... statt in der Art eines einsamen Greises Selbstgespräche banalster Art zu führen, wäre es gut, das tiefste Selbstgespräch zu führen, das es gibt: das Selbstporträt. Ein schonungsloses, ein selbstenthüllendes, sich selbst enthüllendes Porträt. Das malen, was hinter dem selbstsicheren, frischen, braunen Gesicht steckte. Den Kummer etwa, der sich in den kantigen Schläfen barg. Die Grübeleien des Nachts, die sich in den winzigen Stirntälern versteckten. Die völlige Leere, die in den stahlblauen Augen langsam Platz nahm. Bitte! Wenn man mal wirklich einsam war — und wer hatte je dieses Glück in seinem Leben? — dann konnte man auch ehrlich sein.
Er kniete am Ofen und zündete ein Feuer an. Die kleinen Tannenäste, Abfälle von den Ästen, die die Granaten heruntergeschlagen hatten, prasselten hell auf. Die Ofenplatte begann zu glühn, und das Wasser in dem kleinen Emaillekochtopf hob zu singen an. Keinen Grießbrei, bitte, sondern lieber einen starken, dunkelbraunen Tee. Dazu eine Pfeife von dem graubraunen Tabak des Herrn Klösters, Marke Flaggenstolz. Er betrachtete das Paket aufmerksam. Das Reklamebild stammte aus einer Zeit, die verschüttet und vergangen war wie die Zeit, bevor Herculanum und Pompeji untergingen. Es zeigte zwei Matrosen mit nacktem Hals, kleinem Spitzbart und roten Backen, die gerade eine Flagge am Mast emporzogen. Diese Flagge war mit weißem Papier überklebt. Aber als Wolffenau das Papier wie ein Abziehbild anfeuchtete und abzog, kam wahrhaftig die alte Seekriegsflagge mit dem schwarz-weiß-roten Gösch zum Vorschein. Er mußte sehr weit zurückdenken, um sich an die alte deutsche Fahne zu erinnern.
Zuletzt flatterte sie in einem trüben Novemberwind am Hause seines Großvaters Alexander Wolffenau, des Gründers der Firma, der sie als kaisertreuer Mann aus Trotz aufgezogen hatte, als das Kaiserreich zusammenbrach. Paul hörte jetzt wieder die empörten Rufe der demonstrierenden Arbeiter. Er hörte die schweren Stiefel einer eindringenden Rotte über die Treppe stampfen, er hörte das Triumphgeschrei der Massen vor dem Haus, und als er gleich darauf von seiner zitternden Mutter durch den Hinterausgang des Hauses hinausgeführt wurde, sah er, wie von dem breiten Balkon eine blutrote Fahne herabhing. Die Menge hatte sich seltsamerweise still entfernt. Den Grund erfuhr er am Abend. Der alte Alexander Wolffenau hatte sich voller Ingrimm den Arbeitern entgegengeworfen. Sie hatten ihn gepackt und beiseitegeschoben, und plötzlich war er unter den Händen der Festhaltenden zusammengebrochen. Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gesetzt, und so lag er, während seine Schwiegertochter und sein Enkel durch die Straßen flüchteten, einsam auf seinem Ledersofa, den toten Blick auf die rote Fahne gerichtet, die langsam und feierlich im Novemberwind wehte. „Es war sehr heldenhaft, aber ein wenig lächerlich“, hörte Paul seinen Vater ein paar Wochen später zu Herrn Trümper von der Metall-Bau-AG sagen, „sich einer Fahne wegen in den Tod zu stürzen. Mögen sie aufziehn, welche Fahne sie wollen. Das ändert an den realen Tatsachen nichts. Und diese realen Tatsachen gilt es zu biegen, lieber Trümper, bis sie ein vernünftiges Gerüst für uns hergeben.“
Nach diesem Grundsatz hatte Paul I. gelebt und hatte die rote Fahne überstanden, dann die schwarz-rot-goldene, und er hatte auch gut, ja vorzüglich unter der Fahne mit dem Hakenkreuz gelebt. Es kam nicht auf die Flagge an, sondern ... Paul schüttete Tee in das sprudelnde Wasser. Ein Sieb besaß er nicht. So schwammen die Teefische in der henkellosen Tasse, auf die in Goldbuchstaben „Dem lieben Fritz“ gemalt war. Übrigens stank der Tabak, Marke Flaggenstolz, ganz abscheulich.
Es kommt nicht auf die Flagge an, dachte Paul wieder. Aber wenn es, wie jetzt, überhaupt keine Fahne gab, die man militärisch begrüßen, vor der man den Zylinder lüften, die man mit ausgestrecktem Arm beschwören konnte? Sicherlich, sobald es eine neue Fahne gab, würde Paul der Erste sie wieder an den gewünschten Tagen auf seinem Balkon hissen. Denn es kam ja nicht auf die Fahne an, sondern auf die realen Tatsachen, die man mit Kraft, mit Geduld, mit List zurechtbiegen konnte, weil man eben kräftiger, geduldiger und listiger war als die anderen.
Der Tee schmeckte wundervoll. Es war jetzt behaglich warm. Ein ziemlich kräftiger Wind blies von der Elbe her. Die lockeren Balken klapperten vor der Tür. Der Regen klatschte in Stößen gegen die Bäume und tropfte auf das Jagdhaus. Wolffenau warf noch ein paar Hände voll Kienäpfel auf das Feuer und stellte Kartoffeln auf. Es war vernünftiger, irgend was zu essen. Zum Holzsuchen war es außerdem zu naß. Er beschloß also, dazubleiben, es sich behaglich zu machen. Behaglich? Das klang ganz schön, und er hätte es ja auch wirklich behaglich haben können, wenn er nicht zufällig ein gutes Gedächtnis gehabt hätte, eine starke Vorstellungskraft. Wenn nicht in dieser Einsamkeit die Erinnerungen, die er längst abgestorben gewähnt hatte, zu wuchern begonnen hätten, unkrauthafte, die seit Jahrzehnten ihre Keimkraft behalten hatten und nun, da sie nicht von der Flugsandschicht der täglichen Erlebnisse überschüttet und niedergehalten wurden, mit krausen Blättern und seltsamen Blüten ans Licht kamen, einander bedrängend und wegdrängend und je nach ihrer Kraft wechselnd ins Bewußtsein emporwachsend.
Wie aber erinnert man sich, wenn man ohne eine richtige Tätigkeit dasitzt? Die Motoren laufen ja noch. Man ist und bleibt ein heutiger, hastiger, tätiger Mensch. Man hat zum erstenmal kein richtiges Ziel und ist doch zielstrebig auf tausenderlei Aufgaben hin erzogen worden. Man ist gewohnt, an einer Zukunft zu bauen, wenn sie sich auch immer wieder, zu Gegenwart geronnen, als etwas recht Unvollkommenes erweist und uns darum befiehlt, wiederum eine andere Zukunft zu setzen, die man nun erstreben muß, obwohl man im Laufe der Jahre erfahren hat, daß aus jeder noch so leuchtenden Zukunft eine recht trübe und unvollkommene Gegenwart wird. Wie erinnert man sich also, wenn man tatenlos und zukunftslos, in einer Atempause zwischen zwei Atemzügen der Zeit lebt? Man erinnert sich in seltsam abgerissenen Fetzen, und es ist schwer, die Fäden zwischen den Fetzen neu zu knüpfen und zum Ganzen zu sagen: Das war dein Leben, und was nun?
Während er, die Tasse „für den lieben Fritz“ zwischen beiden Händen, vor sich hinstarrte, auf den Regen lauschte, der ununterbrochen niederging, auf das warnende Geschrei der Eichelhäher, die vor irgendeinem Menschen ins Innere des Waldes flüchteten, tauchte wieder das Gesicht Gerties auf, und diesmal nur als ein ganz flüchtiger, vorübergehender Eindruck, das Gesicht nämlich von Tränen überströmt, nachdem er sie an einem schönen Sommertag auf dem Tennisplatz des Rot-Weiß-Clubs zum erstenmal ganz klar 7:5, 6:2 geschlagen hatte. Warum weinte sie? Aus verletztem Ehrgeiz? So hatte er damals gedacht, als er sie lachend und tröstend über das Netz weg umarmte und ihr spöttisch versprach, sich in Zukunft immer, wie es sich gehöre, besiegen zu lassen. „Du spielst eben besser“, hatte sie geschluchzt und war wütend davongelaufen. Jetzt wußte er, warum sie weinte. In ihrem ganzen Zusammenleben nämlich konnte sie seine Überlegenheit mit Spott überspielen und mit Finten wegwischen. Aber 7:5, 6:2 ... das ließ sich nicht wegfintieren, das war ein glattes und klares Ergebnis. Und in diesem Augenblick wußte sie, daß er ihr überlegen war. Ein Kampf von sechs Jahren hatte sich entschieden. Er spürte jetzt — früher hatte er nie darüber nachgedacht —, daß dieser Kampf in jeder Ehe entschieden werden muß, mochte es auch das Ideal einer Ehe geben, in der man nicht kämpft und keine Entscheidungen herbeiführen will. Und was hatte er von seinem Sieg gehabt? Er war notwendig gewesen, gewiß. Aber war er auch fruchtbar? Er konnte es nicht entscheiden. Wenn er an die Ehe seines Vaters dachte, in der es nie einen Kampf gegeben hatte, weil Paul I. gar keine Zeit dazu hatte und von vornherein seine Frau mit eisiger Höflichkeit auf einen Hausfrauenthron stellte, auf dem sie als würdige Regentin eines Vierzehn-Zimmer-Haushaltes im wahrsten Sinne des Wortes kaltgestellt war, so mußte er seine kurze, kämpfereiche Ehe loben. Mindestens war sie immer voller Überraschungen gewesen, meist voller Heiterkeit und guter Laune, sehr verspielt freilich, aber auch sehr abwechslungsreich. Man war einander nie sicher. Das konnte manchmal recht nervenaufreibend sein. Aber wenn er an die sicheren Ehen seiner Freunde dachte, so war es schon ganz gut so. Ja, es war für ihn das einzig Richtige, und er würde in Zukunft ... Himmel, er hatte ja ganz vergessen: Das war endgültig vorbei! Gertie war längst tot, begraben unter den Trümmern des kleinen verspielten Hauses in Dahlem. Also weg damit und schnell eine neue Pfeife gestopft!
Da war doch noch etwas mit dem Flaggenstolz. Ach ja, richtig, die Sache mit den verschiedenfarbigen Fahnen, die während seines kurzen Lebens über Deutschland geflattert hatten, und daß es jetzt keine Fahne gab, die man hißte und verehrte. Er hatte seinen Vater verspottet, weil er unter jeder Fahne gut lebte. Und er selbst? Hatte er Grund zum Spott? Nun, wenn er es ehrlich überlegte: für ihn konnte keine der Fahnen eine große Bedeutung haben. Acht Jahre war er alt, als aus dem Kampf zwischen rot und schwarz-weiß-rot die schwarz-rotgoldene Fahne kam, der sich niemand recht verpflichtet fühlte, eine Fahne über einem arbeitsamen, zäh alle Schwierigkeiten eines verlorenen Krieges überwindenden Volke. Sie war ihm so gleichgültig wie den meisten anderen Deutschen. Sie wurde auch selten gezeigt. Sie flatterte über einem überraschenden Aufstieg und einem ebenso überraschenden, in seinen Gründen kaum zu enträtselnden, aber anscheinend unaufhaltsamen Abstieg. Bis dann das Hakenkreuz kam. Das war ihm recht unbehaglich. Die Männer, die es trugen, zeigten eine Überheblichkeit, die ihn abstieß. Sie machten alles neu, auch das, von dem sie gar nichts verstanden. Sie wußten alles besser, auch das, von dem sie gar nichts wußten. Sie machten ihm allerlei Schwierigkeiten, verboten ihm zum Beispiel, flache Dächer zu bauen. Nun ... er hatte die flachen Dächer sowieso gerade über. Er fügte sich nicht etwa, wie sein großer Meister, der belgische Architekt Cassembert, es ihm in einem heftigen und ungerechten Brief vorwarf. Er war zufälligerweise wirklich auf einem neuen Wege. Oder fügte er sich doch? Hatte der Meister nicht recht, daß sein großes Talent schon zum Alleskönnen ausgeartet war, daß er mit seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten sich jeder Richtung anschmiegen und sie originell weiterführen konnte? War er vielleicht seinem Vater allzu ähnlich, der die Tatsachen so lange bog, bis sie zu ihm paßten? War er also mit Hilfe seiner Gaben ein Konjunkturjäger geworden, einer, der im Mißerfolg enden mußte, weil er ohne Erfolg nicht leben konnte, ohne Lob nicht und nicht ohne Arbeit und Beifall? Eine sehr schwere, eine Lebensfrage.
„Wer immer dabeisein will, verliert schließlich die Verbindung mit sich selbst“, schrieb Cassembert am Schluß seines Briefes, und er hatte ihn nach Paris eingeladen, um in aller Stille, ohne Gedanken an einen Erfolg, die Häusertypen der Zukunft zu entwickeln, die Häuser der einzelnen. Des mönchischen Gelehrten zum Beispiel, winzig, wabenähnlich, mit allem technischen Komfort ausgestattet, der den abseitigen Mann unabhängig machte von den redereichen, ablenkenden Hilfeleistungen der Frauen. Das Haus der Tänzerin, voller Stufen und Treppen, auf denen sich ständig Gleichgewicht und Gang erproben ließ und dessen kreisrundes Mittelstück eine immerwährende Verlockung zum Tanz war. Das Haus der Familie, um einen Großraum gruppiert, an dem die einzelnen Kammern lagen, schalldicht abgesperrt durch metallene Türen, die so schmal waren, daß immer nur ein einzelner sie passieren konnte, damit jedermann ständig daran erinnert wurde, daß ein Zimmer das absolute Herrschaftsgebiet des einzelnen war. Diese drei Typen hatte er damals skizziert. Paul aber hatte in einem langen Brief abgelehnt, an einer Aufgabe mitzuarbeiten, die vielleicht in der Renaissance ihren Sinn gehabt hätte, aber heute abwegig, skurril genannt werden müsse. Und er hatte triumphierend gemeldet, daß man ihm den Bau einer Siedlung mit zweihundertachtzig Häusern übertragen habe, eine gigantische Aufgabe, besonders weil man ihm nur zwei Jahre Zeit dafür ließ.
Paul Wolffenau streckte sich triumphierend in seinem Sessel. Was war das für eine lustige Zeit gewesen, als er mit Plümmer, Segewold und Trantau, seinen drei Assistenten — von Gertie die Drillinge genannt —, an den Entwürfen arbeitete! Und was hatte Cassembert ihm geantwortet? Noch könne kein Architekt von Format und Gewissen eine Siedlung solchen Ausmaßes bauen, ohne trostloser, langweiliger Eintönigkeit zu verfallen. Denn noch stecke im sozialen Gedanken (dessen hindernissprengende Gewalt er nicht leugnen wolle) natürlicherweise ein Element des Neides, und der Neid veranlasse den Neider stets, sich das gleiche zu wünschen, was der andere habe, statt das zu erstreben, was er selbst originaliter für sein Leben brauche. Und dem Neid, der Gleichförmigkeit erzeuge statt der musikalischen Variationen eines natürlichen Lebensgefühls, werde Paul sich fügen müssen.
Wolffenau hob spöttisch drohend seine Pfeife. Wie wäre es, wenn der alte Cassembert jetzt in das zertrümmerte Deutschland käme, um sein Haus des Gelehrten, sein Haus der Tänzerin und das Familienhaus mit den schalldicht abgesperrten Kinderzimmern zu propagieren? Welch ein Höllengelächter würde sich erheben unter denen, die kein noch so primitives Dach über dem Kopf hatten und zu zwei, drei Familien in Schulzimmern, Tanzböden ländlicher Gastwirtschaften auf Stroh nächtigten? Er, Paul Wolffenau, hatte also recht gehabt. Oder ...? Zunächst einmal hatte der Meister recht behalten. Die Siedlung war durch Abstriche und Eingriffe der Behörden schließlich so langweilig geworden, daß Paul die Ausführung ganz und gar den Drillingen übertrug. Und dann ... mußte man wirklich immer auf dem so bequemen Flusse der Notwendigkeit schwimmen, der einen zwar zum Erfolg trug, aber auch allzuleicht im Seichten absetzte? Mußte man nicht, wenn man das Besondere konnte, sich wenigstens zuweilen absondern, das Ungewöhnliche tun, das scheinbar Gegenzeitliche? Ach, wie leicht war es, die Unbeugsamkeit und Unbiegsamkeit des Abseitigen zu verspotten, ihn zu verkleinern, ihn unnütz zu schelten und zeitfremd. Was waren schließlich die paar Häuser, die er, Wolffenau, anständig gebaut hatte, anderes als Abseitigkeiten, für wenige überhaupt nur verständlich und dennoch fruchtbar als erste Anzeichen eines neuen Lebensstils, einer Rückführung von außen nach innen; was waren sie anders als kleine Wildtriebe, sprossend aus der großen Wurzel des veredelten, meisterlichen, früchtereichen Baumes? Wer hatte recht? Der Unbeirrbare, auch dann, wenn er starr war und starr wurde? Oder er, Paul Wolffenau, der immer auf der Jagd blieb nach Anregungen, der das Herz der Zeit schlagen hörte, seinen Rhythmus spürte und ihm Ausdruck gab, er, der Schmiegsame, Biegsame, Elegante, er, der Einfühlsame, der den unklaren Wünschen seiner Bauherren mit ein paar hinreißenden Einfällen oft schon in Sekunden den richtigen Ausdruck gab? Wie konnte er geduldig sein, langsam wachsen lassen, wenn ihn die Einfälle manchmal wie Sturzbäche überfielen? Wie konnte er still sein, wenn es ihm im Trubel der Arbeit, auf dem Markt des Erfolges so wunderbar gut gefiel?
Er hielt die sich überstürzenden Gedanken plötzlich an. Er löschte sie aus mit einer banalen Binsenweisheit. „Die Menschen sind eben verschieden“, sagte er, wieder in das Selbstgespräch verfallend. Er wußte noch nicht, daß dieses Sprechen mit sich selbst nicht etwa eine Nothilfe des Einsamen war, sondern ein Ausweichen vor den Gedanken. Er merkte nur mit Erleichterung, daß ihn die Erinnerungen losließen.
Das Zimmer umgab ihn wieder mit seiner trostlosen Häßlichkeit und seiner trostreichen Einsamkeit. Es war sehr heiß geworden. Er stieß das Fenster auf. Der Regen hatte nachgelassen, und im Westen zeigte sich über dem Fluß eine blaue Bahn zwischen den Wolken. Es war erst sieben Uhr, noch hell. Ein langer Abend lag vor ihm, eine lange Nacht. Aber zunächst mal waren die Kartoffeln weich. Er schüttete das Wasser ab, schälte eine nach der andern und aß sie, indem er sie in Salz stippte. Dazu trank er eine Tasse Milch. Dann beschloß er, an den Fluß zu gehn, um die neue Angelrute auszuprobieren. Er hatte auch großen Appetit auf gebratenen Fisch. Während er, die Angelrute geschultert, durch den tropfenden Wald zum Fluß hinunterstieg, beschäftigte ihn nur ein Gedanke: brät man den Fisch so, wie man ihn fängt, mit Haut und Haar also, aufgeschnitten und ausgeweidet natürlich, oder muß man zuerst die Gräten herausnehmen? Schade, daß er nie kochen gelernt hatte. Wahrscheinlich aber war es so, daß man die großen entgrätete und die kleinen ganz briet. Nun — er würde wohl nur kleine fangen.
Er fing überhaupt keinen Fisch. Ein paarmal zuckte der Schwimmer, aber es biß kein Fisch an. Nun ist es ja beim Angeln keineswegs die Hauptsache, daß man Fische fängt, sondern daß man ab und zu mit kühnem Schwung die Leine wirft. Daß man die Augen starr auf den Schwimmer gerichtet hält und vor allem daß man das Gefühl hat, etwas ungeheuer Wichtiges zu tun. Untätig in der Natur zu sein ... dazu sind die meisten Menschen zu aktiv und nervös, und sie haben auch Angst, daß die weite Natur sie ganz wegziehen könnte, ihre so wichtige Existenz für Sekunden auslöschen.
Wolffenau jedenfalls saß befriedigt und völlig gedankenlos am Ufer des Flusses und sah das seichte Uferwasser in kleinen Wellen sich im Schilf verfangen und weiterströmen, sah über die blendende Fläche, die sich allmählich mit den Farben des Sonnenuntergangs bedeckte, mit einem flammenden Hellgelb, einem schaumspeisenartigen Rosarot, einem türkisfarbenen Grün, bis plötzlich eine schwarze Wolkenwand alles wegwischte.
Gleichzeitig kam ein kalter Wind über das Wasser und zwang ihn, aufzustehn. Er rollte die Angelschnur sorgfältig ein, knüpfte das türkische seidene Halstuch zu einem kunstvollen Knoten und marschierte sehr zufrieden und sehr leer hügelaufwärts auf seine Hütte zu. Er beschloß, den Tag leichtsinnig mit einer neuen Portion Tee zu beschließen, ein tüchtiges Feuer zu machen und vielleicht die erste Skizze zum Selbstporträt anzufangen. Es kam ihm viel darauf an, etwas zu tun, damit er von den verfluchten Erinnerungen loskam. Er bückte sich, weil er ein gar zu schönes Stück Holz liegen sah, einen prächtigen harzigen Tannenast, mit dem man sehr leicht Feuer machen könnte. Die Streichhölzer wurden verflucht knapp. Gut nur, daß er das Feuerzeug hatte.
Er schulterte den Ast zu der Angel und marschierte weiter. Er überlegte, ob es nicht ernstlich Zeit sei, wieder aufzubrechen. Für immer konnte er ja nicht als Einsiedler, als ein Hieronymus im Gehäus, hier im Walde hocken und gar nichts tun, während das ganze Land voll Trümmer lag, die weggeräumt werden mußten. Während die Herren Kollegen sicher schon dabei waren, Entwürfe für den Neuaufbau der Städte zu machen. Warum drängte es ihn denn nicht, mit dabei zu sein? Hatte er etwa keine Ideen mehr, war er fertig, ausgebrannt, verbraucht? Hatte die Langeweile des Krieges — nie hatte er es für möglich gehalten, daß man sich so sehr langweilen konnte — ihn ausgelaugt, war er am Ende? — Ach — das war nur eine rhetorische Frage, eine nachhallende Frage aus seinen Anfängen damals, als er jede Idee ängstlich behütete und bewahrte, als er beweisen mußte, daß er jemand war, der Ideen hatte. Später brauchte er nur den Stift anzusetzen, dann war die Idee da, dann fiel ihm mehr ein, als gut war, dann mußte er Entwürfe über Entwürfe als Abfälle wegwerfen, die gut genug waren, daß sich ein Dutzend Dutzendarchitekten davon hätte ernähren können. Sicherlich, wenn er den Stift wieder ansetzte, würden die Ideen wieder dasein. Aber es lag ihm nichts daran. Warum nicht? Das war ihm unklar. Andererseits aber, wenn er jetzt an den langen Abend dachte, an die Nacht, die vielleicht wieder schlaflos sein würde oder von unsinnigen Träumen gestört, von ganz und gar undeutbaren Stimmen und Gesichtern, dann schien es ihm richtiger, irgend etwas zu tun, was sich als Barriere gegen die Gedanken, gegen die Erinnerungen benutzen ließ. Man konnte sich doch nicht einfach ausliefern. Oder ...?
Was war denn eigentlich sein Talent gewesen? Doch nichts anderes als ein Ausgeliefertsein an eine Kraft, die sich seiner bediente. Die eigenen Ideen ... du lieber Gott, das war eine klägliche Geschichte, ein stotterndes Probieren, ein hilfloses Suchen, bis dann die Verbindung plötzlich da war, dieser merkwürdige elektrische Strom, dieses seltsame Knistern und Aufflammen, das sich auf den Zeichenstift übertrug und ihn von selbst führte. Also war das Ausgeliefertsein die eigentlich fruchtbare Haltung, ein wenig gefährlich, gewiß, besonders wenn man es herbeizwingen wollte, wenn man es ausnutzte oder stolz damit spielte. Und jetzt wehrte er sich gegen eben dieses Ausgeliefertsein? Aber das war doch etwas ganz anderes. Das eine war produktiv, brachte etwas hervor, und dieses hier, dieses Grübeln ... wozu war das gut? Niemals, niemals hatte er über das Leben nachgedacht. Es kam, wie es kam. Und für ihn war es, bis auf die üblichen Kämpfe, mit den Eltern zum Beispiel, bis auf die üblichen Enttäuschungen mit den ersten Frauen, immer schön und angenehm gewesen. Er war ein Glückskind; auf der Sonnenseite geboren. Und die Nachtseite der Welt? Entweder man schlief, wenn es dunkel war, oder man beleuchtete das Haus übermäßig hell aus allerlei witzigen verborgenen Lichtquellen und machte noch aus der dunkelsten Nacht eine Feerie, heller als der sonnigste Tag. Und jetzt plötzlich diese seltsame Schlaflosigkeit, dieses matte Warten, dieses Dahocken bei Kerzenstümpfchen oder dem roten Licht aus der geöffneten Ofentür. Hatte sich die Nachtseite der Welt nun doch seiner bemächtigt? Hatten die Nachtgestalten ihn eingeholt, die Vergessenen, die man verraten hatte dadurch, daß man sie stehenließ, weil sie hergegeben hatten, was an ihnen anregend war, oder einfach dadurch, daß man in andere Arbeit, in andere Lebenskreise hineinglitt? Und die Toten! Es fiel ihm in diesem Augenblick, in dem die Hütte vor ihm auftauchte, ein, wie unendlich viele seiner Freunde und Bekannten ganz gewiß tot waren und wie viele verschollen, von denen sicher dieser Krieg noch eine ganze Anzahl verschlungen hatte. Wenn er das richtig bedachte, so mußte er zugeben, daß er eigentlich ein alter Mann war. Denn was ist Alter anderes, als von toten Lebensgefährten umstanden sein? Er warf den Ast mit einer unwilligen Gebärde ab, so als könne er damit auch den lästigen Gedanken abwerfen. Die Angelrute lehnte er gegen das Haus. Dann trat er ein und machte Licht.
Er wollte sich gemächlich in den Lehnstuhl setzen. Aber jetzt sah er, daß da schon jemand saß, ein älterer Herr im Lodenmantel, den grünen Jägerhut halb über die dicke Brille geschoben und in einen angenehmen Schlummer versunken. Wolffenau war wenig erfreut über den Eindringling. Er tippte ihm auf die Schulter und sagte ziemlich grob: „Was machen Sie denn hier?“
Der Herr wachte auf, nahm seinen Hut ab und enthüllte eine runde, glänzende Glatze. „Dr. Bröseke“, sagte er, sich reckend. „Dasselbe wollte ich Sie fragen.“
„Ich wohne hier, wie Sie sehn“, antwortete Paul. „Ich habe mir die Sache ein bißchen zurechtgemacht.“
Der Alte verbeugte sich: „Sehr liebenswürdig von Ihnen. Aber sind Sie nicht auf die Idee gekommen, daß dieses Häuschen jemandem gehören könnte?“
Paul lachte: „Ach so ... Sie sind, wie man das früher nannte, der Besitzer.“
Dr. Bröseke mußte nun auch lächeln. Dann sagte er: „Sie gehen ja mächtig mit der Zeit. Oder immer ein paar Tage voraus, vielleicht auch ein paar Jahre. Aber bis jetzt gilt noch das Grundbuch von Krössien. Sie können es nachschlagen, wenn Sie mal reinkommen, Band 4, Blatt 116, Besitzer des Flurstückes 6/33 Dr. Edmund Bröseke, Zahnarzt in Krössien. Das bin ich. Und danach ...“ Er wies mit einer liebenswürdigen Geste auf die Tür.
„Dr.-Ing. Paul Wolffenau, Architekt, Berlin-Dahlem“, sagte Paul. „Ich glaube, die Grundbücher von Berlin-Dahlem sind auch erhalten. So was verbrennt ja nicht. Oder haben Sie schon mal gehört, daß irgendein Amt, zum Beispiel ein Steueramt, vernichtet ist? Damals, bei dem größten Angriff auf Berlin, brannte mal so ein Kasten. Was machten die Beamten? Sie retteten unter Lebensgefahr die Akten. Vor allem natürlich die Steuerstrafsachen. Ich sah einen alten Beamten, der hat sich buchstäblich den Bart verbrannt und die Löckchen im Nacken — nur damit der Staat zu seinem Gelde kam.“
Dr. Bröseke kicherte. „Ja ... Sie haben recht, wenn einmal endlich die Superatombombe diese blödsinnige Welt auseinanderreißt und alles Lebende vernichtet ... dann kann man sicher sein, daß oben am Rand des Kraters drei Steuerämter stehenbleiben mit lauter geretteten Akten davor.“
„Ein hübsches Bild“, sagte Paul und nahm auf dem Diwan Platz.
„Das ändert aber nichts daran, Herr Wolffenau, daß die Reste dieses Häuschens mir gehören. Leider muß ich Sie auffordern, zu räumen.“
„Sicher haben Sie doch noch eine Wohnung in Krössien“, sagte Paul, „mit einer gutgehenden Praxis, wie ich vermute. Die Karies nimmt infolge der schlechten Ernährung rapide zu. Erntezeit für Zahnärzte.“
Bröseke zog seinen Mantel aus und hängte ihn an eines der Hirschgeweihe. Dabei murmelte er: „Es geht. Kann nicht klagen. Nur das Material ... man kann nur miserable Arbeit leisten. Wo wollen Sie übrigens diese Nacht schlafen?“
Paul lächelte liebenswürdig: „Sie können es sich aussuchen, Diwan oder Stuhl, falls Ihnen der Rückweg nach Krössien zu beschwerlich ist.“
Bröseke trat auf Paul zu und sagte ruhig: „Ich bleibe ein paar Tage, und ich liebe es nicht, hier draußen mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich habe das nie geliebt ... Das Schlafzimmer mit anderen teilen ... das Schnarchen, der Schlafatem ... schauderhaft. Und jetzt haben sie mir mein Schlafzimmer beschlagnahmt und ich mußte zu meiner Frau rüberziehn. Nach fünfunddreißigjähriger Ehe — ein hartes Schicksal. Aber machen Sie das mal einem Flüchtlingsbetreuer klar. Und nun komm ich hier heraus und finde Sie vor.“
„Ohne mich hätten Sie hier überhaupt nicht schlafen können. Es regnete durch. Den Diwan habe ich erst in der Sonne getrocknet. Sie hätten ihn verschimmelt vorgefunden und hätten hier Schwimmübungen machen können. Haben Sie das gar nicht bedacht?“
Bröseke setzte sich seufzend auf den Lederstuhl. „Was hat ein Jagdhaus mit Krieg zu tun“, jammerte er. „Wie konnte ich auf die Idee kommen, daß ausgerechnet hier gekämpft worden sei? So ein Unsinn.“
„Wollen Sie etwa auf die Jagd gehen?“ erkundigte sich Paul.
Bröseke schnaufte nur: „Ohne Gewehr! Drei Stück haben die Engländer mir beschlagnahmt.“
„Was machen wir nun?“ sagte Paul. „Das Haus gehört laut Grundbuch Ihnen. Aber es ist nicht bewohnbar.“
„Na, hören Sie mal“, fuhr Bröseke auf, „ich finde es recht wohnlich und gemütlich hier, abgesehn von der Tatsache, daß Sie hier sind.“
„Das Wohnliche und Gemütliche gehört aber mir“, sagte Paul, „das habe ich alles erst zurechtgemacht. Ihres ist in Trümmern. Total.“
Bröseke sagte eine Weile nichts. Er beugte sich dann zum Ofen, nahm etwas Holz und lächelte: „Gestatten Sie, daß ich etwas auflege. Es ist Ihr Holz. Ich weiß es jetzt.“ Und nachdem er die Ofentür geschlossen hatte, setzte er hinzu: „Sie gefallen mir. Nicht gerade als Mitbewohner. Da gefällt mir überhaupt kein Mensch. Aber sonst.“ Er kramte in seinem Rucksack, der neben dem Stuhl stand, holte ein Päckchen heraus und sagte: „Da ... Kaffee. Kochen Sie uns eine ordentliche Portion. Es ist ja Ihr Ofen. Oder ist es meiner? Na ... dann werde ich kochen. Versteht auch keiner außer mir.“
Er stellte das Wasser auf und verschwand draußen im Dunkeln. Paul hörte ihn in den Trümmern kramen und murren. Dazu jammerte eine elektrische Lampe, die der Alte mittels einer Ziehschnur zum Leuchten brachte. Nach einer Weile kehrte er triumphierend mit einer verschließbaren Kiste zurück. „Meinen Keller haben Sie nicht gefunden. Dies gehört also selbst nach Wolffenauschem Recht noch mir.“ Er packte aus. Eine zierliche kleine Mokkakanne, zwei Tassen dazu, kondensierte Milch, eine Büchse mit Zucker. Und jetzt zögerte er. „Eine Frage noch, ehe ich mich mit Ihrer Gegenwart versöhne ... Gehörten Sie dazu?“ Und er wies mit dem Daumen nach außen, als ob der Wald von den Herren von gestern wimmelte.
„Nein“, sagte Paul, „ich gehörte nicht dazu. Ich mochte sie nicht.“
„Das sagen jetzt alle“, lachte der Alte ingrimmig. „Dabei gab es in ganz Krössien nur drei, die wirklich nicht mitmachten: der Apotheker, der Schlachter Krehn und ich. Und natürlich noch der alte Abraham, der Viehhändler, den ich gewaltsam über die Grenze nach Dänemark geschafft habe. Aber ich kann es beweisen. Hier ...“, er riß seinen Hut vom Haken und zeigte auf die Krempe an der Stirnseite, die ziemlich abgegriffen war. „Ich habe immer wie ein anständiger Mensch gegrüßt und nicht mit dem steifen Arm.“
„So ein Alibi hat nicht jeder“, sagte Paul anerkennend, „ich zum Beispiel könnte genausogut ein Kreisleiter auf der Flucht sein.“
„Es waren meistens Rundköpfe“, wandte Bröseke ein und goß das sprudelnde Wasser langsam auf den Kaffee, „und Sie haben ein langes, schmales Gesicht. Die Langgesichter, die dabei waren ... das waren Konjunkturritter. Das würde ich Ihnen eher zutrauen.“
„Die Zahnärzte hatten es leicht“, sagte Paul angreiferisch, „einer Plombe sieht man es nicht an, ob sie von einem Freunde oder Gegner der Regierung gemacht ist. Aber ein Haus verrät die Gesinnung des Architekten.“
„Sie haben also griechisch-braunauische Riesenbauten in die Welt gesetzt? Geben Sie es nur zu. Es kann nicht jeder der Held gewesen sein, als den er sich jetzt ausgibt. Sonst wäre die ganze Geschichte nicht passiert.“
Paul nahm sich eine Tasse, die Bröseke eingeschenkt hatte. „Ihr Mokka duftet wundervoll. Ich war allerdings kein Held, aber auch kein Konjunkturritter. Und warum ich kein Held war ... darüber unterhalte ich mich jede Nacht mit jemandem. (Bröseke blickte zu dem Spiegel auf und nickte verständnisvoll.) Es tut mir jetzt verdammt leid. Früher dachte ich, es ginge mich nichts an. Na ... sie haben es uns nun gut beigebracht, daß es uns doch etwas anging.“
Bröseke kramte in seiner Kiste. „Ein Kirsch dazu wäre nicht schlecht“, murmelte er. „Da ... bravo. Er hat es auch überstanden.“ Und er zog eine halbvolle Flasche hervor.
Sie tranken eine Weile schweigend. Bröseke schenkte immer sofort wieder ein. Es sei noch eine Flasche in Reserve, und für die äußerste Not habe er noch puren Alkohol mitgebracht und etwas Himbeerextrakt. Er bot auch aus einem reichlich gefüllten Zigarrenetui an. Wenn er mal einen Gast habe, solle der sich auch wohlfühlen. Und ob es nicht ganz gemütlich sei? Freilich, solange noch das große Zimmer gestanden habe mit dem Kamin, sei es netter gewesen und nicht so eng. Er musterte bei diesen gleichgültigen Reden seinen Gast immer wieder prüfend, indem er die dicke Brille auf die Nasenspitze hinunterzog und ihn Gesicht vor Gesicht anblinzelte. „Sie hatten den Mut eben auch nicht“, sagte er schließlich befriedigt. „Ich meine den wirklichen Mut. Der Schlachter Krehn ... sehn Sie ... das war ein Mann. Tausend solche Kerle in der Provinz, und die Sache wäre nie gekommen. Aber es gab nur den einen: den Schlachter Krehn.“
Paul hob sein Glas: „Sie also auch nicht? Warum denn Sie nicht?“
Bröseke lächelte trübsinnig. „Die alte Geschichte“, sagte er, „die Familie. Meine Frau ... na, die hätte es überwunden. Aber da ist noch meine Tochter in Krössien, und die hat einen Jungen. Hier, schaun Sie sich mal den Bengel an. Herbert. Der Vater ist Sparkassendirektor. Nicht soviel wert wie seine Einlagen. Also gar nichts. Aber wenn so’n Bengel jeden Morgen ankommt und läuft einem durch die Beine wie ein Dackel ... dann sein Sie mal ein Held.“
Paul betrachtete das Bild. Es zeigte einen durchschnittlichen Lockenkopf von fünf Jahren. Objektiv kein Grund zur Liebe. „Na ... und Krehn?“ fragte er ungeduldig.
Bröseke antwortete lange nichts. Er starrte vor sich hin, nippte trübe an seinem Glas. „Aufgehängt haben sie ihn. In diesem März noch. Wäre auch ohne ihn bald zu Ende gegangen. Ohne seine lächerlichen Flugblätter. Mich hatten sie auch hopp genommen und den Apotheker. Aber wir waren ja unschuldig. Da wurden wir freigesprochen und ein bißchen eingesperrt. Ich kam erst vorigen Monat von diesem Ausflug zurück. Aber bei Krehn fand man ein Flugblatt im Hauptbuch. Aus. Und was das Tollste ist: ich bin jetzt ein Held in Krössien. Dagegen kann man nichts machen. Krehn ist tot und kann nicht bezeugen, wie feige ich war, und mir glauben sie es nicht.“
Sie waren längst bei der Reserveflasche angekommen und hatten sie schon halb geleert. „Wir sind vielleicht fabelhafte Kerle“, sagte Wolffenau. „Wir können einiges. Sie bohren sicher brillant in den Mäulern der Menschen, und ich habe ihnen einige Häuser hingesetzt, daß sie gleichfalls die Mäuler aufsperrten. Aber was das Heldentum angeht ... da waren wir wohl wie die meisten. Und die Frage ist nur: Konnten wir es von uns verlangen?“
Bröseke war damit beschäftigt, einen zweiten Mokka anzusetzen. Er schielte zu seinem Partner hinüber. „Das ist es ja gar nicht. Auch nicht, daß sie uns alles abgenommen haben. Ausgezogen bis aufs Hemd ... obwohl, machen wir uns nichts vor, Leute wie ich nur etwas sind, wenn sie etwas haben. Der Bürger, lieber Herr, seines Besitzes entblößt, ist eine etwas beschämende Figur. Und ich habe mich auch nie dessen geschämt, daß ich etwas besitze. Hab’s mir redlich erbohrt und sehe nicht ein, warum ich jeden um Entschuldigung bitten muß, weil ich ein Haus habe und ein paar Groschen auf der Bank. Aber in Gottes Namen soll alles weg sein. Das ist es nicht. Aber das Moralische. Glauben Sie ans Moralische?“ Er trank hastig aus und hielt, schon etwas betrunken, Paul prostend das Glas entgegen.
Der schaute versonnen in sein Glas, trank bedächtig und echote: „Das Moralische ... ich weiß nicht, ich verstehe nicht allzuviel davon.“
Der alte Bröseke fing an zu kichern. Das klang zuerst ein wenig tückisch und hinterhältig. Aber dann brach ein richtiges Gelächter aus ihm heraus, fröhlich und schüttelnd, bis ihm die Lachtränen über die Backen flossen. Dabei bemühte er sich, die Gläser wieder vollzuschütten. Aber er schüttete vor Lachen die Hälfte daneben, so daß der kostbare Schnaps über den Tisch rann und zu Boden tropfte. „Er versteht nichts vom Moralischen“, schrie er, immer wieder vom Lachen unterbrochen, „und das will er mir weismachen. Hockt hier einsam in der Jagdhütte, obwohl er kein Kreisleiter ist und keine Instanz zu fürchten hat und niemand ihn vor Gericht zieht. Warum denn? Wozu geht ein Mann in die Einsamkeit? Zu nichts anderem, lieber Herr, als weil ihn der oberste Gerichtsherr, hier, das Gewissen, vor Gericht zitiert hat. Stimmt’s? Glauben Sie nur nicht, daß ich eine Antwort von Ihnen erwarte. Aber es stimmt. Und das wars, was ich sagen wollte. Nicht daß die braunen Herren uns das moralische Rückgrat gebrochen haben. Wir waren nicht einverstanden, wie? Wir haben dagegengeflüstert. Wir haben mal einem alten Juden über die Grenze geholfen, und ein paar Millionen haben wir verrecken lassen. Wir haben gewispert und geklatscht. Wir haben den Kopf gewiegt wie die Jerusalemiten, wenn’s denen gut ging. Und haben uns die Hände gerieben, wenn’s den andren immer näher an den Kragen ging. Aber getan ... getan haben wir gar nichts. Der liebe Gott, dachten wir, wird’s schon machen. Ist das Gottvertrauen? Im Gegenteil, lieber Herr, es ist Gotteslästerung. Wahrscheinlich, da Sie nichts vom Moralischen verstehn, verstehn Sie auch nichts von Gott.“
„Prost“, sagte Paul, „Sie moralischer Gottesmann.“
Der Alte stand auf. Er legte Paul seine beiden Hände auf die Schultern und sah ihn mit verschwimmenden Augen an. Und doch war in diesen Augen eine Stärke und Kraft, der sich Wolffenau nicht zu entziehen vermochte. Ja, es schien, als wenn die schmalen, geschickten Hände des Zahnarztes ihn mit schweren Gewichten niederdrückten.
Er machte eine abwehrende Bewegung, um diese drückenden Hände loszuwerden. Bröseke aber sagte ganz leise und bestimmt: „Nein, ich lasse Sie nicht los. Und mit Ihren Schlagworten schlagen Sie mich nicht tot. Gottesmann und Zahnarzt ... das paßt nicht zusammen, wie? Und wenn Sie denken, ich sei einer, der am Sonntagmorgen in die Kirche läuft und mit zehn würdigen alten Damen zusammen ‚Wie schön leuchtet der Morgenstern‘ plärrt und sich von Pastor primarius Scharun einen klaren Bibeltext verunklaren läßt ... dann irren Sie. Soweit bin ich kein Gottesmann. Aber ich habe den Leuten nicht nur in den Rachen geguckt, sondern manchmal auch darüber nachgedacht, warum die Welt so beschissen ist, wie sie ist. Und manchmal war’s mir so wie Ihnen jetzt. Ich wußte nichts übers Moralische und wußte nicht, wo Gott wohnt. Genau wie Sie jetzt. Ich hatte nicht ganz Ihr überlegenes Lächeln. Wahrscheinlich stellen Sie in der Welt mehr dar. Um so schlimmer für Sie, daß Sie nicht mehr wissen und nicht mehr spüren und nicht mehr hören. Nichts. Nihil. Nihilismus ... langweiligster Nihilismus, Sie Herr mit dem wölfischen Namen.“
Er setzte sich erschöpft, wischte den Schweiß von der Stirn und trank wie verdurstet in kleinen, hastigen Schlucken.
Jetzt war es an Paul, einzugießen, und er tat es mit sicherer Hand. Nur die Flasche wankte ein wenig, als er sie wieder auf die Tischplatte setzte, und klirrte gegen die Gläser. Er hob sein Glas und hielt es gegen das Licht, als könne er in der hellen Flüssigkeit etwas erkennen. „Was wollen Sie eigentlich von mir?“ fragte er abwehrend und unwillig.
Bröseke antwortete lange nichts. Er saß versunken in seinem Sessel und war weit weg. Dann aber kam endlich die Frage bei ihm an, und er schaute auf.
„Was ich von Ihnen will? Komische Frage. Gar nichts. Nihil. Leben Sie doch, wie Sie wollen. Denken Sie doch, was Sie wollen. Bitte schön, geht mich gar nichts an. Aber manchmal haben Sie in den Spiegel gesprochen, in den grünlichen, blinden, hier, des Nachts. Nicht wahr? Und so habe ich mir erlaubt, auch mal in den Spiegel zu sprechen. Sie, Wolffenau, waren der Spiegel. Aber das gefällt natürlich keinem, wenn man ihm sagt: So war ich auch einmal. Genau so. Nihil. Nichts. Bis ich eines Tages da drinnen am Kamin saß — ist ja nun weggewischt, die Granaten haben ihn weggeputzt — saß also und ... na, was tut man schon? Man trinkt und denkt, man kann’s ertränken, und meist gelingt es auch, daß man in den Nebel hineinkommt, den warmen, behaglichen Nebel. Aber manchmal wird man auch klar. So wie heute. Klar, obwohl die Hände zittern. Na ... damals also war ich klar. Und da wußte ich plötzlich: Gott hat eine Botschaft für jeden Menschen, eine gute Botschaft, ein Euangelion, und er ruft so lange, bis wir ihn hören. Wer sie aber nicht hört, nie, bis an sein unseliges Ende, der ist verdammt ... Wer sie aber hört und handelt nicht danach, der ist erst recht verdammt ... Und deshalb, werter Herr, haben wir alle als Verdammte gelebt. Denn wir kannten die Botschaft und lebten nicht danach. Oder kannten Sie die Botschaft nicht?“
Paul antwortete lange nicht. Schließlich sagte er unwillig: „Ich glaube, ich kannte sie.“
Bröseke nickte flüchtig, so als habe er es nicht mehr aufgenommen.
Es war lange ganz still im Zimmer. Man hörte den Wind draußen, obwohl er ganz leise geworden war. Schließlich beugte sich der Alte vor und sagte feierlich: „Das ist gut so. Es wird Ihnen gut gehn, und sie werden lange leben auf Erden.“
Von da ab wurde zwischen den beiden nichts mehr gesprochen. Sie tranken aber kräftig weiter. Die Mischung aus reinem Alkohol und Himbeersaft erwies sich als äußerst wohlschmekkend. Freilich war sie nicht ganz ungefährlich. Denn wenngleich es Wolffenau und auch Bröseke so erschien, als würden sie immer klarer, so klar sogar, daß Wolffenau glaubte, um das Haupt des Zahnarztes eine Art Heiligenschein zu sehn — es war aber nur, weil er durch die Kerze auf ihn blickte —, so konnten sie ihre Beine doch nicht mehr allzu gut gebrauchen. Wenn nun einer mal das Bedürfnis spürte, ins Freie zu gehn, so konnte er es nicht mehr, ohne daß der andre ihn unter allerlei Beschwörungsformeln und Ermunterungen aus seinem Sessel hochhievte. Der andre wiederum, der den einen zu stützen sich bemühte, war selbst ein schwankendes Rohr im Winde. So wurde jede Expedition ein rechtes Abenteuer, bei dem es zunächst darauf ankam, die recht schmale Tür zu treffen und über die Balken das Freie zu gewinnen. Später kürzten sie die Expeditionen etwas ab und blieben, wie kleine Bäume schwankend, in den Trümmern stehn. Schließlich hatte es ja nun schon monatelang in das ehemalige große Zimmer hineingeregnet.
Wann Bröseke aufgebrochen war, konnte Paul nicht feststellen. Als er aufwachte, schien die Sonne warm und hell ins Zimmer. Der Schnaps mußte von bester Qualität gewesen sein. Denn er hatte keine Kopfschmerzen. Von den drei Flaschen beschwert, lag ein kleiner Zettel auf dem Tisch. Darauf stand: „Der Kaffee liegt unter dem Sessel. Sie werden ihn nötig haben. Die Kammer überlasse ich Ihnen. Ein Sack Zement steht unten im Keller. Sie könnten für mich einen kleinen Anbau mauern. Oder sind Architekten zu fein dazu? Dr. Bröseke, Zahnarzt aus Krössien, ehemaliger Besitzer eines Jagdhauses.“
Paul kochte sich einen starken Kaffee. Er trank ihn hastig. Er hatte jetzt viel zu tun. Bis zum Mittag schleppte er in einem alten Korbe feinen Flußsand von der Elbe herauf. Nachmittags mischte er Sand und Zement zu einem guten Mörtel und begann die erste Mauer aufzurichten, indem er Stein um Stein aus dem Trümmern herauszog, sauber klopfte und sorgsam setzte.
In der Brombeerzeit wurde der Wald lebhafter. Schon morgens gegen fünf hörte man die ersten Leute aus der Stadt durch den Wald lärmen, und nur, wenn sie gute Brombeerstellen gefunden hatten, wurden sie stiller, um den anderen nicht zu verraten, daß es hier etwas zu ernten gab. Und in der Pilzzeit kamen ganze Horden an, um nach Pfifferlingen zu suchen, die orangegelb in den Kiefernschonungen wuchsen, nach den braunsamtenen Steinpilzen, die man bisweilen in den jungen Eichenwäldern fand, den Königen unter den Pilzen, die selten geworden waren wie die Könige heutzutage, nach den rotstengeligen Hexenpilzen, an die sich nur die Kenner wagten, nach Ziegenlippen, die wie Korallenschwämme an den Baumwurzeln wucherten, und den vielerlei Röhrlingen, die bei der sehr nassen Witterung so leicht verfaulten und in allen Zuständen der Verwesung in sich zusammensanken. Dazu kamen, von der Angst vor dem herannahenden Winter aus ihren Zimmern herausgescheucht, die Holzsammler aller Stände und jeden Alters mit den seltsamsten Karren, Puppenwagen, Traggestellen und weideten den Waldboden nach Holz ab, sammelten das kleinste Hölzchen auf, den vermorschtesten Kienapfel, und manche trugen sogar in Taschen die Kiefernnadeln weg, um vielleicht später einmal Suppe auf ihnen zu wärmen. Die meisten machten, von dem schlechten Gewissen aller Armen gescheucht, einen weiten Bogen um das Jagdhaus und den seltsamen Maurer, der in einer halb zerfetzten Windjacke, das türkische Seidentuch stets sorgfältig geknüpft, vergnügt pfeifend hinter der langsam aufwachsenden Mauer stand oder auf einem Schemel hockend die Ziegelsteine zurechtklopfte. Manche wiederum gingen direkt auf die Hütte zu und suchten Wolffenau in ein Gespräch zu verwickeln, teils aus Neugierde, teils um von ihm gute Pilz- und Holzstellen zu erfragen, oder auch einfach, um sich ein wenig im Windschatten der Jagdhütte von dem mühsamen und ungewohnten Suchen und Klauben auszuruhn.
Zwei von diesen kamen regelmäßig einmal in der Woche zusammen durch den Wald und rasteten eine Stunde bei Paul: der weißbärtige Sanitätsrat Huhn, ehemals Besitzer eines berühmten Ostseesanatoriums, ein etwas raffgieriger alter Herr, der sich einredete, eines Tages werde „das ungeheure Unrecht“ wiedergutgemacht werden, d. h. er werde wieder in sein Sanatorium eingesetzt werden und gegen gutes Honorar die klimakterische Redseligkeit ehekranker Damen wieder über sich ergehn lassen dürfen, und Louis Gerberstedt, der Dichter und Essayist aus Masuren, der bis zum Jahre vorher mit einer robusten Frau und sechs Kindern auf einem einsamen Bauernhof an einem See gehaust hatte und den Verlust seines Hauses, seiner Bibliothek, seiner gesamten Habe und — wie er erst gegen Schluß der Verlustliste zu bemerken pflegte — seiner siebenköpfigen Familie (sie waren alle auf der Flucht erfroren oder erschossen worden) mit erstaunlichem Gleichmut zu ertragen schien. Gerberstedt war der Bemerkenswertere von den beiden. Ein fast zwei Meter langer Mann, gekleidet in einen immer schäbiger werdenden, grau und violett gestreiften Anzug von schlechtester Auffälligkeit, dessen Hose er unten mit breiten Schnüren zugebunden hatte. Dazu trug er die Uniform der Waldläufer, eine schäbige, kurze, von dem nassen Holz verschmutzte Windjacke. Sein fleischiges, breites Gesicht, dessen Fett langsam unter den Entbehrungen schrumpfte, wurde von einer Geiernase beherrscht und von der riesigen schwarzen Brille, die er auch beim kleinsten Sonnenstrahl trug, verdunkelt. Nahm er die Brille einmal ab, so enthüllte er ein Paar samtbraune Augen von hoher Intelligenz und tiefer Sanftmut. Der Mund war schmal, hart und, wie man es bei etwas unsicheren Frommen häufig findet, etwas verkniffen. Paul hatte vor Jahren Gerberstedts berühmtestes Buch „Stimme Gottes aus Masuren“ mal in den Händen gehabt und achtlos beiseite gelegt. Jetzt hatte der Sanitätsrat Huhn es ihm wieder geborgt, und er versuchte, es aufmerksam zu lesen. Es war ein brünstig-inbrünstiges Buch, das in zuweilen ergreifenden Bildern von den Manifestationen Gottes in der Natur mehr sang, als aussagte und von den Sünden und Anfechtungen des Verfassers mit jener Eitelkeit sprach, von der sich Konvertiten nur selten zu befreien vermögen.
Sie saßen an diesem Septembertage an der eben fertiggestellten ersten Mauer. Der Himmel war halb bedeckt, und zuweilen kam die Sonne und brannte auf die Steine. Vor ihnen standen ein Schubkarren und ein Handwagen, hoch mit Bruchholz beladen, der Vormittagsbeute der beiden Städter. Paul hatte etwas Milch warm gemacht, und seine beiden Gäste tranken in kleinen, gierigen Schlucken.
Der alte Huhn gackerte einförmig sein Klagelied herunter, rechnete, Zahlen aus einem zerfledderten Notizbuch ablesend, seine Verluste vor, die in die Hunderttausende gingen, ungerechnet den entgangenen Verdienst seit Herbst 1944, als man seine kranken Damen aus dem Sanatorium hinausgejagt und eine Heeresschule für eine der berühmten Wunderwaffen hineingelegt hatte, die nachher nie zum Schuß kam. Zum zweitenmal waren alle Ersparnisse zerronnen, alles Erraffte und Erarbeitete ins Nichts versickert. Warum gerade ihm das, einem friedfertigen, ruhigen Menschen, der nichts anderes je gewollt habe, als der leidenden Menschheit zu dienen! Aber unmöglich könne es dabei bleiben, daß die einen noch ungestört in ihrem Besitz säßen und die anderen als Bettler durch die Wälder gejagt würden, um windgebrochenes Holz zu sammeln ...
„Ich wünschte, es wäre nur mehr Wind“, sagte Gerberstedt ungeduldig. „Heute nacht habe ich von einem Sturm geträumt, der mir einen baumstarken Ast auf die Füße warf. Die Zehen wurden mir zu Brei geschlagen. Aber die Freude am Holz war größer als der Schmerz. Leider, als ich aufwachte, war kein Ast da, aber die Zehen schmerzten. Rheumatismus wegen der kaputten Schuhe.“
Der alte Huhn jammerte weiter. Er hatte ein Loch in seinem Ellbogen entdeckt und zählte die Anzüge auf, die er in seinem ehemaligen Sanatorium zurückgelassen hatte, derbe braune aus Homespun, legere blaue und graue Flanellanzüge, zwei nagelneue Fracks, auf schwere Seide gearbeitet beim ersten Schneider von Stettin, der schon im tiefsten Frieden fünfhundert Mark für den Anzug nahm.
„Was wollten Sie alter Mann denn mit neuen Fracks?“ fragte Gerberstedt hämisch. „Mit siebzig Jahren soll man die Eitelkeit lassen und die Sünde in den Schrank hängen. Besser, man täte es schon mit fünfzig. Aber da bekommt der Teufel noch allzuleicht seine natürliche Macht.“
Wolffenau steckte seine Pfeife an. „Wie schön und bequem muß es sein“, sagte er, „wenn man wieder an den Teufel glauben kann. Alles Böse darf man ihm in seinen einen Schuh schieben. Denn wahrscheinlich trägt er doch am anderen Bein einen Huf und kann, wenn er zu sehr über das Pflaster klappert, womöglich heute für einen Kriegsinvaliden gelten.“
Gerberstedt nahm seine Brille für einen Augenblick ab und sah den Spötter durchdringend und mitleidig an. „Die Lästerer“, sagte er merkwürdig sanftmütig, „sitzen auf den billigsten Bänken. Aber oft wendet Gott sich überraschend gerade ihnen zu und hebt sie zu sich empor. So schreibt Nevermann, der schwedische Katholik, ein sehr einsamer glühender Denker inmitten der kalten Protestanten der nördlichen Bezirke. Sie brauchen nicht an den Teufel zu glauben und können sich besonders klug und aufgeklärt dünken, wenn Sie die Fluten des Bösen, in denen wir zu ertrinken drohn, als Menschenwerk ansehn. Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie würden es doch nicht verstehn.“
„Unglaube macht dumm, sagt sicher auch ein Kirchenfürst, vielleicht diesmal ein südlicher“, erwiderte Paul ärgerlich und erhob sich, um an seine Arbeit zu gehn. Er hatte endlich bei Klösters eine richtige Maurerkelle bekommen, und es machte großen Spaß, den Mörtel auf den Stein zu klatschen, ihn kräftig auf die wachsende Mauer zu drücken und das Herausquellende sorgsam abzustreichen. Die Kindlichkeit, die in allem Handwerklichen steckt und die uns kindlich zufrieden und kindisch versunken macht, war ihm noch nie so bewußt geworden wie in diesem Augenblick.
Gerberstedt hatte sich wieder hinter seine Brille versteckt. Am liebsten hätte er Paul versichert, daß seiner festen Überzeugung nach der Unglaube wirklich das Vorrecht der Dummen sei. Aber einmal hatte ihm sein Beichtvater als vordringlichste Aufgabe die Bekämpfung seines sündhaften Hochmutes gesetzt, und zum andern hatte er als eine der fruchtbarsten Übungen für Gläubige in dieser ungläubigen Zeit die „hierarchische Zurückhaltung“ empfohlen, dergestalt, daß man, im Glauben selber fortschreitend, nur das mitteilen dürfe, was die Ungläubigen, in ihrer geringen Erkenntnisfähigkeit und auf niederen Stufen der Entwicklung lebend, auch begreifen könnten. Zwar war ihm der verstockte und rationale Wolffenau tausendmal lieber als der ewig jammernde Huhn, der in seiner materiellen Verzweiflung bald bereit sein würde, die Tröstungen der Kirche entgegenzunehmen, aber er wandte sich jetzt doch an den Sanitätsrat, indem er streng dozierte: „Sinnloses, lieber Huhn, gibt es nicht auf dieser Welt, wohl aber manches, was sich unserer Erkenntnis lange oder auch für immer entzieht. Warum wir aber arm geworden sind, ein Volk, das vor dreißig Jahren noch zu den reichsten der Erde gehörte, zu den taubsten allerdings und zu den redseligsten gleichzeitig auch, ... warum wir arm geworden sind, das scheint so klar, daß man sich fast scheut, es auszusprechen.“
„Genieren Sie sich nicht, Gerberstedt“, sagte Paul vergnügt. „Sie haben ja wenigstens einen Dummen vor sich, und wenn ich auch das nicht kapiere, so macht es nichts. Meine Mauer wird trotzdem größer.“
Der Schriftsteller lachte so herzlich, daß Paul sich wieder mit seinem Hochmut aussöhnte. Dann begann er: „Sie kennen ja mein Haus schon. Den breiten Garten vor dem großen Fenster, Felder von Sonnenblumen in allen Größen jetzt bis zum See hinunter und dahinter das Wasser, in dem sich der ewig wechselnde Himmel spiegelt. Das war mein Blick. Und hinter mir, alle Wände bedeckend auf schönen, breiten Regalen, meine Bibliothek, siebentausend Bände, in dreißig Jahren zusammengetragen, erhungert erst, dann erschrieben, schließlich bei langsam wachsendem Namen aus aller Welt mir ins Haus geschickt. Welch eine summa mundi, eine Übersicht über alle Gedanken aller Zeiten und Völker, in die ich mich Abend für Abend bis in die Nächte hinein vertiefen durfte, genug zu tun, zu denken, zu lesen für ein hundertjähriges Leben.“
„Und daß dies alles nun futsch ist, finden Sie in christlicher Demut prächtig“, rief Paul ärgerlich und klatschte viel zuviel Mörtel auf seinen Stein.
Gerberstedt schüttelte langsam und geduldig den Kopf. „Warten Sie doch, Sie ... Sie Berliner. Haben Sie es immer noch nicht bemerkt, daß kein Berliner zuhören kann? Die verderblichste Eigenschaft dieser begabten Stadt.“
„Lieber Herr“, sagte Paul, „erstens bin ich Rheinländer, wenn Sie mich schon einreihen wollen, und zweitens: wir reden alle lieber, als daß wir zuhören. Hierin machen auch die Herren aus Masuren keine Ausnahme. Und jetzt nach zwölf Jahren Zuhören kann man es den Leuten nicht einmal übelnehmen.“
„Schön“, fuhr Gerberstedt fort, „aber was ich erzählen wollte, scheint mir wichtig, vor allem für unseren Sanitätsrat, dem es jetzt, jetzt in diesem Augenblick auferlegt ist, zu verstehn oder ...“ Er machte eine ablehnende Bewegung, die wohl bedeuten sollte, daß er bei mangelndem Verständnis seine leitende Hand von dem Alten würde abziehen müssen.
„Also ... da bin ich gespannt. Was einem auferlegt ist, muß man ja tragen, einerlei ob man will oder nicht“, murrte Huhn.
„Ich schlief auch in meinem Arbeitsraum“, erzählte Gerberstedt weiter, „man soll sich, wenn irgend möglich, nicht aus der Luft seiner Gedanken entfernen. Und darum hatte ich in einem Wandschrank alles, was ich täglich benutzte und was ich an Kleidern und Wäsche besaß. Viel war es nicht. Aber sechs, sieben Stück mögen es schließlich doch gewesen sein, untadelige Anzüge alles, weil ich zu Hause immer mein Arbeitszeug trug, eine lederne Hose und einen Lumberjack.“
„Damit auch da die Gedanken nicht entschlüpfen konnten, die sich etwa eingenistet hatten“, unterbrach Paul tückisch. „Bedaure nur die arme Frau, die täglich dasselbe bei jeder Suppe sehn mußte.“
Gerberstedt seufzte ungeduldig und sprach schnell weiter. „Ja, ich brauchte das alles gar nicht. Oder hätte es nicht gebraucht. Aber manchmal des Nachts kam es doch über mich, daß ich die andern Möglichkeiten meiner Existenz mir betrachten mußte, die Stadtanzüge aller Farben und Moden, und besonders hatte es mir ein schwarzer Anzug angetan, mit zierlichen weißen Streifen, ein wirklich schönes Stück. Dazu lagen immer parat ein Paar schwere schwarze Seidenstrümpfe und ein Paar ganz leichte und sehr bequeme Lackschuhe. Was glauben Sie? Manche Nacht ließ ich die Seidenstrümpfe durch meine Hände gleiten. Es ist nämlich nicht so, daß ich das Schöne und Angenehme des Lebens, das Leichte und Glänzende nicht spüre und ihm seinen Platz im Leben verweigere. Aber es muß freiwillig genommen und freiwillig abgelegt werden können. Nun ... da war es nichts mehr mit der Freiwilligkeit. Magisch zog mich der Anzug an. Zauberisch, verzaubernd blinkten die Lackschuhe, die ich nachts manchmal, wenn die Bäume rings um das Haus stöhnten in ihrer Einsamkeit und der See sein seltsames Gurgeln anhob, mit braunen Wollappen rieb, bis sie wie Spiegel glänzten, Untergrundspiegel, in denen man nur Glanz sieht und keine Gestalt und keine Form, sondern nur dunkles Feuer. Es war eben die höllische Versuchung.“
Er blickte fragend zu Paul auf, um an dessen Gesicht zu ermessen, ob er weiterreden dürfe. Aber der schien ganz in seine Maurerei vertieft, kniete vor der Richtschnur und warf nur einen flüchtigen Blick auf den alten Huhn, der, den Greisenkopf zwischen die Schultern gezogen, jenes feierliche Zuhörgesicht machte, das er sich für seine Sanatoriumsdamen eingeübt hatte.
„In irgendeiner Nacht“, fuhr Gerberstedt leise fort, „war es dann aus mit meinem Widerstand, und am nächsten Morgen packte ich ein paar meiner seidenen Hemden — auch die hatte ich mir machen lassen, feine Maßhemden, das Stück für 45 Mark —, die schweren Seidenstrümpfe und die Lackschuhe, zog den schwarzen Anzug an und einen langen Wintermantel, leicht, weich und warm und gegen die Mode bis an die Knöchel reichend, und fuhr nach Berlin. Sie denken nun wahrscheinlich, daß mich dort irgendeine der feinen Damen erwartete, um die ich mich in einsamen Nächten verzehrt hatte. Aber das war nicht so. Ich behaupte zwar nicht, daß sie mich nicht angezogen hätten, wenn sie, angemalt wie antike Hetären, gelackt und gepudert, mit hochhackigen Trippelschritten durch die nachthellen Straßen gingen, gefährlich gleißende, verführerisch duftende Blumen, oder wenn sie in den puritanisch strengen und doch mit höchstem Luxus eingerichteten Berliner Salons in Samtsesseln lehnten. Ich behaupte auch nicht, daß ich jeder näheren Begegnung entgangen wäre. Aber das war nicht die Hauptsache, und die Menschen — es sind besonders die Frauen —, die behaupten, daß die Verführungen des Fleisches die sind, die uns am weitesten von uns wegführen, irren oder legen doch wenigstens das Maß ihrer Gewöhnlichkeit auch an die ungewöhnlichen Menschen und urteilen somit im Wortsinne vermessen.“
Wieder ein Blick zu Wolffenau hinauf, um festzustellen, ob nicht wenigstens dieses Wortspiel ihn zu einem Lächeln bringen könnte. Und wirklich lächelte Paul. Aber Gerberstedt verstand ganz gut, daß es eher ein Lächeln des Mitleides als des Einverständnisses war. Ja, es war ein mitleidiges Lächeln, weil der Sechsunddreißigjährige feststellte, daß hier die Kämpfe einer Generation ausgebreitet wurden, über der schon die abendlichen Schatten lagen, und daß das, worum Gerberstedt in wirklich schweren, gefährlichen Kämpfen gerungen hatte, für ihn eigentlich immer schon belanglos gewesen war oder, wie man das früher nannte, höchstens interessant. Was Wolffenau nicht wußte, das war die Tatsache, daß seine Überwindung nicht vermittels eines überwindenden Kampfes vor sich gegangen war, sondern ganz ohne Verdienst, einfach dadurch, daß die Welt in ihren langsamen Drehungen sich aus dem Bereich dieser Probleme weggedreht hatte und anderes, Schweres und Leichtes, Mildes und Scharfes, in die Sonne der Entscheidung hineingedreht worden war.
„Nein“, fuhr Gerberstedt fort und langte nach Wolffenaus Tabaksbeutel, den dieser ihm gönnerhaft hinhielt, „das alles war es nicht. Sondern es waren zuerst einmal die ganz gewöhnlichen Versuchungen des leichten, leeren Zivilisationslebens, die mich anzogen. Das morgendliche lange Bad im Luxushotel, dem man noch ein nächtliches bei der Heimkehr aus den Gesellschaften hinzufügen konnte, die herrliche Weichheit und Anschmiegsamkeit der Hotelmatratzen, die leichten Leckereien der Bars und Eßparadiese mit den schweren Weinen und den buntfarbigen Drinks, die ölig schnurrenden Autos, von denen einer meiner Anhänger mir einen schwarzen Ford mit roten Lederpolstern zur Verfügung stellte, mit einem jungen Taugenichts von Fahrer in riesigem Gehpelz, mit gräflichen Manieren und profunden Kenntnissen von allen Etablissements ...“
„Hören Sie auf“, stöhnte Huhn und riß an seinem Bart wie weiland Hiob in seinen dunkelsten Stunden.
Gerberstedt sah leer über ihn hinweg und sprach weiter: „Das alles war es immer noch nicht. Nicht das Eigentliche. Es war nur die Untergrundsmelodie, eine freilich angenehme, sehr singbare Weise, zu deren Musik ich über die kraftvollen und wohleingedämmten Flüsse der Zivilisation dahinschwamm. Das Wesentliche war der Weihrauch, der mir gespendet wurde, der Honig des Ruhms, von dem ich Tag und Nacht schlecken durfte, im kleinen Kreise kluger Männer und schöner Frauen, in größeren Gesellschaften, auf denen sich der Kreis der Zuhörer schließlich doch immer nur um mich sammelte. An Vorlesungsabenden, an denen ich aus meinen Erkenntnissen und Einsichten wohltönend und predigerhaft vorlesen konnte. Und das alles in einer weichen Luft, in der meine stürmischen Gedanken verblasen wirken, Tiefsinn sich in Absurdität verwandeln mußte und Gottesdienst schließlich — aber das verstehn Sie nicht mehr — in Teufelsanbetung.“
Er hatte die Augen geschlossen. Er atmete schwer und tief. Auch eine Beichte vor Weltkindern schien zu erleichtern. Die Demütigung vor ihnen erhob ihn in den geistlichen Bezirken zu einer angenehmen Überlegenheit. Er lächelte bescheiden. Dann zog er endlich das Fazit. „Für mich also mußte das alles untergehn und zugleich auch meine Zuflucht in der Wildnis Masurens, die ich ja leichtsinnig aufs Spiel gesetzt hatte, samt Frau und Kindern. Und sehn Sie ... so wie ich alles verlieren mußte und nun wie ein Bettler leben muß, franziskanisch einfach und ohne andere Ablenkung als die Abwehr der äußersten Not und Notdurft, so bitte ich Sie, das nur als Beispiel zu nehmen. Gott — oder, wie Sie sagen werden, das Schicksal — hat mir und uns das Unnütze genommen, das Versucherische, das Ablenkende und Glänzende, und uns auf den Weg nach innen gewiesen. Von da aus, aus der Tiefe wirklicher Leibesnot, aus dem Abgrund der Sünde und Schuld, in den wir mehr hineingefallen sind, als geführt wurden, kann uns nun die Einsicht in die wahre Natur des Menschen und der Dinge und in das, was uns wirklich not tut und nötig ist, herausretten.“
Endlich schwieg er. Aber es schien, daß er noch einiges hinzuzusetzen hatte, und deshalb sagten die beiden Zuhörer nichts. Paul war mehr abgestoßen als angezogen von dieser Beichte, wenn ihn auch einige Worte getroffen und angerührt hatten. Aber darüber stand ein kleiner Spott. Denn es schien ihm recht einfältig und andererseits grandios hochmütig, daß zur Errettung des Herrn Gerberstedt aus seinen Versuchungen eine siebenköpfige Familie, ja ein ganzes Volk geopfert werden mußte, und er fand, daß der Schriftsteller dieses Opfer allzu großmütig seinem Gotte vergab. Wahrscheinlich hätte er das auch gesagt. Aber in diesem Augenblick geschah etwas, was ihn bis zum Entsetzen ablenkte. Unten nämlich, in der kleinen Talsenke, die sich vor dem Jagdhaus hinzog, kam eine Frau vorüber, genau wie die anderen auf Pilz- oder Brombeerjagd oder auf Holzsuche, mit einer großen Markttasche in der Hand und einer Jagdtasche am Schulterriemen. Sie ging ziemlich schnell. Unzweifelhaft trug sie das kirschrote Complet der toten Gertie, und eine Sekunde lang war es Wolffenau wirklich, als ob die sehr geliebte Tote vorüberginge. Dann fiel es ihm natürlich ein, es müßte jene Frau vom Bahnhof der Verdammten sein, und er dachte, er sollte sie laufen lassen. Was ging sie ihn an? Er zögerte. Dann ließ er sein Werkzeug fallen und ging, ohne an seine erstaunten Gäste ein Abschiedswort zu richten, sehr schnell hinter ihr drein.
In dem sanft geschwungenen Tal hinter dem Jagdhaus wuchsen am sandigen Hang kleine, vom Flußwind hingesamte Akazien, Himbeeren, die schon vergilbt waren, und Brombeeren, deren Laub sich rot zu färben begann. Paul konnte die Frau nicht gleich entdecken. „Hallo!“ rief er, „hallo!“ und ärgerte sich gleichzeitig über sein albernes Benehmen. Was wollte er von der Frau? Wollte er sich seiner edlen Tat, seiner großmütigen Geschenke rühmen? Nein — das war es nicht. Er folgte vielmehr magnetisch angezogen und wider Willen jenem kirschroten Complet, obgleich er wußte, daß diese Begegnung nur schmerzliche Erinnerungen bringen würde, Bilder, die halb vergessen waren und die er, da sie nie wieder Leben werden konnten, besser vergaß. Oder soll man nicht vergessen, dachte er? Soll man sich tapfer dem Schmerz stellen und ihn Auge in Auge niederringen? Er fühlte es in diesem Augenblick, daß er immer wieder versucht hatte, schmerzlos zu leben, voller Spott über die Jammertaltanten und Schmerzsusen, die im Schmerze wühlten wie die Wildschweine im Kartoffelacker, bis alle Früchte herausgewühlt waren. Darum hatte ihn dieser unausweichliche Schmerz getroffen, damit er ... wie? ... ja, damit er das Leben in seiner ganzen Fülle erkannte und nicht nur in der Magerkeit der Freuden, in seiner dunklen Tiefe und nicht nur in der glatten, besonnten Oberfläche. Immer hatte er ausweichen können. Selbst im Kriege, der zu schaurig war, um zu packen, zu gräßlich, um ihn anzurühren, zu unvernünftig, um die Grundfesten seines auf Vernunft gegründeten Lebens zu erschüttern. Und nun ging er also durch das Unterholz und suchte den unausweichlichen Schmerz der Erinnerung an endgültig, unwiderruflich Verlorenes. „Hallo!“ und noch einmal ärgerlich und kindisch ungeduldig: „Hallo!“
Er stolperte beinahe über sie. Sie saß hinter einem Brombeerstrauch, die Arme um die Knie geschlungen, den Blick etwas starr geradeaus gerichtet. Sie trug zu dem kirschroten Complet dasselbe blaue Kopftuch wie damals auf dem Bahnhof. Es paßte in der Farbe nicht zum Kirschroten. Der Schlangenring mit der Perle fehlte. Aha! Verkauft. Aber den Trauring trug sie noch.
„Da sind Sie ja“, sagte Paul, „warum antworten Sie nicht?“
Sie wandte ihm ihr feines, rundes Gesicht zu. „Wie sollte ich wissen ...“, fragte sie gleichgültig.
Paul sah aufmerksam zu ihr hinunter. Sie schien jünger geworden zu sein. Das lag nicht nur daran, daß die Augenbrauen wieder gut ausrasiert waren, daß sie sich sorgfältig geschminkt und den kleinen Mund voller ausgemalt hatte. Es lag vielmehr in der Kindlichkeit eines langsam aufkeimenden Lächelns, zu dem die ernstbleibenden, forschenden Augen in einem auffallenden Gegensatz standen. Paul wußte im Augenblick eigentlich nichts zu sagen. „Sie sind schon ein paarmal an meinem Jagdhaus vorbeigekommen“, log er.
Zu seinem größten Erstaunen nickte sie: „Ja ... ich sah Sie da stehn und eifrig mauern. Sie pfeifen laut, aber nicht sehr schön.“
Paul lachte: „Und Sie pfeifen wahrscheinlich ausgezeichnet. Ganz leise, wie ein Vogel von fern, nicht wahr?“
Sie nickte gleichmütig: „Ja ... ich kann schön pfeifen. Sehr schön sogar. Aber das ist so ziemlich alles.“ Sie stand auf, ärgerlich, daß sie mit dem fremden Mann so vertraulich sprach. Sie klopfte sich den Rock ab und wandte sich zum Gehn.
„Sind Sie nun gut untergekommen?“ fragte Paul.
Sie nickte zerstreut und ablehnend. Dann fiel ihr die merkwürdige Art der Frage erst auf. „Ich könnte ebensogut zu den Eingesessenen gehören. Die sammeln ja auch Holz.“
Paul war ärgerlich, sich doch beinahe verraten zu haben. „Nein, nein“, sagte er, „die Einheimischen kennen die besseren Beerenplätze, und passen Sie mal auf: Eine Viertelstunde weiter in den Wald hinein finden sie die Schneise der Autobahn, die nicht fertig wurde und nun vielleicht nie mehr fertig werden wird. Die müssen Sie überqueren und dann ... aber nein ... Sie finden das nicht. Wir müssen mal zusammen hingehn.“
Sie sah ihn forschend an. „Ich weiß nicht“, sagte sie zögernd, „Brombeeren könnte ich zwar gut gebrauchen ...“
Paul lachte: „Sie sind ganz hübsch ehrlich. Mich können Sie also nicht gebrauchen.“
Sie zuckte die Achseln. „Ich bin keine sehr amüsante Gesellschaft“, sagte sie ausweichend, „und Sie sehn so aus, als lebten Sie vergnügt und recht zufrieden in Ihrer Haut.“
Wolffenau sah sie betroffen an. Also vergnügt und zufrieden wirkte er. Gut so. Er schätzte es nicht, wenn man ihm seine Stimmungen, seine Sorgen und Kümmernisse ansah. Es waren ja seine Kümmernisse, die ihn allein angingen. Mit Gertie, die, genau wie er, ihre Launen gern für sich hatte und sich sehr ärgerte, wenn man sie ihr anmerkte, hatte er oft das Ratespiel gespielt: Welcher Laune bin ich? Und wer richtig geraten hatte, konnte vom anderen verlangen, daß er sofort eine bessere Stimmung einschaltete. Man konnte das viel besser, als man glaubte, wenn man sich nur Mühe gab. Warum also ärgerte er sich ein wenig, daß diese fremde Frau ihn für vergnügt und zufrieden hielt, während er in Wirklichkeit zornig auf das Schicksal war, mit dem Himmel haderte und die Trauer ihn ganz und gar überflutet hatte? War er in seiner Einsamkeit schon so teilnahmebedürftig geworden? Dann war es höchste Zeit, wegzugehn und die Mauer des Herrn Bröseke ungemauert zu lassen. Der gottsuchende Zahnarzt hatte sich sowieso nicht wieder blicken lassen.
„Es geht mir auch ausgezeichnet“, sagte er, und indem er ihr die Hand hinstreckte: „Also ... Sie kommen mal in den nächsten Tagen vorbei. Heute kann ich nicht. Ich habe nämlich Besuch.“
„Ich weiß“, lachte sie, „Gerberstedt hockt an Ihrer Mauer.“
„Kennen Sie ihn?“ fragte Paul betroffen.
Sie schüttelte leicht den Kopf. „Er las neulich in der Kirche etwas aus seinen Werken vor. Die Stimme ist ganz hübsch. Nur das Ostpreußische! Man soll keinen Dialekt sprechen. Höchstens zu Hause. Man rennt ja auch nicht in Unterhosen über die Straße.“
„Und was er sprach ... wie war denn das?“
„Er ist sehr stolz, daß er gläubig ist“, sagte sie. „Mich stört das ein bißchen. Denn was hilft das den andern?“
„Glaube ist, glaube ich, ansteckend. Aber wir beide sind wohl immun. Das liegt am Jahrgang.“
Sie gab ihm endlich die Hand. „Ein bißchen jünger bin ich ja doch“, sagte sie abweisend. „Also wenn ich sehr hungrig bin auf Obst, komme ich vielleicht mal vorbei.“
Paul nannte seinen Namen. „Und wie heißen Sie?“
„Maria Andersson.“
„Wie der Märchenonkel?“
„Nein ... mit zwei S und einem O.“
„Klingt eigentlich hübscher. Voller.“
„Adieu.“ Damit ging sie, nachdem sie ihre leere Markttasche aufgenommen hatte, den jenseitigen Hang hinauf.
Paul sah ihr nach. Sie hatte einen schönen, freien Gang trotz der hochhackigen verschlissenen Seidenschuhe, die sie immer noch trug. Paul wünschte sich, daß sie sich noch einmal umschaun sollte, und wirklich blieb sie drüben stehn und winkte mit ihrer Tasche. „Auf Wiedersehn also“, rief Paul. Aber sie antwortete nicht. Er lief eiligst zurück, als wäre es sehr wichtig, mit der Mauer weiterzukommen. Die beiden Herren waren schon weggegangen. Paul war froh darüber, obgleich er Gerberstedt gern mit seinem Glaubensstolz aufgezogen hätte.
Es wurde ein sehr schöner Tag. Die Sonne schien klar und sauber. Paul mauerte und pfiff. Mit dem Abendnebel allerdings, der wie an jedem Abend vom Fluß heraufwehte, kamen die Schmerzen wieder. Die Schmerzen? Nein, es waren keine Schmerzen. Es war eine ungewisse Schwermut, wie er sie nie gekannt, eine Melancholie, die er früher als Alterskrankheit verspottet hatte. Oder zogen sich doch schon die ersten septemberlichen Altweiberfäden durch sein Leben? Er saß zwei Stunden lang gedankenlos in seinem Sessel, aß, ohne zu schmecken, was er aß, trank einen Becher heißer Milch und schlief ein.
Natürlich träumte er wieder. Maria Andersson kam am Jagdhaus vorbei und sah in das Fenster hinein. Aber sie hatte kein Gesicht, sondern trug unter ihrem blauen Kopftuch den bleichen, leuchtenden Vollmond. „Nehmen Sie endlich das Kopftuch ab“, sagte Paul unwillig. Einmal muß ich ja schließlich wissen, was Sie für Haare haben.“ Der blanke, augenlose, mundlose Vollmond antwortete nicht. „Lassen Sie doch diese alberne Verkleidung“, stöhnte Paul. „Der Mond am Himmel mag eine angenehme Naturerscheinung sein, obwohl ich schon immer gesagt habe, daß er häßlich ist, und nur sein Licht ... ja, das mag schön sein. Gehn Sie ruhig unter, Maria.“ und plötzlich fiel die Mondmaske metallen klirrend ins Zimmer. Aber es stand nicht Maria da, sondern Gertie. Sie trug allerdings Marias blaues Kopftuch, und er verwies ihr das unwillig. Erstens gehöre es ihr nicht, und vor allem: Blau zu Kirschrot ... eine Zusammenstellung, die man eigentlich selbst einem Flüchtling nicht verzeihen dürfe. „Nimm doch mal endlich das Kopftuch ab“, wiederholte er hartnäckig. „Ich muß ja schließlich wissen, was du für Haare hast.“ Sie antwortete nicht. Im Traum stand Paul auf und ging auf das Fenster zu, um ihr das Kopftuch abzureißen. Dabei stieß er an die Mondmaske, die hell aufklirrte. Er bückte sich nach ihr und versuchte, sie vom Boden aufzuheben. Sie war so schwer oder von magnetischen Kräften am Boden gehalten — richtig, die Anziehungskraft der Erde, dachte Paul mit scharfsinniger Traumlogik —, daß er sie nicht von der Stelle zu bewegen vermochte. Aber plötzlich wurde sie ganz leicht, und ehe er sie noch in Kniehöhe hatte, war sie zwischen seinen Händen zerflossen. Er lachte hell auf. Daß er immer wieder vergaß, wie sehr Gertie voller Schabernack steckte! Kein Tag verging, ohne daß sie irgendeinen tiefsinnigen Unfug anrichtete, den mit einem noch größeren Unsinn ernst zu beantworten immer sein Ehrgeiz gewesen war. Nur nicht es sich merken lassen, daß er ihr aufgesessen war! Er blickte zu ihr hin. Tatsächlich: sie sah ihn mit jenem unschuldigen Ernst an, der immer ein Zeichen war, daß sie noch einen Spaß vorbereitete, der den ersten Spaß übertrumpfen würde. Er ging auf sie zu. Er beugte sich zu ihr und faßte sie um die Schulter. Seltsam, daß er die Schulter nicht fühlte, obwohl er sie doch in der Hand hielt. Ein Schauer überlief ihn. „Mach keinen Unsinn“, sagte er ungeduldig, „weg mit der Maskerade! Nimm das Tuch ab!“ Sie sah ihn mit einem immer gleichbleibenden Ernst an, und dadurch spürte er, daß etwas Furchtbares kam. Aber er konnte nicht begreifen, worin dieses Furchtbare bestehn könnte. Denn er hielt sie doch endlich im Arm, wenngleich er sie nicht spürte. Aber das würde ja wiederkommen. Nach so langer Trennung kann man einander schon so fremd werden, daß die Hand nicht mehr die Schulter wiederzuerkennen vermag. Er griff mit der freien Hand nach dem Kopftuch und wollte es ihr herunterzerren. Er sehnte sich nach dem seidigen Fall und Glanz der Haare. Aber sie hielt blitzschnell seinen Arm fest und flüsterte entsetzt: „Nein, nein ... das geht doch nicht. Ich bin schon zu lange tot.“ Und als er sie erstarrt ansah und begriff, daß sie ja die Wahrheit sagte, begann sie zu weinen. „Du bist zu spät gekommen“, schluchzte sie, „nun laß mich auch.“ Damit war sie verschwunden, und Wolffenau wachte auf.
Er stand im Rahmen des Fensters, das er schlafwandelnd geöffnet haben mußte. Seine Hand, die er ins Mondlicht hielt, war naß. Daß man im Schlaf weinen kann! dachte er erstaunt. Und plötzlich sagte er ernst und feierlich: „Tatsächlich ... sie ist tot.“ Er fiel damit in die Gewohnheit des Selbstgespräches zurück, die er nach dem Besuch von Bröseke, nachdem also die Zeit der Einsamkeit vorbei gewesen war, abgelegt hatte. Also war die Einsamkeit noch nicht vorbei, noch lange nicht, und obwohl er es von Tag zu Tag genauer wußte und tiefer begriff, daß Gertie wirklich tot war, obwohl der Traum es ihm erneut gemeldet und in Bildern gezeigt hatte, ganz genau mit aller Schärfe, hatte er es noch nicht begriffen.
Daß unsere Toten für sich selbst nur einen Tod sterben müssen, sollte uns ein Trost sein. Wir haben es schwerer. Denn in uns sterben sie viele Tode, und jeder Tod erneuert den Schmerz um sie.
Drei Tage lang regnete es. Das Jagdhaus war eingeschlossen von Wasser. Der Wald blieb ausgestorben, und vom Fluß her blies ein tückischer Westwind. Zuweilen gab es auch Regenpausen, in denen Wolffenau auf Pilzsuche gehn konnte. Jedesmal brachte er eine tüchtige Ernte mit nach Hause. Selbst Steinpilze konnte man bei diesem menschenvertreibenden Wetter finden. Jeden Abend briet er sich eine große Portion in der Pfanne. Es hätte gut für zwei gereicht. Ja — er wartete auf Maria Andersson.
Als er an diesem Nachmittag unbedingt ins Dorf mußte, weil er nichts mehr zu rauchen, nichts mehr zu trinken und kein Brot mehr hatte, heftete er einen Zettel an die Tür, in dem er sie bat, zu warten. Er würde sich beeilen, wiederzukommen. Und nun lief er atemlos die drei Kilometer zurück. Zwei Flaschen Wein, gekauft für ein unsinniges Geld, hatte er in seinem zum Tragkorb umgearbeiteten Koffer. Wenn er noch viele solcher Dummheiten machte, würde er mit seinem bißchen Geld bald zu Ende sein und früher an die Arbeit gehen müssen, als er wollte. Oder Paul I. um Geld angehn. Sicherlich würde er noch über ein beträchtliches Vermögen verfügen. Zwei seiner Fabriken liefen schon wieder. Die Bäuerin Pulvermann, die ihm in letzter Zeit manchmal ein Brot schenkte, weil er zu mager sei und „Männer immer viel essen müssen“, hatte es ihm gerade erzählt. Es war übers Radio gekommen. Paul dem Ersten stand also das Radio schon wieder zur Verfügung! „Dem Tüchtigen hilft Gott“, würde er sagen. Das war seine einzige Beziehung zum Himmel. Nein ... er wünschte nicht, von seinem Vater Geld zu nehmen. Das hatte er seit sechzehn Jahren nicht getan, und er würde es nie tun. Lieber als Maurer gehn.
Da lag also die Hütte im Regen. Eine sehr elegante Lösung würde das werden mit dieser leisen Rundung der Mauer, die dem Jagdhaus etwas Abweisendes geben würde, etwas „an und für sich Seiendes“, wie Cassembert es ausdrücken würde. Wenn der alte Bröseke ihm noch ein paar Balken lieferte, würde das Dach bald fertig sein. Schon waren die ersten Balken aufgesetzt.
Er ging sehr schnell auf seine Tür zu. Der Zettel war weg. Also hatte sie ihn gefunden und war da. Nein ... die Tür war verschlossen. Als er den Schlüssel hinter einem Balken vorkramte, sah er das Papier auch liegen, vom Wind heruntergerissen, aufgeweicht und verschmutzt. Er nahm es und öffnete. Drinnen zündete er das Feuer an und warf den Zettel hinein. Strafe muß sein. Ärgerlich schnitt er sich ein Stück Brot und entkorkte eine Flasche Wein. Mußte er etwa auch mit dem Wein auf sie warten? Das wäre ja noch besser! Das war doch das einzig wirklich Schöne an seiner Zurückgezogenheit gewesen, daß er einmal ganz und gar nicht abhängig gewesen war von einer Frau, daß er keine Rücksicht zu nehmen hatte, schlafen konnte, wann er wollte, aufstehn, wann es ihm paßte, arbeiten oder nicht arbeiten, wie ihm zu Sinne war, lesen, wann er mochte und solange es ihm Spaß machte. Er holte sich Gerberstedts „Stimme Gottes aus Masuren“ aus der Ecke und setzte sich bequem. Eigentlich schade, daß er Gerberstedt kannte und nun sein fleischiges Gesicht vor sich sah, die hinter der dunklen Brille versteckten Augen und daß er sein breites Ostpreußisch hörte. Man geht ja auch nicht in Unterhosen auf die Straße, hatte die Andersson gesagt. Er schmunzelte. Dann las er.
„Gott hat die Welt so geschaffen, wie sie ist, und hat es dem Menschen nicht gegeben, die Vollkommenheit der Schöpfung zu erkennen, die ja da sein muß, da Gott vollkommen ist und die Welt seine Emanation. Was wir also an Unvollkommenheiten sehn, das ist nicht tatsächlich da, sondern liegt an der Unvollkommenheit unseres Sehns, Begreifens und Fühlens. Je besser wir sehn lernen, je tiefer wir begreifen, je demütiger wir fühlen und uns einfühlen, um so mehr nähern wir uns der aus Gott kommenden Vollkommenheit der Schöpfung. Statt nun aber diesen schwierigen Prozeß auf sich zu nehmen, durch welchen sich in einem wahren Gottesdienst der Zustand der Welt ständig verbessern würde, wählen die Menschen den bequemen Weg des Reformatorischen und Revolutionären. Durch Reformationen und Revolutionen glauben sie den Abgrund zwischen der eignen Unvollkommenheit, die sich in Abfall und Sünde immer wieder erneuert, und der Vollkommenheit der göttlichen Schöpfung überbrücken zu können. Ach, — die Reformatoren bauen kühne Brücken, direkte Zugänge zu Gott und glauben vor seinem heiligen Antlitz bestehn zu können, glauben mit ihren Eulenaugen in das Licht der Ewigkeit blicken zu dürfen, ohne zu erblinden. Aber sie werden blind und ihre Schritte unsicher, und so stürzen sie von den Brücken und ziehn die Verführten mit sich. Und die Revolutionäre, die Prediger einer ungöttlichen und darum auch unmenschlichen Gleichheit alles Geschaffenen, die Bilderstürmer gegen die heiligsten Bilder der gottgegebenen Hierarchie und Gestuftheit, die Ungläubigen, die mit ihrer eigenen schwachen Kraft den Himmel auf Erden zu verwirklichen versprechen und in ihrem luziferischen Hochmut uns wieder und wieder die Hölle bereiten, brechen sogar die Brücken ab, entzünden sie, und ganze Völker müssen mit ihnen verbrennen.“
Paul ließ das Buch sinken. Warum blieb er bei dieser sorgsam abgewogenen, dieser etwas einförmigen, feurigen Sprache kalt? Hatte Gerberstedt etwa nicht recht? Was hatte das Revolutionäre, was das Reformatorische über die Welt gebracht? Hölle, Krieg und Schwefel. War es nicht tatsächlich so, daß die Bemühungen des Menschen um die Verbesserung der Welt erst recht alles verdarben? War nicht die große Geduld, das gläubige Einfühlen in den Willen des Schicksals das einzige, was die Menschen noch nicht versucht hatten? Denn sonst: wie waren sie eifrig, wie waren sie bemüht, wie kämpften sie tapfer, unter ungeheuren Opfern! Für gute, leicht einsehbare Verbesserungen, für vortreffliche, segensreiche Einrichtungen, für biologische, ökonomische, philosophische Erkenntnisse, die umzusetzen eine Kleinigkeit war, wenn die Menschen sich nur ein bißchen Mühe gaben. Welche Einsicht, welcher gute Wille, welche Art von Vernunft war noch nicht in Worte gefaßt und in Aufrufen und Dekreten ans Licht gekommen? Und das Ergebnis? Null. Kein Glück, kein Friede, keine Vernunft, nicht die einfachste Möglichkeit, daß auch nur zwei Menschen in Frieden miteinander leben konnten. Also mußte man alles so laufen lassen, wie es lief? Und mußte die Reformatoren und Revolutionäre schleunigst immer gleich in den Abgrund werfen, aus dem sie emportauchten, ehe sie die Menschheit in weiteres Unglück hineintreiben konnten? Ja — von diesen aufgeregten Zeiten her, in denen alles umgestürzt war und das Unterste, das durchaus nicht das Beste war, zu oberst gekehrt, in denen sich Menschen zu Herren der Menschen machten, die gar nichts vom Menschenwesen wußten, in der das Diktatorische die Menschen legionenweise im Dienste von revolutionären Ideen aufopferte, und nichts kam dabei heraus ... von hier aus gesehn hatten die ruhigen Zeiten, die gleichmäßigen, in Gott lebenden Epochen vielleicht etwas Anziehendes, und Gerberstedt hatte es leicht, für sie zu werben.
Aber so einfach lagen die Dinge doch nicht. Die Frommen und Geduldigen hatten ja auch eine Zeit ihrer Herrschaft gehabt. Oder wenigstens hatten sie Macht ausgeübt durch ihre Kirchen. Wie kam es denn, daß die Kirchen unfähig waren, die soziale Frage zu lösen, daß sie hinter allen Entwicklungen der materiellen Welt dreinstolperten und der kleine Mann erst in der Hölle eines menschenunwürdigen Daseins verschmachten mußte, ehe sie sich überhaupt auf sein Dasein besannen? Warum war die katholische Kirche nicht die Fürsprecherin, nicht die erste Führerin des Proletariats gewesen, damals, als es wirklich noch ein Proletariat gab? Wieso forderte sie nun, da die Proletarier aus eigener Kraft zu Arbeitern, zu gleichberechtigten Menschen geworden waren, daß sie sich bei ihr bedankten? Mochte es nicht in den Lehren der Kirche und schon gar nicht in den Lehren Jesu begründet sein ... wer wollte denn leugnen, daß bei Begräbnis und Taufe, bei Hochzeit und Kommunion die Reichen auf den besseren Plätzen saßen, daß sie die angesehenen Mitglieder der Gemeinde waren und daß es demnach immer so aussah, als ob auf Erden jedenfalls die Reichen Gott wohlgefälliger seien als die Armen! Er erinnerte sich noch genau, mit welchen demütigen Verbeugungen die Prälaten und Kaplane und Pfarrer in das Haus seines Großvaters Alexander Wolffenau gekommen waren und wie die Pastoren und Superintendenten seinen Vater untertänig behandelten, der auf Wunsch seiner hugenottischen Frau, der Komtesse Mossigny, zum Protestantismus übergetreten war. Die Reformationen und Revolutionen richteten sich also nicht immer, wie es Gerberstedt behauptete, gegen Gott, sondern manchmal auch gegen seine kleinen und ungetreuen Verwalter auf Erden, gegen die Verfälscher der Lehre Jesu, gegen die Mächtigen, die vor dem Thron als schwer zu erstürmende Barrikade den Altar schützend aufbauten, um jeden Aufstand gegen die Herrschenden als einen Aufstand gegen Gott diffamieren zu können. Ein famoser Trick eigentlich, der, wie man es gesehn hatte, auch dann noch zog, als die Throne versunken waren und die Altäre ihre Macht eingebüßt hatten. Selbst der Diktator bemühte die Vorsehung und den Allmächtigen, um jede gegen ihn gerichtete Aktion, ja jede Mißbilligung als Gotteslästerung mit dem Tode bestrafen zu können. Nein, nein ... die Gläubigen machten es sich zu bequem. Durch ihr Versagen war der Glaube zu Trümmern und Schutt verfallen. Es war nicht möglich, aus den gleichen Steinen und mit längst Stein gewordenem Mörtel einen neuen Glauben zu errichten. Es hieß also: neue Steine brechen, neuen Mörtel mischen, neue Pläne zeichnen, neue bescheidene Arbeiter heranziehn. Aber das alles war nicht seine Aufgabe. Er war ja ein Ungläubiger, ein ganz und gar Vereinzelter, der sein Leben nach eignen Anschauungen und Wünschen geführt hatte, ohne zu meinen, daß seine Anschauungen und Wünsche für irgend jemanden verbindlich sein müßten. Wie aber kam es, daß ihn in seiner Einsamkeit plötzlich die Gottsucher aufsuchten, Bröseke, der einfache Protestant, der vom Euangelion sprach, der guten Botschaft Gottes an alle, und der Neukatholik Gerberstedt, der sein Leben als Beispiel empfand und, ein umgekehrter Christopherus, der Welt seine Last zu tragen und zu ertragen aufgab? Was wollten sie von ihm? Was wollte das Schicksal von ihm, daß sie diese Männer vor seine Tür schickte?
Er warf das Buch in die Ecke und trat hinaus. Der Himmel hatte sich aufgeklärt. Der Vollmond, schon ein wenig dem Abnehmen zugeneigt, stand über den drei Buchen am Hang und schien mit grellen Strahlen auf die geweißte, gerundete Mauer. Ein Käuzchen lockte, eine Eule strich, auf Mäusejagd, unsicher im Mondlicht taumelnd von Wipfel zu Wipfel. Das Wetter versprach schön zu werden. Denn es war schon ziemlich kalt, und der Nebel hielt auf dem Fluß, wagte sich nicht in den Wald hinein. Maria Andersson würde kommen. Morgen. Und wenn sie wirklich kam? Das war doch nichts anderes als ein teuflischer Betrug, ein irrsinniger Versuch, einer fremden Frau in Gerties Kleidern die Rolle der so schmerzlich Vermißten anzuvertrauen. Gertie haßte übrigens den Mond. Bei Vollmond war sie fast immer schlaflos, saß bei zugezogenen Vorhängen (schön waren sie übrigens, die hellblauen, schweren Vorhänge nach der Morgenseite, nach außen mit Seide in zartesten Morgenrotfarben gefüttert), saß in sich zusammengekauert im Bett, eine Pralinenschachtel neben sich, aus der sie gedankenlos aß, verschiedene Parfüms um sich versammelt, die sie zu einem Blumenstrauß, einem Geruchsbukett zu mischen suchte — ein beneidenswertes Luxusgeschöpf also, ein unnützes Menschenkind, nur zur Freude von Männern geschaffen, die es sich leisten konnten, sie zu kleiden, zu ernähren und in einen herrlich ausstaffierten Schmuckkasten von Haus zu setzen. Eine asoziale, hassenswerte Erscheinung also? Ach, hättet ihr sie gesehn, dachte Paul, in den Mondnächten, ausgeliefert den bösen Strahlen des verführerischen Gestirns, ganz erfüllt von dem kalten Schein einer unbekannten kalten Welt, wärmebedürftig, sich nach Sonne sehnend, ein lunarisches Geschöpf, ihr hättet ihr nicht ihr blumenhaftes Dasein geneidet, das so schnell verwelken mußte. Nur die Ausgelieferten, die Melancholischen haben diese Anziehungskraft, dachte er weiter. Sie haben die verstehende und verzeihende Weite, den Humor, der aus dem Gefühl der eignen Unzulänglichkeit kommt. Sie allein haben die schwebende Leichtigkeit, die das Leben erst atmenswert macht, sie allein die göttliche Unbekümmertheit, alle männlichen Werte auf den Kopf zu stellen und damit ihr mangelndes Gleichgewicht zu erweisen. Denn ein wahrer Wert, eine absolute Wahrheit balanciert auch noch auf dem Kopf. Sie braucht keine Verteidiger, die sie mit sturem Ernst beschirmen. Ach, wenn er jetzt, wie er es in Mondnächten früher oft getan, in ihr betäubend duftendes Zimmer hätte treten können, sie auf den Arm nehmen wie ein Kind und im Zimmer hin und her tragen und ihr erst verängstigtes, klagendes Geschwätz, dann, wenn sie getrösteter wurde, ihre gaminhaften Frechheiten, ihre zügellosen, sündhaften Wortspielereien anhören, bis er sie, wenn sie einschlief, vorsichtig wie ein kleines Tier im Bett ablegte und sorglich zudeckte oder sich neben sie legte und mit ihr spürte, wie der tückische Mond um die Hausecke wegging und endlich drüben hinter den Pappeln verschwand.
Er blickte auf. Unbeweglich schien der Mond auf dem Fleck zu verharren, und seine kalten Strahlen erkälteten langsam sein Blut, bis zu Totenstarre. In diesem Augenblick wünschte er sich tatsächlich, ihr nachzusterben — eine lebensgefährliche Sentimentalität, wie er abwehrend dachte. „Wenn du stirbst“, hatte sie an ihrem letzten Abend auf dem letzten Berliner Urlaub gesagt, „wenn du wirklich stirbst ... ich lebe bestimmt weiter. Ich habe ja nichts anderes als das Leben. Das muß man doch festhalten. Bilde dir also nicht ein, daß ich in Trauer wie eine indische Witwe mich verscheitern lasse oder mein Leben allein verbringen werde. Nach einem bißchen Weinen bist du ausgelöscht. Merke dir das. Sieh also zu, wenn du mich behalten willst, daß du am Leben bleibst.“ Und nun wollte er nicht mehr leben, weil sie nicht lebte? Das war ein ganz verdammter Unsinn. Nein ... es war gut, daß das Wetter besser wurde und Maria Andersson kam. War das wirklich gut? Er wußte schon, indem er dies dachte, daß er in Maria nicht von Gertie wegwollte, nein, auf betrügerische Weise zu ihr hin. Nicht zum Leben wünschte er zurückzukehren, sondern sich wieder über die Tote zu beugen. Sie soll lieber nicht kommen, dachte er und wandte sich.
Der Tag wurde heiß und heiter. Gegen Mittag kam Maria Andersson. Wolffenau haute gerade die letzte Nute in einen Balken und hatte ihre Schritte nicht gehört. „Also ... da bin ich“, sagte sie mit ihrer dunklen, verschleierten Stimme, die Gott sei Dank gar nicht an Gerties Vogelstimme erinnerte. Aber sie trug Gerties Gabardinekostüm und ihre hellblaue Bluse, die er ihr eines Tages bei Horn in der Tauentzienstraße gekauft hatte. Natürlich, es war die Bluse, die sie nie zu tragen geschworen hatte. Denn während des Anprobierens hatte Paul in einer „unverschämten Weise“ mit der sehr hübschen, schönbusigen Verkäuferin kokettiert, und Gertie, die ihre fast knabenhaften Brüste als ein Manko empfand, war sehr böse geworden. „Kauf dir bitte die Busionärinnen, wenn ich nicht dabei bin“, hatte sie gesagt. „Es ist taktlos, seine eigene Frau indirekt auf ihre Fehler aufmerksam zu machen.“ Und als sie dann auf den Kurfürstendamm kamen, hatte sie ihn in einen Schönheitssalon mit hineingezogen und mit Trompetenstimme eine Zweikilopackung „Megabusol“ verlangt, mit dem Zusatz: „Mein Mann liebt nämlich das Üppige.“ Das war so ihre Art, die kleinen Verstimmungen und Streitereien aufzuheben. Er sah die funkelnagelneue Bluse prüfend an. Ein sehr schönes Stück, eine feine Pariser Arbeit! Und Maria Andersson hatte, wie er feststellen mußte, kräftige, wohlgebildete Brüste.
„Fein, daß Sie da sind“, sagte Paul nach einer etwas zu langen Pause. „Wir können gleich zu Mittag essen.“
Maria Andersson hob eine ziemlich große Aluminium-Milchkanne. „Nachher vielleicht“, sagte sie, „erst müssen wir arbeiten. Ich komme nämlich wegen der Brombeeren!“
„Das weiß ich“, antwortete Paul etwas verdrießlich, „aber eine höfliche Frau sagt so was ein bißchen indirekter.“
Maria lachte: „Ich muß mich an gute Manieren erst wieder gewöhnen. Man kann nicht gerade behaupten, daß die Männer sehr dazu herausfordern.“
Paul blinzelte sie spöttisch an. Dann ging er ins Haus und kam mit einem Stuhl zurück: „Bitte. Und nun warten Sie mal freundlichst, bis die Kartoffeln gar sind. Es gibt Pilze dazu.“
„Ich werde Ihnen helfen“, sagte Maria, „zu Pilzen reicht mein Küchenverstand noch.“
„Ein andermal“, sagte Paul, „heute sind Sie noch mein Gast.“
Sie sah, erstaunt über die Art, wie er über sie verfügte, etwas unwillig zu ihm hinüber. Aber er war schon in der Hütte verschwunden. Sie zog eine winzige Tabakspfeife aus der Kostümjacke, stopfte sie aus einem Silberbüchschen, das vormals wohl eine Puderdose gewesen war, und setzte sie in Brand. Es war Gerties Tabakspfeife, die sie allerdings selten genug geraucht hatte.
Paul sah ihr aus dem Fenster zu und fragte: „Rauchen Sie viel?“
Sie blies den Rauch behaglich von sich. „Welcher Raucher weiß schon, wieviel er raucht. Sie müssen übrigens die Pfeife entschuldigen. Zigarettenpapier macht mir leicht Kopfweh.“ Genau wie Gertie. Übrigens sah sie, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, sehr melancholisch und hilflos aus, ja, als habe sie eben erst ein fürchterliches Erlebnis hinter sich. Ihre leichte, lässige Art zu sprechen, ihr etwas kokettes Wesen waren nur Maske.
„Ich bekomme vielleicht heute nachmittag Besuch“, rief er, die Pilze in die Pfanne schneidend, „ich bringe Sie dann in die Brombeeren und lasse Sie allein.“
„Famos“, rief sie zurück, „ich dachte schon, ich müßte meinen Raub mit Ihnen teilen.“
„Nein — ich erhebe nur den Zehnten, ein billiger Grundherr.“
Bald darauf erschien er mit dem Essen. Als Tisch wurde ein Haufen behauener Ziegelsteine benutzt. Maria aß mit einem Heißhunger, den sie nur mühsam bezähmte.
„Wir können auch Pilze finden“, sagte Paul. „Ihre Leute essen sicher gern auch mal was anderes.“
„Ich bin ganz allein“, entgegnete sie, „das wissen Sie recht gut.“
„Woher soll ich das wissen?“ fragte Paul.
Sie reichte ihm mit einem seltsamen Ernst die Hand über die Ziegelsteine weg. „Daher“, erwiderte sie, „genau wie ich weiß, daß Sie ganz allein sind. Die Luft um Sie. Darin gibt es keine Menschen.“
„Meine Eltern zum Beispiel leben noch“, sagte er hartnäckig.
„So?“ sagte sie uninteressiert. „Dann sind Sie ja noch ganz gut dran.“
„Ihre Leute ...“, versuchte Paul und machte eine Bewegung, die heißen sollte: Alle tot.
Maria Andersson griff statt einer Antwort in die Kartoffelschüssel und legte sich noch einmal auf. Während sie die Kartoffeln zerteilte und sorgfältig Pilze darüberbreitete, blickte sie aufmerksam auf den Teller. „Und dann“, sagte sie bitter und kühl zugleich, „hat man wieder den besten Appetit. Komisch, nicht wahr?“
„Ich finde das sehr schön“, sagte Paul trotzig. Er sagte es schärfer, als es eigentlich notwendig war. Denn dies war es ja eigentlich, was ihn beunruhigte: daß er nach allem Geschehenen, nachdem er hinabgeworfen war in das Tal vollständiger Resignation, hinausgeworfen aus allem, was ihm bis dahin das Leben bedeutet hatte, im Grunde ganz vergnügt, ganz lebendig hier in der Jagdhütte hauste. Daß er geglaubt hatte, an seiner Arbeit zu hängen — und hatte sie nicht mehr. Daß er gemeint hatte, stolz zu sein auf seine paar Häuser, die wirklich gut waren, Wohnhäuser, in denen man ein anständiges, von außen ungestörtes Leben führen konnte — und diese Häuser waren alle vernichtet (bis auf eins am Neckar, unweit Heidelberg). Daß er geglaubt hatte, Freunde zu haben, an denen er hing, mit denen er herrliche Gefechte gehabt hatte um die letzten Dinge — und sie waren verschollen, gefallen, in den Trümmern der Städte untergegangen, in den Steppen Rußlands verschwunden, und er lebte weiter. Weßmer, der Anwalt, Rohleder, der Philosoph, Klinder, der feinsinnige Antiquitätenhändler, Wollenhaupt, der exzentrische Dramatiker mit dem kahlen Schädel, dem schütteren Lachen und dem herrlichen Chopinspiel. Weg waren sie, und sein Leben ging weiter, war scheinbar nicht ärmer geworden. Und Gertie, die Frau, die er sich so mühsam erobert hatte, nein ... nicht mühsam, sondern in einer einzigen rasenden Attacke, in einem Furioso der Leidenschaft, das ihn zwei Monate lang völlig aus der Bahn geworfen hatte, Gertie, mit der ihn bis zum letzten Tage eine immer neue Leidenschaft verband, eine romantische, witzige, helle Zuneigung, Gertie war tot. Damals, in den Anfängen ihrer Liebe, als sie noch die Frau des Großindustriellen Höhdewald gewesen war, war er sogar beinah für sie in den Tod gegangen, in einen leichtfertigen, herausgeforderten Tod. Für drei Stunden konnte er sie in Berlin treffen, und er saß in Wien. Auf dem Flugplatz war Startverbot. Denn es wehte ein Orkan, wie er nur alle zehn Jahre einmal über Mitteleuropa dahinrast. Und er hatte einen tollkühnen jungen Piloten überredet, ihn für 2000 Mark nach Berlin zu fliegen. Ein völlig wahnsinniger Flug. Die kleine Maschine trudelte dreimal beinah ab. Und beim Landen wurde sie fast gegen die Abfahrtshallen von Tempelhof gedrückt. Aber er kam an, und er sah Gertie, für eine halbe Stunde allerdings nur, und verriet ihr nichts davon, was er ihretwegen unternommen hatte, und sie nahm es auch als ganz selbstverständlich hin. Ein Orkan über Europa — das war noch lange kein Grund, sich nicht zu treffen. Es war also wirklich eine Liebe gewesen, fast ohne die Niederungen des Alltags, so wie man sich eine Liebe wünscht und sie eigentlich nie bekommt. Und nun war Gertie tot, und er lebte weiter. War das nicht eigentlich eine Schweinerei? Gehörte es sich nicht, nun auch mit Anstand in den Tod zu gehn?
„Ich esse Ihnen zuviel“, lachte die Andersson.
Er wachte aus seinen Gedanken auf. „Warum?“
Sie antwortete: „Nein — ich weiß schon, warum Sie so zornig blicken.“
Er stand auf und räumte das Geschirr ab. Er ließ es zu, daß sie ihm jetzt dabei half.
„Wollen wir gleich abwaschen?“ fragte sie.
„Nein .. nachher. Jetzt scheint die Sonne zu schön.“
„Nachher haben Sie doch Besuch?“
Er tippte sie leicht auf die Schulter: „Das war gelogen. Ich habe keinen Besuch.“
Sie sah ihn spöttisch an. „Ich dachte, Sie sind ein kluger Mann?“ Und als er sie fragend anblickte: „Soviel könnten Sie schon kapiert haben: Ich bin keine Klette. Mich wird man ziemlich leicht los.“
„Ja ... das merke ich. Sie hängen an gar nichts.“
Sie wandte sich schnell ab und ging vor ihm aus der Tür hinaus. Die Sonne schien mit herbstlicher Stärke und Milde auf die Autobahnschneise. Es lagen noch rostige Gleise dort, umgekippte Sandkarren. Sie fanden sogar, von Laub und Sand zugeweht, eine Spitzhacke, die Paul triumphierend als Strandgut erklärte und mit sich nahm. Vielleicht, so meinte er, werde er noch einen Keller unter dem Jagdhaus ausheben, und dafür brauche er eben diese Spitzhacke.
„Sie wollen also für immer hierbleiben?“ fragte sie.
„Was heute so für immer ist. Vierzehn Tage, drei Wochen oder auch drei Tage. Und Sie?“
Sie zuckte die Achseln. „Ich bin auch so ein Zigeuner“, sagte sie. „Aber ich tauge nicht sehr gut dafür. Irgendwohin müßte man eigentlich gehören, nicht wahr?“
Er lachte: „Ich glaube, das ist nur eine Gewohnheit und ein Vorurteil.“
Zum ersten Male lächelte sie von innen her. Das sei ein neuer Gedanke, so habe sie das noch nie angesehn. Sie wolle mal ein paar Tage darüber nachdenken.
„Wünschen Sie noch ein paar neue Gedanken? Ich habe immer ein paar Dutzend auf Lager“, fragte Paul übermütig.
Sie lachte: „Nein, danke. Das genügt erst mal für mein kleines Gehirn. Richtig nachdenken strengt mich sehr an, und es ist ja auch nicht gut.“
„Sie haben wohl Angst, daß Klugheit häßlich macht“, spottete Paul.
Sie antwortete lange nicht. Aber ihr Gesicht war wieder auf die seltsame und gefährliche Art verdunkelt, die eine vollständige seelische Erschöpfung verriet. Endlich sagte sie sehr ruhig: „Es ist mir völlig egal, ob ich häßlich oder schön bin.“ Und wieder nach einer Weile: „Das glauben Sie nicht. Aber es ist so. Tatsächlich.“
„Dann wären Sie keine Frau“, sagte Paul eigentlich mehr, um etwas zu sagen, und er ärgerte sich schon im Sprechen, daß er bei dieser Frau, bei der man Phrasen doch anscheinend nicht nötig hatte, eine solche Phrase gebrauchte.
Und sie antwortete auch genau das, was er erwartet hatte, nämlich: „Da haben Sie recht, ich bin keine Frau, keine Frau mehr.“ Und unheimlich ruhig setzte sie hinzu: „Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, sprechen Sie nicht mehr von mir. Das hat keinen Zweck.“ Sie sagte das so abschließend, daß Paul nicht weiter fragen konnte.
Es wurde dann ein schöner, friedlicher Nachmittag. Wie so oft an Herbsttagen nahm die Sonne in den späteren Stunden an Kraft zu. Sie standen fast die ganze Zeit an einer großen Brombeerhecke, die sich über eine alte Lichtung hinwegzog. Manchmal verschwand Maria fast ganz zwischen den bunten Brombeerranken, und er sah nur das blaue Kopftuch und das runde, zarte Gesicht, das sich langsam unter der Sonne mit einem Hauch von Rot überzog.
Sie pflückten beide eifrig, und die ziemlich große Milchkanne war endlich ganz gefüllt. Etwas erschöpft saßen sie schließlich am Rande der Hecke, die noch lange nicht abgeerntet war.
„Ich werde morgen wieder pflücken“, sagte Maria mit einem hausfraulich-sorgenden Gesicht. „Und nun finde ich den Weg auch allein.“
„Was wollen Sie denn mit den vielen Beeren, wenn Sie niemanden haben?“
„Sie brauchen doch auch Marmelade“, sagte sie selbstverständlich. „Zucker müßten Sie mir allerdings geben, oder haben Sie keinen?“
Doch, Paul hatte noch fünf Pfund Zucker, die er in Dahlem gefunden hatte und die ganze Zeit mit sich schleppte.
„Dann muß ich aber sehr fleißig pflücken“, sagte sie.
Und er antwortete: „Das wird wohl nötig sein, liebes Kind.“
Merkwürdig und anziehend, diese Mischung aus dunkler Melancholie und zarter, sich selbst vergessender Heiterkeit.
Sie sah ihn etwas schief von unten her an. „Liebes Kind“, lächelte sie, „das hört man um so lieber, je älter man wird.“
„Welches hohe Alter haben Sie denn erreicht?“ fragte Paul spöttisch.
„Sechsunddreißig“, antwortete sie, ganz ohne Eitelkeit, „genauso alt wie Sie.“
Paul sah sie überrascht an. „Woher wissen Sie das?“
Sie lachte: „Sie sind ein Dummkopf. Taxiert und geraten. So ist das mit den meisten Scharfsinnigkeiten.“
Als sie nach einem schönen Gang wieder an die Hütte kamen, bestand Maria darauf, daß sie ihm beim Abwaschen behilflich sein dürfe. Sie machte die Abwäsche sehr schnell, gewandt und lautlos. Aber zum Abendessen wollte sie nicht bleiben, obwohl Paul ihr sagte, er würde sie nachher durch den Wald zur Station bringen und ganz bestimmt heil in den Zug setzen. Sie meinte aber, es sei genug und übergenug für ein erstes Mal Zusammensein, und wahrscheinlich überhaupt genug. Denn sie sei immer genauso wie heute und ganz und gar nicht interessant, eine Frau ohne Tiefen und Untiefen, die beim näheren Kennenlernen nur verliere.
Paul brachte sie zur Station. Sie gingen am Fluß entlang. Die Sonne war schon im Untergehn, und da es schnell kalt wurde, dampfte das wärmere Wasser. Bald kam ein starker Nebel und breitete sich über den Fluß. Man hörte die Ruderschläge von Fischerbooten. Oder es waren Boote von Grenzgängern, die durch den Nebel fuhren, um ins russische Gebiet hinüber zu gelangen, das etwa fünf Kilometer flußaufwärts von hier begann. Man hörte jedenfalls gedämpfte Rufe, wie sie Menschen törichterweise ausstoßen, die denken, daß sie sich im Flüstern weniger verraten als im lauten Sprechen. Aber der Nebel trug das Flüstern sehr deutlich an das Ufer heran. Paul fragte, wo Maria denn die Grenze überschritten habe. Sie log, sie habe das Kriegsende in Hamburg erwartet. Ob sie immer in Hamburg gelebt habe? Nein, früher habe sie in Berlin gelebt. Wo? In der Reichsstraße, nahe am Reichskanzlerplatz, aber 1943, im November, sei sie ausgebombt und weggegangen.
„Schwindeln Sie eigentlich immer?“ fragte Paul, und er wunderte sich, daß er darüber verstimmt war, „oder nur, wenn es Ihnen Spaß macht?“
Sie sah ihn überrascht an. Wieso schwindele sie? Das sei alles wahr oder doch so ziemlich alles.
„Sie sind doch bis zum Schluß in Berlin geblieben“, sagte Paul streng.
Sie wehrte sich. Wie er darauf komme? Sie müsse es doch wohl besser wissen. Und schließlich überraschend: „Ja ... ich bin erst vor kurzem herübergekommen. Und nun soll ich auch noch erzählen, warum ich gekommen bin? Aber ich habe keine Lust dazu. Ich will es nicht.“
Paul entschuldigte sich, er habe sie nur ein bißchen necken wollen. Aber er sehe es nun ein, man dürfe heutzutage keine Späße machen. Jedenfalls nicht, ehe man die verletzlichen Punkte des anderen kenne. Und es gebe wohl keinen Menschen in Deutschland, der nicht sehr zart und verletzlich sei.
Sie waren schon nahe an der Station und hörten den Zug heranrollen. Sie mußten laufen und kamen gerade noch durch die Sperre, als der Zug schon hielt. Wie immer hingen Reisende auf allen Puffern und Trittbrettern. Maria versuchte erst gar nicht, sich in eines der Abteile zu drängen. Sie stellte sich auf eine winzige freie Stelle des Trittbrettes, und schon fuhr der Zug an.
„Auf Wiedersehn also“, rief Paul und, indem er neben dem Zug herging: „Sie könnten eigentlich gleich morgen wiederkommen.“ Der Zug fuhr schon schneller, und sie begann ihm wegzugleiten. „Auf morgen“, rief er sehr laut, und sie antwortete ebenso: „Gut. Ich muß mir ja auch den Zucker holen.“
Wie immer im hungrigen Deutschland, wenn von etwas Nahrhaftem die Rede war, reckten die anderen Reisenden die Hälse. Einige lachten, und ein junger Mensch schrie im Vorüberfahren: „Das wird ein süßes Rendezvous.“
Am anderen Mittag wartete Paul bis zwei Uhr mit dem Essen. Aber sie kam nicht. Er aß verstimmt allein und war über seine Verstimmung ärgerlich. Wenn sie nicht kam, war es nur gut. Was hatte er mit ihr zu schaffen? Gewiß ... sie war eine hübsche und aparte Frau, und auf die Dauer konnte er nicht als Mönch leben. Er war es einfach nicht gewohnt. Das hieß aber doch nicht, daß er sich um die erste Frau bewarb, die ihm ein seltsamer Zufall über den Weg trieb. Außerdem stieß ihn die schmerzliche Maskerade, die sie — ohne es zu wissen — mit Gerties Kleidern trieb, eher ab, als sie ihn anzog.
Nein ... das war nicht richtig. Weil sie Gerties Kleider trug, hatte er sie überhaupt nur beachtet. Aber jetzt, da er sie ein wenig kennengelernt hatte und sie so anders war als Gertie, jetzt war sie ihm gleichgültig. Oder vielmehr, es ging etwas gefährlich Kaltes, etwas Erkältendes von ihr aus. Die Erinnerung an die Tote? Nein ... das Kalte saß in ihr, in ihrem Herzen. Ja ... so mußte es sein. Sie war erstorben, tot. Toter als Gertie. Begraben unter irgendeinem entsetzlichen Schock. Tausende solcher Toten liefen in Deutschland herum, Frauen, die ihre Kinder verloren hatten oder denen sie in den Armen gestorben waren auf irgendeiner der Fluchten, die nun schon zwei Jahre dauerten und kein Ende nehmen wollten. Männer, die, aus dem Kriege kommend, alles tot und vernichtet fanden, um das sie sich gemüht, für das sie gekämpft, das sie geliebt hatten. Junge Mädchen, die von der rüden Kraft der Eroberer überwältigt worden waren und diesen unerwarteten Zusammenstoß mit den männlichen Urtrieben nicht überwinden konnten, die jahrhundertelang geschlummert hatten und nun zum Entsetzen Europas entfesselt waren. Verwöhnte, die plötzlich dem nackten Elend ausgeliefert waren, zarteste Geschöpfe, aus einem blumenhaften Dasein in die Eiseskälte des erschöpfenden Existenzkampfes verpflanzt ... Wie viele waren den Herzenstod gestorben, den Nerventod, den Gefühlstod, und atmeten nur noch wider Willen, lebten mechanisch, weil das Uhrwerk noch nicht abgelaufen war. Sicher: Maria war eine von diesen lebendigen Toten, und er, der ja selbst noch nicht genau wußte, ob er sich auf die Seite des Lebens neigen sollte oder sich dem bequemeren Nachen anvertrauen, der ihn sicher und sanft in ein läßliches Sterben, in einen kaum spürbaren Tod hineinfahren würde, er, der noch immer nicht wußte, ob das Leben den ganzen Aufwand lohnte oder ob die jungen Menschen recht hatten, die allerecken riefen, es habe alles keinen Zweck mehr, — er sollte sich nun um ein abgestorbenes Wesen bemühen?
Er stand mit einem Ruck auf und ging an seine Arbeit. Er fügte den Balken mühsam und genau. Aber gerade als er ihn beinahe hineingefügt hatte, schien ihm diese scheinbar sinnvolle Arbeit noch sinnloser, als das Sinnlose zu versuchen. Er warf den Balken wütend auf die Erde und lief auf die Autobahnschneise zu.
Er fand sie nicht bei den Brombeeren. Er stand lange in der Sonne und aß eifrig von den Früchten, ohne sie zu schmecken. Sein ganzes Leben hier in der Jagdhütte erschien ihm plötzlich geschmacklos und abgeschmackt. Nein, sein ganzes Leben bisher und sein ganzes Leben, das noch kommen konnte. Noch einmal sechsundreißig Jahre leben? Vielleicht noch länger? Es gab genug alte Leute, die selbst bei diesen Zeitläuften nicht aus der Welt herausfinden konnten und achtzig und neunzig wurden. Noch einmal so lange? Und wofür? Cassembert, den er einmal in einem Anfall der Melancholie nach diesem „Wofür“ gefragt hatte, wofür man zum Beispiel Häuser baue, in denen die Menschen dann ein völlig gleichgültiges oder ein lebensfeindliches, ein lebensvernichtendes Leben führten (Anlaß zu dem Gespräch war die Villa für einen Dynamitfabrikanten gewesen) — Cassembert hatte geantwortet, daß das Leben kein Wofür kenne und somit der lebendige Mensch dieses gefährliche Wort bei Sterbensstrafe nicht in den Mund, ja nicht einmal in den Sinn nehmen dürfe. Denn im Weiterleben sei der Sinn des Lebens immer wieder offenbar.
Was für ein Sinn offenbarte sich ihm denn jetzt, hier an den Brombeeren, deren säuerlich-süßer Geschmack ihm angenehm auf der Zunge verging, in der Sonne, die ihm wärmend auf Gesicht und Hände schien, im Flug der verspäteten Schmetterlinge, die aus den letzten Brombeerblüten, den unnützen, die keine Frucht mehr bringen würden, ihren Honig sogen? Gar kein Sinn, aber ein süßes, angenehmes, einfach atmendes Leben. War es nicht vielleicht so, daß der Mensch gut und richtig lebte, solange er allein war, und daß jedes Zusammenleben mit anderen Menschen ihn ablenkte, verdarb und schließlich zugrunderichtete? War nicht vielleicht das Lebensflämmchen zu klein, um noch andere Leben mit zu erwärmen, mit zu erleuchten? War nicht also das mönchische Leben, das Leben in der stillen, weißen Zelle des Klosters, in der Abgeschlossenheit fruchtbarer Klostergärten das einzig friedfertige und deshalb richtige?
Er ging gedankenverloren weiter, überquerte die Autobahnschneise, stolperte über eines der schon fast zugesandeten Gleise, erwachte aus seinen Gedanken und mußte schallend lachen. Wenn der Mensch sich vor den Menschen zurückzog, so war das nichts anderes als eine Bankrotterklärung, nein, ein Hochmut, ein ängstliches Bewahren und Hüten jenes kleinen Lebensflämmchens. Es war freilich einfach, nur mit sich selbst zu leben, nur mit sich selbst zu kämpfen und das Gegenteilige, das Feindliche draußen zu lassen. Es war einfach, sich in der Zelle zu bewähren und zu bewahren. Tapfer aber war es, sich in den Kampf hineinzustürzen, den jedes Zusammenleben mit anderen eben bedeutet. Man mußte sich nur die romantischen Faseleien aus dem Herzen reißen, den Irrglauben, daß es gewissermaßen von selbst und natürlicherweise eine Harmonie zwischen Menschen geben könne, oder gar daß diese Harmonie, in der sogenannten Liebe, aus Himmelshöhen wie die Taube des Heiligen Geistes über die Menschen herfiel ... Nein. Harmonie, der Klang der ewigen Sphären, der zuweilen zwei oder zehn oder auch die tausend Mitglieder einer Gemeinde zum Mitklingen brachte, diese Harmonie stand am Ende eines erbitterten Kampfes mit dem Leben. Und wenn er jetzt in den wenigen Wochen der Einsamkeit zuweilen von ihr angerührt worden war, so hieß das nur, daß man, erschöpft vom Kampfe, sich zuweilen zurückziehen muß, um wieder ein wenig zu Kräften zu kommen. Aber dann ... ja, es war Zeit, daß er wieder aufbrach. Er wußte es schon seit ein paar Tagen, und es war geradezu lächerlich, daß er, wie er jetzt erkannte, diesen Aufbruch nur aufgeschoben hatte, weil Maria Andersson, eine Frau, die ihn gar nichts anging, aufgetaucht war.
Er beschloß, während er langsam durch den Buchenwald schlenderte, der durch die Einschläge der letzten Jahre schon ziemlich licht geworden war und bald ganz abgeholzt sein würde, auch ein Opfer menschlichen Wahnsinns, kriegerischer Vernichtungswut — er beschloß, Brösekes Jagdhaus noch fertigzumachen. Teils wollte er das, um dem Alten für die Gastfreundschaft zu danken, teils auch, um die kleine, hübsche Idee ganz zu verwirklichen, die er für die Restaurierung gehabt hatte, um also neben jenem einen Haus in Heidelberg noch ein kleines Werkchen auf dieser Welt stehn zu haben. Das würde noch acht Tage in Anspruch nehmen, und dann war er frei. Frei wofür? Ja, da war wieder dieses verdammte Wort wofür, gut für Dilettanten, Träumer und Idealisten, schlecht für Menschen, die nach einer schlimmen Niederlage wieder in den Kampf hinaus mußten, dessen Ende nicht abzusehen war. Wofür? Um die Kraft zu nutzen, die in ihm steckte und die in diesem Augenblick mit einer lustvollen Gewalt sein Herz überströmte, seine Muskeln spannte und seine Gedanken wie feurige Pferde antraben ließ.
Er ging die letzten paar hundert Meter sehr schnell, voller Arbeitslust. Das Dachgestühl mußte unter allen Umständen noch fertig werden. Etwas atemlos bog er um die Ecke. Auf einem Stuhl, den sie in die Sonne gerückt hatte, saß Maria Andersson. Die Milchkanne neben ihr war mit Brombeeren gefüllt.
„Ich hätte Ihnen gern geholfen“, sagte er etwas vorwurfsvoll statt einer Begrüßung.
Sie streckte ihm die Hand entgegen und antwortete: „Man soll die Männer nie mit hausfraulichen Dingen bei ihrer so wichtigen Arbeit stören.“ Sie trug wieder das Gabardine-Kostüm. Dazu aber eine weiße Bluse, die sie auch auf dem Bahnhof getragen hatte, ihre eigene also. So ganz gleichgültig, stellte Paul fest, ist es ihr doch nicht, wie sie den Männern gefällt. Denn sonst würde sie nicht jedesmal etwas anderes anziehn. „Ich bin nur wegen des Zuckers gekommen“, sagte sie. „Ich versprach Ihnen doch Marmelade, statt des Zehnten, den Sie als Grundherr verlangen können.“
„Können Sie denn in Ihrer Bude kochen? Oder leben Sie bei der berühmten Hausfrau, die Ihren Topf immer beiseite rückt, ehe er kocht?“
Sie seufzte, und wieder umschattete sie die grenzenlose Melancholie: „Das ist es. Ich werde mein Versprechen gar nicht erfüllen können. Es fehlt der eigne Herd, der goldeswerte.“
„Sie können ja hier kochen“, sagte Paul und ärgerte sich im selben Moment darüber. Denn er hatte sich auf seine Arbeit gefreut.
Sie besann sich einen Augenblick. Dann sagte sie: „Gut ... wenn Sie derweilen Ihren Kram machen.“
Paul heizte den Ofen mit Kienäpfeln und Tannenreisig, so daß die Platte bald glühte. Er stellte ihr seine Emaillewaschschüssel als Einkochtopf zur Verfügung, dazu den Zucker, einen großen Holzlöffel und eine grüne Schürze, die er in Klosters’ Kaufhaus aus irgendeiner Ecke herausgezogen hatte. Anfertigungsjahr 1913, Preis 1,20 Mark. Ein prächtiges Stück, durabel und von bester Farbe, wie man sie sonst nur noch in Kinderbilderbüchern von Hausknechten getragen sieht. Es war sogar noch eine kleine Messingkette daran, mit der man die Schürze zuhaken konnte.
„Steht Ihnen großartig“, sagte Paul. „Sie gehören überhaupt nicht in diese Zeit, sondern hätten 1913 mit siebzig Jahren sterben müssen.“
Sie lachte: „Wer gehört denn überhaupt in diese Zeit? Oder kennen Sie einen, der sich in diesem vollkommenen Blödsinn wohlfühlt?“
„Ja, einen ... mich“, sagte Paul vergnügt und ging an seine Arbeit. Die Sonne schien noch immer recht kräftig. Er stand auf einer kleinen Knüppelleiter, die er sich selbst verfertigt hatte, die Hemdsärmel aufgekrempelt, den Kragen aufgeknöpft, in langen, grauen Flanellhosen, die eigentlich für die Arbeit viel zu schade waren und zu deren Schutz er die grüne Schürze erworben hatte. Na ... das war nun nichts mit der grünen Schürze. Eifrig schimpfend und vor sich hinbrummend fügte er die letzten Balken. Drinnen pfiff Maria vor sich hin. Es klang wie fernes Vogelgezwitscher.
Nach einer Stunde kam sie heraus, den Holzlöffel vorsichtig vor sich her tragend. „Probieren“, rief sie zu ihm hinauf und reichte ihm den Löffel. Er schmeckte sorgfältig. „Kann ich noch nicht beurteilen nach dem bißchen“, sagte er ernst. Sie brachte ihm einen zweiten Löffel und einen dritten. Endlich sagte er: „Es scheint nicht ganz schlecht zu sein. Heute abend gibt es Grießbrei mit Brombeermarmelade.“
„Können Sie Grießbrei kochen?“ fragte sie.
Er sah sie von oben her kopfschüttelnd an. „Natürlich nicht. Aber Sie können’s ja. Milch steht unterm Stuhl, Grieß neben den Schuhen. Zucker werden Sie ja hoffentlich nicht allen verbraucht haben. Also marsch.“
Sie sah zweifelnd zu ihm hinauf. Er aber schnarrte im Kommandoton: „Was stehn Sie denn noch hier rum? ’n bißchen dalli!“
„Alle Frauen werden artig, sobald es militärisch zugeht“, lachte sie und ging ins Haus.
„Wenn die Frauen nicht so fürs Militär gewesen wären“, rief er ihr nach, „die Männer hatten’s schon lange dick.“
Sie streckte den Kopf zum Fenster heraus und sagte: „Natürlich. Nur die Frauen sind marschiert, nur die Frauen haben geflaggt und trompetet.“ Gleich darauf hörte er sie wieder pfeifen.
Nach einer halben Stunde trat sie aus dem Haus. Sie hatte die Schürze abgebunden und einen kleinen verwegenen Hut aufgesetzt, einen hellgrünen Filzhut mit einer bunten Spielhahnfeder. Der gab ihrem Gesicht etwas Shakespearisches.
„So zwischen Sommernachtstraum und Was ihr wollt“, rief er, auf den Hut deutend.
Sie errötete unwillig und sagte: „Der Grießpudding steht im Wasserbad. Die Marmelade habe ich geteilt, zwei zu drei für Sie. Adieu.“
Er sprang von der Leiter und faßte sie um die Schulter. „Brrrr“, sagte er, „nicht immer gleich durchgehn. Jetzt wird erst gegessen.“
Sie machte sich unwillig los.
Er sagte: „Habe ich Sie mit Shakespeare gekränkt? Waren Sie mal erste Salondame in Erfurt oder Gera oder gar in Augsburg?“
Sie schwieg.
„Na ... reden Sie sich mal ein kleines Eckchen vom Herzen“, ermunterte Paul sie freundlich. „Oder soll ich es Ihnen erzählen? Komisch, daß ich darauf noch nicht gekommen bin. Gute Familie. Vater Oberamtsrichter.“
„Schlimmer: Pastor.“
„Naturtalent. Beinahe ohne Ausbildung ins erste Engagement, mit väterlichem Fluch beladen.“
Sie nickte lächelnd.
„Bombenerfolg in Tilsit oder Schneidemühl.“
„In Heidelberg“, verbesserte sie.
„Engagement nach Mannheim, aber da kommt ein kleiner Regisseur aus Berlin und sagte: Du gehörst nach Berlin, mein Kind.“
„Sie gehören nach Berlin, gnädige Frau.“
„Aha, ein Kunstenthusiast also. Und die Andersson, die damals noch nicht Andersson hieß, geht also nach Berlin und hat zuerst auch wieder einen kleinen Bombenerfolg. Aber dann hätte sie was lernen müssen, und dazu war sie schon zu berühmt. Und so wurde sie eine ziemlich bekannte Zweite und war sehr unglücklich darüber und gab es schließlich auf.“
Die Andersson stand mit gesenktem Blick, kindlich zuhörend, als wenn er ihr ein Märchen erzählte. Jetzt legte sie ihm die Hand auf die Schulter und sagte: „Und so weiter, und so weiter, das ist schon lange her. Lange her.“
„Und der Grießbrei ist nun kalt“, sagte Paul, hakte sie unter und zog sie mit sich ins Haus.
Nach dem Essen tranken sie zusammen die zweite Flasche Wein, und Paul gestand ihr, daß er eigentlich zwei für sie gekauft hatte, aber die eine allein ausgetrunken habe. Sie saß behaglich im Sessel, lachte zuweilen selbstvergessen zu den kleinen Scherzen und Redensarten, mit denen Paul sie unterhielt, über seine Schilderung vor allem des Zeitalters Pauls des Ersten, das uns erst die Nazis gebracht hatte und dann den Krieg und dann dies hier.
„Mein Vater ist an allem schuld“, sagte er lachend, „nur an dem einen nicht, daß wir uns von den Herren Erfolgreichen imponieren ließen, von dem Geld, das sie in knapp zwanzig Jahren wieder in das verarmte Deutschland hineingeschleppt hatten, von den Erfindungen und Entdeckungen, mit denen sie uns überschwemmten und zudeckten. Ja ... das müssen wir nun alles bezahlen.“
Er merkte plötzlich, daß sie ihm nicht mehr zuhörte. Daß sie hinausschaute, auf den Mond, der glutrot hinter den Gebüschen aufging, auf die Dämmerung, die schon längst herabgefallen war. Ihr Gesicht zeigte Entsetzen und eine fürchterliche Leere.
„Woran denken Sie?“ fragte er ziemlich scharf. Sie schrak auf, sah ihn ängstlich an.
Er erhob sich. Er lehnte sich über sie, die Hände auf den Sessel gestützt, so daß sie zwischen seinen Armen gefangen dasaß. Er sagte rauh: „Wenn Sie eine solche Angst haben, nach Hause zu gehn, warum bleiben Sie nicht?“
Sie hielt das Gesicht gesenkt. Sie antwortete schließlich völlig leer und gleichgültig: „Warum eigentlich nicht. Ich habe nämlich gar kein Zuhause mehr. Rausgeschmissen.“
„Der Mann?“
„Nein — die liebe Freundin.“
„Und was wollten Sie nun ...“
Sie erwiderte: „Wenn man Mut hätte ...“
Er sah, daß langsam aus ihren geschlossenen Augen zwei Tränen traten. Dann floß ein ganzer, lautloser Tränenbach über ihre Wangen. Sie bewegte sich dabei überhaupt nicht. Sie gab sich auch keine Mühe, die Tränen zu verbergen, die unaufhaltsam flossen.
Schließlich sagte er leise und zart: „Ist es denn wirklich so schlimm? Kann denn gar nichts mehr daraus werden?“
Endlich schlug sie die Augen auf. „Taschentuch“, sagte sie.
Er reichte ihr sein großes Taschentuch. Sie trocknete sich die Tränen. „Ist es wirklich so schlimm?“ wiederholte er.
Sie antwortete nichts, legte ihm einen Arm um die Schulter, lehnte ihre Wange vorsichtig an seine Schläfe und sagte mit einem leeren, kalten Lächeln: „Aber ich bitte Sie. Es kommt wirklich nicht darauf an.“
Damit nahm sie den Hut ab, mit einer Gebärde der Demut, die ihn halb erschütterte, halb abstieß. Er dachte: Noch ist es Zeit, sie wegzuschicken. Es wäre ehrlicher und anständiger. Dann zog er sie in die Arme und küßte sie. Sie ließ es sich bewegungslos gefallen.
Als weißer Fleck lag plötzlich der Schein des bösartigen Mondes im Zimmer. Die Spielhahnfeder mit Marias Hut glänzte wie betaut, graugrün überpudert.