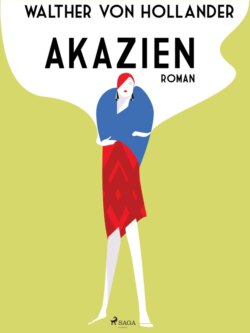Читать книгу Akazien - Walther von Hollander - Страница 8
5
ОглавлениеEs war Abend. Frau von Schellemarr saß im Restaurant des Parkhotels. Sie hatte ihren breitrandigen Hut aufgesetzt und den Schleier zum Schutz so vorgezogen, daß er nur Lippen und Kinn frei ließ. Immer noch bediente der alte schleppfüßige Kellner Fritz. Immer noch versuchte er, sein kleines Hüftleiden durch besonders schneidige Bewegungen auszugleichen. Immer noch gingen seine kleinen schwarzen Mausaugen blitzschnell zwischen den Gästen hin und her. Nur die Neugier war aus ihnen gewichen. Fritz war nun an die Sechzig. Er hatte so viele Menschen bedient, daß es ihm nicht darauf ankam, wie der einzelne aussah, hieß oder was er war. Für ihn war ja sowieso nur wichtig, was der Gast bestellte. Fritz hatte seinen Garten vor der Stadt und beschäftigte sich seit zehn Jahren damit, schwarze Nelken zu züchten, was ihm bisher nicht gelungen war. Jedenfalls erkannte er Frau von Schellemarr nicht.
Oberamtsrichter Holzer, ein Freund ihres Mannes, erkannte sie auch nicht, und seine Frau, die an diesem Damenabend des Stammtisches zwischen ihm und dem Sanitätsrat Rommel saß, starrte nur deshalb empört herüber, weil Frau von Schellemarr rauchte und sich beim Rauchen kleine Tabakblättchen von den Lippen las. »Wer nicht rauchen kann«, sagte die Holzer, „soll’s bleiben lassen. Wenn ich die Regierung wäre . . .« Die Herren nickten flüchtig. Sie waren alle zufrieden, daß Frau Holzer nicht die Regierung war.
Frau von Schellemarr nahm vorsichtig ihren kleinen Handspiegel aus der Tasche. Sie mußte ihr Gesicht studieren. Sie mußte wissen, ob sie ebenso aufgedunsen war wie die Frau Oberamtsrichter, ebenso eingefallen wie Frau Stadtdirektor Trapp, ebenso gefältelt wie Frau Sanitätsrat Rommel, die doch alle einmal ganz hübsche Frauen gewesen waren. Wenn man täglich mit sich selbst umgeht, merkt man ja nicht, wie die Zeit das Gesicht umformt.
Sie holte aus ihrer Handtasche das kleine Leporello-Album mit den Fotografien ihrer Familie hervor und entfaltete es. Da waren die drei C, Claus, Clemens und Clara, ihre Kinder, und sie, Marianne, war in ihrem Aufwachsen und Großwerden mitfotografiert.
Sie verglich ihr Spiegelbild mit den Bildern von damals. Natürlich: auch sie hatte sich verändert. Das Gesicht von 1938 war nicht das Gesicht von 1918. Manche Linie war ausgewischt. Das zarte Tal zum Beispiel zwischen Stirn und Brauen war ausgefüllt. Aber andere Linien, die spöttisch-heitere Linie des Lächelns um den Mund, die Linie des Stolzes zwischen Hinterkopf und Nacken, waren klarer und freier geworden. Es war kein anderes Wesen zum Vorschein gekommen, sondern nur das gleiche Wesen hatte sich entwickelt. Dieselbe Frau, die damals ihre Kinder erzogen, ihren Haushalt geführt und ihre Einsamkeit ertragen hatte, die gleiche Frau mit den dunkelbraunen Haaren und den sehr hellen Augen (Meer-und-Watt-Augen, Möwen-Augen, Wald-Augen hatte sie Friedrich von M. genannt), die gleiche Frau saß hier am Tisch, und gegen die alten Damen da drüben, die gleichen Alters waren mit ihr, war sie eine junge Frau. Warum?
Friedrich von M. hatte ihr oft merkwürdige Sprüche gesagt, von denen er behauptete, sie seien chinesische Weisheitssprüche oder persische Dichtererkenntnisse. Erst viel später hatte er ihr gestanden, daß es seine eigenen Sprüche waren, die er mit etwas Patina versah, um ihnen eine größere Autorität zu verleihen. Weisheit wird nie gern genommen, hatte er behauptet. Aber Weisheit von gestern immer noch eher als Weisheit heutiger Menschen.
Einer der Sprüche jedenfalls lautete:
Leiden hat sie gegerbt,
Leid hat sie verjüngt,
Schmerz war ihre Nahrung,
Schmerzen machten sie schön.
Damals hatte sie sich gegen diese »Schmerzverehrung« gewehrt. Aber jetzt, wenn sie die Frauen ansah, die zumeist nicht Schmerz noch Schmerzen, nicht Leid noch Leiden von Grund her kannten, jetzt sah sie, daß er doch wieder recht gehabt hatte. Die alten Leute da drüben, ihr gleichaltrigen, taten ihr leid, weil es ihnen so schlecht bekommen war, daß es ihnen immer gleichmäßig gut ging.
Sie hatte fast Lust, aufzustehen, hinüberzugehen, die alten Bekannten zu begrüßen und sich auf jenen leeren Stuhl zu setzen, der dastand, als sei er für sie aufgehoben und freigehalten. Sie ging aber nicht. Denn in diesem Augenblick kam die Sängerin Hippler, das Ehrenmitglied der Tafelrunde, eine etwas weingerötete Sechzigerin, die vierzig Jahre zuvor ihre Stimme verloren hatte und daraus den Befähigungsnachweis zog, anderen die Stimme zu verderben. Sie grüßte mit der gleichen, unverändert kratzigen Stimme, mit der sie damals der Frau von Schellemarr Klatschgeschichten über Friedrich von M. versetzt hatte. Sie gab wie vor dreißig Jahren dem Frühling schuld an ihrer Heiserkeit, und während sie sich auf den einzig freien Stuhl setzte und damit die Tischrunde vollzählig machte, hatte sie bereits das Rotweinglas ergriffen und als unfehlbares Heilmittel gegen Heiserkeit zur Hälfte geleert.
Frau von Schellemarr aber fühlte sich voll Heiterkeit aus dieser »geschlossenen« Gesellschaft ausgeschlossen, beugte sich wieder über ihre Bilder, über ihre Vergangenheit, die zu erklären, aufzusuchen, endlich in ihr Leben einzubauen, mit der Frieden zu schließen sie hergekommen war.
Sie nahm vorsichtig das kleine, goldgeränderte Monokel heraus, das sie eigentlich ihres schwachen rechten Auges wegen tragen sollte, und hielt es sich vor das Auge. Sie betrachtete eingehend die seltsam birnenförmige Kopfform des kleinen Clemens. Sie hatte gerade ein bißchen Schädelkunde getrieben. Ließ sich ihr Wissen um ihre Kinder vereinen mit den Erkenntnissen dieser Wissenschaft? Die tiefen Buchten der Schläfe (die Schlaftäler des Zornes hatte ihr Lehrer sie genannt), die Höcker über den Ohren (Eigensinn wohnte hier neben Durchsetzungskraft), das etwas zu kleine Kinn, das er von seinem Vater hatte . . ., das bedeutete . . .
Sie beantwortete sich diese Frage nicht mehr. Ein Schreck kam aus dem Bild. Hier rechts stand der Rosenstock, die große La France am Eingang des Obstgartens. Ein Schatten fiel über die Rosen . . ., kein Zweifel war möglich: es war der Schatten Friedrich von M.s. Man sah den Rand eines Strohhutes. Man sah den Hals, von einer Reiterbinde umschlossen. Warum hatte sie das nie vorher gesehen? Warum hatte niernand diesen Schatten entdeckt? Jetzt sah sie auch den Schatten eines Fotoapparates. Während sie, Marianne, auf der Jagd nach einem Bild des stets störrischen Clemens war, hatte er, Herr von M., sie erjagt.
Er gestand ihr damals, es sei das zweiundzwanzigste Bild, das er besaß. Lauter Bilder, die sie nicht kannte, lauter Gesichter, von denen nur er wußte. Und sie hatte es nicht gemerkt, daß er sich ihrer bemächtigte, daß er ihr Wesen bestahl. Oder –? Nun, sie hatte es doch manchmal gemerkt und wollte es nur nicht zugeben. Es war ja nicht sehr wichtig. Warum sollte Herr von M., der sehr viel fotografierte, der es von seinen Reisen her gewohnt war, alles mit der Kamera aufzufangen und nach Hause zu tragen, warum sollte er sie nicht fotografieren?
Aber damals, in diesem Augenblick, hatte sie es erkannt: eigentlich sollte sie ihm verbieten, Bild um Bild von ihr zu stehlen, Bild um Bild von ihr aus ihrem Hause, aus ihrer Familie wegzutragen. Hatte er ihr nicht selbst erzählt vom Bildzauber der Primitiven und daß man jemanden zwingen könne, die Bilder und Abbilder mit der lebendigen Gestalt zu erfüllen?
Ja . . . damals zum erstenmal erschrak sie; und dann? Dann vergaß sie den Schrecken, drängte ihn weg, übersah ihn so sehr, daß sie den Schatten nicht gesehen hatte . . ., zwanzig Jahre nicht gesehen, und sah ihn jetzt erst, da der Schattenwerfer schon so lange tot war.
Sie zog den Schleier ganz vor ihr Gesicht. Es war eine Gebärde voll größter Trauer. Dann erhob sie sich und ging schnell aus dem Restaurant.
Die Köpfe der Stammtischrunde bewegten sich, wie von einer Schnur gezogen, ihr nach. Frau Sanitätsrat Rommel sagte: »Hübsche Person. Bloß ein bißchen auffällig.« Und die Sängerin Hippler schrie, so laut es ihre Heiserkeit gestattete: »Sie erinnert mich an eine Schauspielerin . . ., ja, an wen erinnert sie mich bloß?« Frau Oberamtsrichter Holzer ermunterte sie, indem sie ein paar der Schauspielerinnen vorschlug, die in jenen zwei sagenhaften Sangesjahren der Hippler berühmt gewesen waren: »Die Sorma? Die Lehmann?«
Die Hippler winkte jedesmal ärgerlich ab, als müsse sie eine Fliege von ihrem Gesicht verjagen. Dann schrie sie: »Wenn ich mich nicht sehr irre, wenn ich mich nicht ganz furchtbar täusche . . ., nein . . ., sie war es doch nicht.«
Damit erhob sie das Glas und trank Herrn Sanitätsrat Rommel zu. Sie tat es, um auf diese Weise schlau sein Verbot zu umgehen, denn er hatte ihr streng untersagt, mehr als drei Schoppen Rotwein pro Abend zu trinken, teils ihrer Stimme, teils ihrer Nase, teils ihres Herzens, teils ihres schmalen Geldbeutels wegen. »Wenn ich mich nicht sehr irre«, räusperte sie jetzt mehr für sich, »ich habe . . ., ich könnte es beschwören . . ., aber das Gedächtnis ist nicht meine stärkste Seite . . .« Niemand von der Tafelrunde hörte mehr zu.