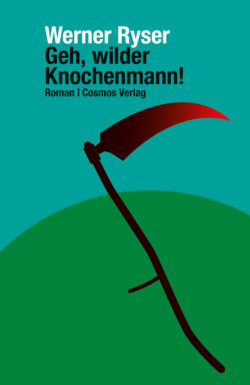Читать книгу Geh, wilder Knochenmann! - Werner Ryser - Страница 11
4
ОглавлениеGegen fünfzig Seiten- und Quertäler gehören zum Gemeindebann von Langnau. Der Gohlgraben ist eines von ihnen. Er grenzt im Westen an den Oberfrittenbachgraben, zu dem auch die Dürsrüti gehört, wo Simons Vater ein Stück Wald besessen hatte, das inzwischen Eigentum von Moritz Diepoldswiler war und von dessen Sohn Viktor bewirtschaftet wurde. An den bewaldeten Hängen zu beiden Seiten des Talbodens, durch den die Gohl, ein von Buschwerk bestandener Bach fliesst, gab es zahlreiche Einzelhöfe. Einer von ihnen war Hollerbüelhus. Das dreihundert Jahre alte Gehöft mit seinem für die Gegend typischen Krüppelwalmdach, dessen Balkenwände im Lauf der Zeit schwarz geworden waren, lag auf halber Höhe zum Hohgrat. Frühere Generationen hatten hier den Wald gerodet. Jetzt lebten Anton Reist, seine Frau, der achtzehnjährige Michel, die um drei Jahre jüngeren Zwillinge, Olga und Frieda, und der Nachzügler, der vierjährige Christian, auf Hollerbüelhus.
Sie waren keine glückliche Familie. Der Bauer, ein grosser, magerer Mensch, war schweigsam und verbittert. Er war verschuldet und litt darunter, dass er es auf keinen grünen Zweig brachte. Gemessen an Grossbauern wie Simons zu Tode gekommener Vater war Reist ein armer Schlucker. Ausser einer prächtigen Aussicht auf die Alpenkette gab sein Land nicht viel her. Der Pflanzplätz und die beiden Äckerchen lagen am Hang und waren mühsam zu bearbeiten. Das Gras der zu Hollerbüelhus gehörenden Wiesen reichte als Winterfutter knapp für seine sieben Kühe und das Pferd. Auf dem Hof mussten alle mithelfen. Was man erarbeitete, war für den Eigengebrauch bestimmt. Überschüsse, die man auf dem Markt hätte verkaufen können, gab es nicht. Reist konnte sich auch kein Gesinde leisten. Höchstens einen Verdingbuben wie Simon, der einmal Michels Aufgaben übernehmen sollte, sobald dieser von zu Hause fortziehen würde. Damit war früher oder später zu rechnen, denn mit der Geburt Christians hatte der Älteste seine Hoffnung, den väterlichen Betrieb zu erben, begraben müssen. Er war ein in sich gekehrter junger Mann, der mit seinem Schicksal haderte. Das galt auch für die Meisterin, eine vergrämte, kleine Frau, die, obwohl erst vierzig, vorzeitig gealtert war. Sie besorgte mit ihren beiden rotwangigen, bezopften Töchtern, die ständig die Köpfe zusammensteckten, den Haushalt und war für das Kleinvieh und den Pflanzgarten zuständig.
Seit drei Tagen schneite es ununterbrochen. Im Flockenwirbel, der wie ein Vorhang aus grob gewobenem Halbleinen über dem Land lag, konnte Simon die hohen, dunklen Tannen am Waldrand hinter dem Hof nur schemenhaft erkennen. Das Fenster der Wohnstube war hell erleuchtet. Es war Heiligabend. Der Bauer und seine Familie feierten drinnen im Haus bei Kartoffeln, Kraut, Gesottenem und Gesalzenem. Zur Nachspeise würde es mit Zimt gewürzte Chüechli geben. Später würden sie die Kerzen am Baum anzünden, die Weihnachtsgeschichte lesen und Lieder singen.
Simon stand draussen. Ein langer Tag neigte sich seinem Ende entgegen. Wie immer hatte er warten müssen, bis Res Röthlisberger von der Genossenschaftskäserei in Gohl die Milch aus den beiden Kannen, die er jeden Abend auf einem Handkarren ins Tal hinunterschaffte, in Empfang genommen und gewogen hatte. Es war nicht so, dass die Ersten, die in der Käserei eintrafen, zuerst an die Reihe kamen. Röthlisberger, ein vierschrötiger, rotgesichtiger Kerl mit feistem Nacken, wartete vor dem Zugang zu seinem Reich, bis die Schar der Milchbuben beisammen war. Dann reihte er sie ein, wie es der gottgewollten Ordnung entsprach: Zuvorderst die Söhne der vermögenden Bauern, die mit Ross und Fuhrwerk gekommen waren, dann jene, die einen kräftigen Dürrbächler, einen Berner Sennenhund, vor ihren Wagen gespannt hatten, hinter ihnen solche wie Simon, die ihren Karren selber zogen, und schliesslich die Kinder von Taunern, arme Tröpfe, welche die paar Liter Milch, die vom Vater einer mageren Kuh abgepresst worden waren, in einer Brente den langen Weg durch den Gohlgraben hinuntergetragen hatten.
Simon, der weit hinten in der Reihe stand, wartete ergeben, während sich der Schnee auf seine Schultern und den mit einer Wollmütze bedeckten Kopf setzte. Endlich konnte er seine beiden Milchkannen auf die Waage stellen.
«Reist Anton, sechsundneunzig Kilo!», rief Röthlisberger. Armin Aregger, der Dorfschulmeister notierte das Gewicht.
Anders als der gedrungene Käser war Aregger lang und schmal. Sein kurzgeschnittenes, schwarzes Haar, die tiefliegenden, dunklen Augen und die scharfen Falten zu beiden Seiten seines dünnen Lippenpaares gaben ihm ein strenges, verbittertes Aussehen. Verbittert war er in der Tat. Seine Stelle war ihm nach Abschluss des Lehrerseminars Hofwil von der Obrigkeit zugewiesen worden. Er mochte von Höherem geträumt haben, von einer Anstellung in Bern vielleicht, allenfalls in Langnau, aber gewiss nicht im Gohlgraben, wo er sich und seine Familie mit seinem Jahreslohn von hundertvierzig Franken nur über Wasser halten konnte, wenn er die Bücher Röthlisbergers, der keinen geraden Satz zustande brachte, als dessen Gehilfe führte. Er hob den Kopf, musterte Simon mit kaltem Blick und übergab ihm die Quittung für die gelieferte Milch. Dann, mit einer Geste, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen, bedeutete er dem Jungen zu verschwinden.
Simon hatte seinen Karren gepackt und sich auf den Rückweg gemacht. Nach einem langen, mühsamen Aufstieg im Schneegestöber durch den winterlichen Wald stand er nun am Brunnen. Zitternd vor Kälte wusch er mit steifen Fingern die beiden Kannen aus. Er trocknete sie mit einem Lappen und trug sie in den Stall zurück. Im Schein der Laterne kontrollierte er, ob sie auch glänzten, so dass der Bauer am nächsten Morgen keinen Anlass haben würde, ihn zu schlagen.
Im Stall war es warm. Manchmal, wenn ihn sein Elend zu überwältigen drohte, legte sich der Junge zwischen die Vorderbeine einer Kuh und liess sich von ihr ablecken. Ihm war dann, als wolle ihn das Tier trösten.
Es war bereits das zweite Weihnachtsfest, das Simon auf Hollerbüelhus erlebte. Er gehörte nicht zur Familie. Man wollte ihn nicht dabeihaben, wenn es etwas zu feiern gab. Die Meisterin stellte ihm bei solchen Gelegenheiten jeweils einen Teller, der etwas reichlicher gefüllt war als sonst, auf den Tisch in der Küche. Wenn er mit dem Essen fertig war, erwartete man, dass er in seine Kammer ging und die Familie nicht störte.
Julia, die Leitkuh, hob den Schwanz und pisste. Der Junge hielt seine klammen Hände in den warmen Strahl. Mit einem Wisch Heu trocknete er sie ab und trat vors Haus. Durchs Fenster versuchte er einen Blick in die Stube zu erhaschen, wo die Reists um den Christbaum sassen. Sie sangen. O du fröhliche, o du selige … Bilder von Weihnachten auf dem Auenhof stiegen vor ihm auf. Feste mit Mutter, Vater und den Geschwistern. Auch das Gesinde war dabei gewesen. Anders als hier, wo er vom Zusammensein ausgeschlossen war.
Später, nachdem er sein Essen, das in der Küche für ihn bereitstand, verschlungen hatte, stieg er hinauf in den Gaden, in seine Kammer, die nicht viel mehr war als ein Bretterverschlag. Eine Pritsche, eine Truhe für die wenigen Habseligkeiten, die er besass, ein alter Tisch und ein wackliger Stuhl. Es war bitterkalt. Er zündete eine Kerze an. In der Winterluft, die durch die Ritzen unter der Dachschräge drang, flackerte die Flamme. Sein Atem bildete Wölkchen, die sich verflüchtigten. Das kleine Fenster war mit Eisblumen beschlagen. Simon zog seine schweren, mit einer Holzsohle ausgestatteten Schuhe und die vom Schnee durchnässte Drillichjoppe aus und schlüpfte in den Kleidern zwischen die beiden alten Pferdedecken, die ihm auf der mit Stroh gefüllten Matratze als Leintücher dienten. Er zog seine Knie zum Kinn und presste die Arme gegen die Brust.
Er werde noch früh genug erfahren, was es heisse, eine Waise zu sein, hatte ihm Esther prophezeit. Inzwischen hatte Simon begriffen, dass das vor allem eines bedeutete: zu arbeiten. Tag für Tag. Von früh bis spät. Anton Reist behandelte ihn als Knecht und verlangte mehr von ihm, als ein Zwölfjähriger zu leisten im Stand war.
Um halb fünf musste er aufstehen, um im Stall beim Melken zu helfen, und dann ging es weiter, bis er am Abend, nachdem er aus der Käserei in Gohl zurückgekehrt war, die Milchkannen ausgewaschen hatte. Auf dem Hof gab es immer viel zu tun: Im Frühjahr waren die beiden Äcker zu bestellen, im Sommer wurde dreimal das Gras eingebracht, und im Herbst mussten Obst und Getreide geerntet werden. Von Oktober bis April ging er zwar in die Schule. Aber bevor er sich auf den Weg hinunter nach Gohl machte und sobald er von dort zurückkehrte, galt es, auf dem Hof mitzuhelfen. Endlos hatte er Holz zu spalten, das man brauchte, um den Kachelofen in der Stube zu heizen. Ferner hiess man ihn Pfosten für die Viehzäune anzuspitzen, aus Weidenruten Körbe zu flechten, und wenn das alles erledigt war, ging er der Meisterin und ihren Töchtern in der Küche zur Hand. Wenn es im Wald zu tun gab, liess ihn Reist nicht in die Schule. Simon musste die Bäume, die der Bauer und sein Ältester fällten, entasten und die Rinde schälen. Einer wie er, aus dem ohnehin nichts werde, mache sich besser nützlich, als faul in der Schulstube zu hocken, meinte der Meister in solchen Fällen. Wenn er mit ihm nicht zufrieden war, musste Simon die Hosen bis zu den Kniekehlen hinunterziehen. Dann versohlte ihm der Bauer, der im Zorn zu Gewalttätigkeiten neigte, mit harter Hand den nackten Hintern. Olga und Frieda schauten zu, tuschelten miteinander und kicherten. Simon biss die Zähne zusammen, liess keinen Laut über seine Lippen kommen. Immerhin schlug ihn der Meister nie ohne Anlass. Wenn es nichts auszusetzen gab, schwieg er und liess ihn in Ruhe.
Man nannte ihn nie bei seinem Namen. Für die Reists war er lediglich «der Bub». Manchmal fragte er sich, ob sie wussten, dass er Simon hiess. Man begegnete ihm mit Gleichgültigkeit und sprach mit ihm nur, um ihm Anweisungen zu geben oder um ihn herabzusetzen. Das bekam er auch bei den Mahlzeiten zu spüren. Er wurde selten satt. Die Meisterin schöpfte ihm jeweils einen Teller voll. Nicht mehr. Anders als für Michel, die Zwillinge und Christian gab es für ihn keinen Nachschlag. «Wenn du mehr essen willst», hiess es, «kannst du bei deinem Onkel, dem Waisenvogt, dafür sorgen, dass das Pflegegeld, das die Gemeinde für dich bezahlt, erhöht wird». Dabei hatten die Reists sich nicht zu beklagen. Nicht einmal für Simons Kleider mussten sie aufkommen. Er trug die Sachen, aus denen sein Bruder Jakob, der im Pfarrhaus von Langnau in Pflege war, herausgewachsen war. Jeweils im Frühling und im Herbst übergab ihm die Pfarrfrau Hemden, Hosen, Strümpfe, Joppen und Schuhe.
Von unten aus der warmen Stube, wo die Reists die Geburt Christi feierten, drang Gesang in Simons Kammer. Er hörte die hellen Stimmen der Zwillinge: O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter und Als ich bei meinen Schafen wacht, ein Engel mir die Botschaft bracht. Simon kannte die Texte und Melodien. Er hatte die Lieder einst selber gesungen. Für ihn stammten sie aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt.
Er tastete unter das Kopfende des Strohsacks, der ihm als Matratze diente. Die Rauchwurst, die er sich für Heiligabend aufgespart hatte, war noch da. Er holte sie hervor und biss hinein. Esther hatte sie ihm, zusammen mit anderen guten Dingen, am vergangenen Sonntag nach der Predigt in die Hand gedrückt, heimlich, denn keiner durfte wissen, dass sie zu Hause auf dem Auenhof, wo sie jetzt als Magd diente, für ihren kleinen Bruder Esswaren aus der Speisekammer entwendete. «Erzähl niemandem etwas davon», hatte sie das erste Mal gesagt, als sie ihm am Grab von Vater und Mutter auf dem Gottesacker hinter der Kirche ein kleines Esspaket zugesteckt hatte. Er hatte begriffen. Viktor Diepoldswiler, der jetzt ihr Meister war, würde sie bestrafen, wenn er davon wüsste. «Erzähl niemandem etwas davon», beschwor sie ihn Sonntag für Sonntag, wenn er ihre Liebesgabe, die ihm im Verlauf der Woche half, seinen Hunger zu stillen, unter seiner Joppe verschwinden liess.
Zum Glück hielt es Anton Reist für seine Christenpflicht, den Tag des Herrn zu heiligen, wie er zu sagen pflegte, wenn er das Pferd vor den Leiterwagen spannte und mit den Seinen und dem Verdingbuben nach Langnau in die Kirche fuhr. Simon bekam dadurch Gelegenheit, einmal in der Woche seine Geschwister zu sehen.
Nach dem Gottesdienst durfte er jeweils mit Jakob ins Pfarrhaus, wo er zum Mittagessen eingeladen war. Mit verschlossenem Gesicht war er anfänglich am vornehm gedeckten Tisch gesessen, wusste nicht recht mit Gabel und Messer umzugehen und wagte kaum zu sprechen. Der Bruder hatte ihn auffordern müssen, sich den Teller ein zweites Mal füllen zu lassen. Inzwischen schöpfte ihm Lydia Amsoldinger nach, ohne dass er sie darum bitten musste.
Anders als die meist kräftig gebauten Bäuerinnen der Gegend war die Pfarrfrau eine vornehme Dame, ein zartes Wesen, blass und feingliedrig. Ihr einst blondes Haar war von grauen Strähnen durchsetzt. Sie war eine geborene Willading und stammte aus einer reichen, ehemals regimentsfähigen Berner Familie. Nach dem Essen setzte sie sich manchmal ans Klavier und sang dazu mit ihrem empfindsamen, dunklen Alt romantische Lieder. Manchmal wurde sie von Hustenkrämpfen geschüttelt. Sie hielt ein Spitzentüchlein vor den Mund und sagte «Excusez», wenn der Anfall vorbei war. Ihr Mann betrachtete sie sorgenvoll und legte schweigend seine Hand auf ihre Schulter, während sie sich an seine Brust lehnte. Sie habe Schwindsucht und werde wohl früh sterben, hatte Jakob Simon einmal erklärt.
Nach dem Essen verbrachten die Brüder zwei Stunden draussen im Garten, wenn es das Wetter zuliess, sonst in Jakobs Zimmer. Meistens setzte sich der Ältere hinter die Staffelei, die ihm Lukas Amsoldinger, der an sein Talent glaubte, gekauft hatte. Simon sah ihm zu, wie er malte: Immer wieder Porträts der Pflegemutter, an denen der Bruder erkannte, was Jakob meinte, wenn er sagte, sie sei vom Tod gezeichnet. Unter seinen Bildern gab es auch jenes einer Frau, auf deren Scheitel anstelle von Haaren Schlangen wuchsen, deren Gesicht mit Drachenschuppen bedeckt war und deren Zähne im weit aufgerissenen Mund den Hauern von Ebern glichen. Das sei das Haupt der Medusa, erklärte Jakob, dessen Anblick jeden Betrachter in Stein verwandle. Und dann erzählte er dem Bruder die Sage von Perseus, dem Sohn des Göttervaters Zeus, der Medusa den Kopf abgeschlagen und mit dieser grässlichen Trophäe später Tod und Verderben über seine Feinde gebracht hatte.
Für Simon waren die Sonntage eine Unterbrechung seines leidvollen Daseins im Gohlgraben. Aus der Zuwendung seiner Geschwister schöpfte er die Kraft, die er brauchte, um durchzuhalten. Um halb vier musste er aufbrechen. Mit Esthers Paket an der Brust stieg er den Dorfberg hinauf und gelangte dann durch den Wald zum Pfad, der ihn über den Hohgrat zu Reists Hof führte. Meistens lief er, denn wenn er nicht pünktlich zum Melken in Hollerbüelhus war, setzte es Schläge.
Da die Kinder, die in den Einzelhöfen und Streusiedlungen des Gohlgrabens lebten, in den Sommermonaten auf dem Feld und im Stall gebraucht wurden, fand der Schulunterricht nur im Winterhalbjahr statt. Fünfundsiebzig Mädchen und Buben zwischen sieben und zwölf Jahren drängten sich in eine viel zu enge Stube in einem alten baufälligen Haus in Matten, unweit der Käserei. Dort versuchte Armin Aregger lustlos seinen Zöglingen Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen.
Auch zur Schule musste Simon meist rennen, denn Anton Reist liess ihn erst gehen, wenn er seine Arbeit erledigt hatte. Der Weg von Hollerbüelhus ins Tal hinunter war in knapp zwanzig Minuten zu schaffen, wenn Schnee lag, dauerte es länger. Wer zu spät kam, wurde bestraft, denn Aregger hielt auf Zucht und Ordnung. Er liess seinen pädagogischen Furor an allen aus, die sich etwas gegen seine Regeln zuschulden kommen liessen: am Siebenjährigen wie am Sechstklässler, an Jungen wie an Mädchen – an allen ausser jenen, deren Väter reich waren und für sein karges Gehalt aufkamen und ihm zusätzlich ab und zu durch ihre Sprösslinge eine halbe Speckseite, Würste oder Laiblein Käse zukommen liessen und damit den schmalen Speisezettel des Lehrerhaushaltes bereicherten. So traf es immer dieselben: Kinder von Taunern und Tagelöhnern oder Verdingte wie Simon. Seit er von Anton Reist ersteigert worden war und im Gohlgraben zur Schule ging, gehörte auch er zu jenen, welche die Zähne zusammenbissen, um nicht zum Ergötzen der andern heulen und wehklagen zu müssen, wenn Areggers Rute auf die offenen Handflächen klatschte, die man ihm hinhalten musste, oder wenn man, schlimmer noch, auf dem Tisch des Lehrers lag, das Gesicht der Klasse zugewandt, während der Rohrstock zwölfmal auf den Hintern des armen Sünders sauste. Zwölfmal – nicht mehr und nicht weniger.
Simon lehnte sich gegen Aregger auf, stumm und verbissen. Sein wortloser Widerstand entging dem Lehrer nicht. Er rief den Verdingbuben von Hollbüelhus mehr auf als andere, achtete genauer darauf, dass er seine Gesetze einhielt, nahm jeden Anlass wahr, ihn zu bestrafen. Wollte er ihn brechen? Welche seltsame Befriedigung gab es diesem verbitterten Schulmeister, das ins Elend verstossene Kind eines Grossbauern zu kujonieren?
Simon liess sich nicht brechen. Weder von Armin Aregger noch von Anton Reist. Er setzte den beiden Quälgeistern, die aus seinem Leben einen Dreiklang aus Lieblosigkeit, Demütigungen und Schlägen machten, den unstillbaren Hass entgegen, der in ihm brannte und der auch Moritz und Viktor Diepoldswiler galt, die ihn aus seiner Heimat verbannt hatten. Manchmal wünschte er sich, er wäre Perseus und besässe das Haupt der Medusa. Er stellte sich vor, wie er den Bauern, den Lehrer und die beiden Diepoldswiler in grauen Stein verwandeln würde.
Unten in der Stube war es still geworden. Die Reists waren zu Bett gegangen. Unterdessen hatte Simons Körper so viel Wärme abgegeben, dass er sich zwischen seinen beiden Decken wohlfühlte. Morgen würde auch er Weihnachten feiern können. Die Amsoldingers hatten ihn und Esther zum Essen eingeladen. Er würde sich den Bauch mit Chüechli vollschlagen können, mit Hasenöhrli, Rosenchüechli und Verhabni, den in Butter gebackenen Leckereien, die man in allen Emmentaler Haushalten bei festlichen Anlässen auf den Tisch stellte und von denen man auch Tagelöhnern und Bettlern mit nach Hause gab. Selbst ihm hatte die Meisterin heute Abend zwei Strübli neben den Teller gelegt, allerdings ohne Schlagrahm, der seinerzeit auf dem Auenhof dazugehört hatte. Wenn er jetzt in der Dunkelheit seiner elenden Kammer daran dachte, dass er morgen im Pfarrhaus ein paar Stunden mit seinen Geschwistern verbringen durfte, dass man ihm vielleicht sogar ein Geschenk machen würde, empfand er eine fast unsinnige Vorfreude. Simon gab seine embryonale Stellung auf und glitt unmerklich in jenen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf, in dem sich Phantasie und Träume vermengen.