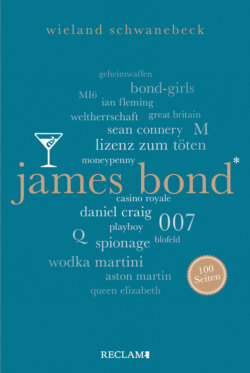Читать книгу James Bond. 100 Seiten - Wieland Schwanebeck - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление001 Prolog: Keiner kann es besser
Überlebenskünstler
Allmählich wird’s brenzlig – der am wenigsten geheime Geheimagent der Welt rast in einem mörderischen Tempo die Skipiste hinab, vier KGB-Schergen dicht auf seinen Fersen. Dass sie von der jungen Frau auf den Plan gerufen worden sind, mit der er keine fünf Minuten zuvor noch das Bett geteilt hat, ist dem Agenten vermutlich klar, aber er scheint über den Verrat nicht verbittert zu sein. Eher dankbar für den sportlichen Wettkampf, den ihm seine Gegner liefern – schließlich hätte die Frau ja auch, wie es Honey-Traps in Spionagestorys zu tun pflegen, einfach selbst den Dolch zücken und ihn ins Jenseits befördern können. Derart profan, per schnöder Attacke aus dem Hinterhalt, wird in seiner Welt aber nicht gestorben. Stattdessen bekriegt man sich sportlich: auf Skiern, zu Pferd, in irrwitzig ausgestatteten Fahrzeugen, mit Kugelschreibern, die eigentlich Pistolen sind, und mit Pistolen, die zum Teil aus Kugelschreibern bestehen.
Auf der Skipiste hält sich der Agent seine Verfolger u. a. mit einem halsbrecherisch anmutenden Salto und mit einem gezielten Schuss aus seinem Skistock-Gewehr vom Hals. Kurz darauf drehen die Verfolger ab, gehen sie doch davon aus, dass ihnen der gähnende Abgrund, auf den der Agent zurast, die Arbeit abnehmen wird. Das überlebt doch kein Mensch, oder? Natürlich nicht – ein Übermensch freilich schon, und ein solcher ist James Bond, der seit 1953 in etlichen Büchern, Filmen, Comics und Computerspielen bewiesen hat, dass ihm feindliche Killerkommandos ebenso wenig anhaben können wie die Kontrahenten, die ihm sein Vorgesetzter M nachsagt: »eifersüchtige Ehemänner, wütende Chefs, verzweifelte Schneider«. Kamal Khan (Louis Jourdan), Bonds Gegenspieler in Octopussy (1983, R: John Glen), tadelt ihn für seine hässliche Angewohnheit, dauernd zu überleben (»You have a nasty habit of surviving.«), und man möchte anerkennend ergänzen: stilvoll zu überleben. Deshalb imponieren am Sprung in den Abgrund, mit dem Bond sich seinen Verfolgern entzieht, nicht allein der Wagemut und auch nicht der dramaturgisch wenig überraschende Fallschirm, den 007 aus dem Hut bzw. aus dem Rucksack zaubert. Was uns noch mehr beeindruckt, ist das Muster des Schirms – es zeigt den Union Jack, mit dem Bond seinen überlisteten Systemrivalen sozusagen den Mittelfinger entgegenreckt, bevor Carly Simon im Vorspann des Films die sprichwörtlich gewordene Hymne auf 007 singt: »Nobody Does It Better«, keiner kann es besser.
Die eben beschriebene Sequenz steht am Anfang von Der Spion, der mich liebte (The Spy Who Loved Me, 1977, R: Lewis Gilbert), dem zehnten Film der James-Bond-Reihe. Sie tummelt sich immer noch auf den vorderen Plätzen, wenn Fans und Kritiker Listen der ikonischsten und spektakulärsten Bond-Momente zusammenstellen – das tun sie im Übrigen sehr häufig. Als James Bond zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in London 2012 einflog, klaute er bei sich selbst und griff noch einmal auf den Union-Jack-Fallschirm zurück. Der Spion, der mich liebte ist nicht der erste James-Bond-Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber der vom Stuntman Rick Sylvester vollführte Sprung bringt das Erfolgsrezept so mustergültig auf den Punkt, dass er für mich bis heute die Bond’sche Urszene verkörpert. Das zur Schau gestellte handwerkliche Geschick ist vollkommen, die Choreographie so imposant wie präzise, Witz und Thrill ergänzen sich auf eine Art und Weise, wie man es eher von Alfred Hitchcock kennt – bei dem die Kinoversion von 007 sich einiges abgeschaut hat. In der bereits angedeuteten Verkettung dramaturgischer Unwahrscheinlichkeiten, die den lebensrettenden Sprung erst ermöglicht, drückt sich zudem ein trotziger Wille zum Unerklärlich-Märchenhaften aus, dem man sich nur schwer entziehen kann.
Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard formuliert im 19. Jahrhundert seine Vorstellung vom Sprung in den Glauben – einem paradoxen Bekenntnis dazu, aller Skepsis und allem Zweifel zum Trotz jeden Tag aufs Neue das Wagnis einzugehen, sich zu Gott zu bekennen. Vielleicht ist James Bonds Sturz von der verschneiten Klippe ja in dieser Tradition zu sehen: als ein vorsätzlicher, alle Zweifel über Bord werfender Sprung ins Und ob!, der uns der sturen Gebote des Realismus enthebt und in der vage begründeten Hoffnung (bei Kierkegaard: im Gottvertrauen) geschieht, man werde schon sicher landen oder zumindest ein paar Zentimeter über dem Boden aufgefangen, wie Bond von den überdimensionierten weiblichen Händen, die ihn sachte in den Vorspann des Films hinüber geleiten. Es geht ja meistens etwas knapper zu bei Bond, auch der Timer der radioaktiven Sprengladung in Goldfinger (1964, R: Guy Hamilton) wird erst bei 007 gestoppt.
Was einen eingefleischten James-Bond-Fan zum Augenrollen bringt, sind weder die Kritik an einem bestimmten Film noch die nachvollziehbaren Vorbehalte gegenüber Bonds Sexismus und seinem imperialen Geprotze – schließlich lässt sich über all dies hingebungsvoll debattieren. Richtig ermüdend ist nur die mit dem Abakus angestellte Beweisführung, die die Physik der Filme als unwissenschaftlich und ihre Dramaturgie als an den Haaren herbeigezogen entlarven will. Derlei Argumente prallen an Bond ab wie Maschinengewehrkugeln an der Außenhülle seines Aston Martin DB5. Mit der gleichen Begründung könnte man sich aus dem Rotkäppchen verabschieden, sobald der sprechende Wolf des Weges kommt. Anders als Rotkäppchen bewegt sich James Bond aber nun einmal – wenigstens dem Anschein nach – durch unsere Topographie, konsumiert unsere Markenprodukte und nimmt an unserer Zeitrechnung teil. Was sollte da näherliegen, als ihn auf die für uns geltenden Gesetze der Schwerkraft einzuschwören?
Das aber ist ein Trugschluss, auch wenn sich Bonds Erfinder, Ian Fleming, mit Recht einiges auf seine exakten Schilderungen realer Schauplätze, Parfüms und Gourmetrezepte eingebildet hat. Tatsächlich kann man bei James Bond viel darüber lernen, dass der Schein trügt und uns das vermeintlich Vertraute in Wahrheit fremd ist – immerhin so viel hat Bond noch mit der klassischen Spionagegeschichte gemein, von der er sich ansonsten gründlich emanzipiert hat. Schon im ersten James-Bond-Film, James Bond jagt Dr. No (Dr. No, 1962, R: Terence Young), werden im Fünf-Minuten-Takt die kleinen Enthüllungsscharaden gespielt, die heute noch im Maskenfimmel von Mission: Impossible überdauern. Die scheinbar blinden Bettler sind gerissene Profikiller mit Adleraugen, die eigenen Kontaktleute arbeiten in Wahrheit für die Gegenseite, der von den Einheimischen gefürchtete Drache ist ein feuerspeiendes Panzerfahrzeug, und die harmlos aussehende Zigarette ist mit Zyankali versetzt – immerhin räumt die ansonsten ziemlich nikotinsüchtige Filmreihe mal ein, dass Rauchen tödlich ist. Auch Schauplätze sind hier häufig zu schön, um wahr zu sein. Bonds Skisprung ereignet sich angeblich im fiktiven österreichischen Skiort Berngarten, wurde aber rund um Mount Asgard gefilmt, auf der Baffininsel. Manchmal muss man in den eisigen Norden Kanadas reisen, um dem Publikum einen Eindruck von der Schönheit Österreichs zu vermitteln.